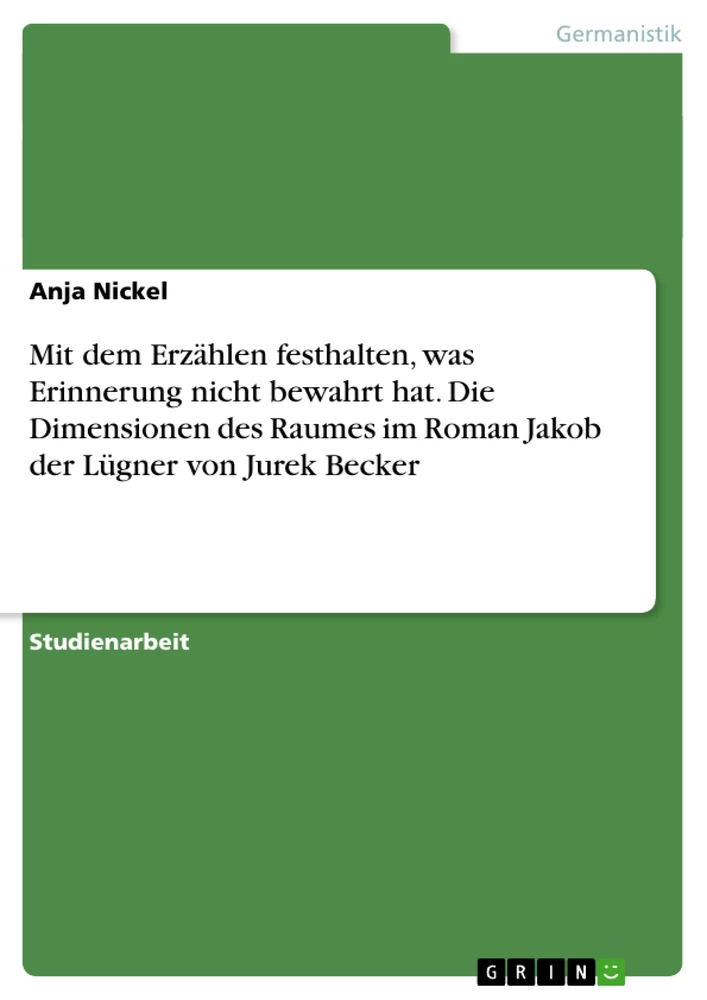Jurek Beckererlebte seine frühestete Kindheit im Getto von Lodz in Polen und sechs Jahre (1939-1945) in den KZs Ravensbrück und Sachsenhausen. Vor der Deportation hatte ihn sein Vater, vergeblich, "älter gemacht", um ihn vor dem Transport zu bewahren. Über die Jahre wurde sein wirklicher Geburtstag vergessen, so dass man in einer willkürlichen Übereinkunft sein Geburtsdatum auf den 30.09.1937 festgelegte. Erst 1945, als er mit seinem Vater nach Prenzlau/Berlin zieht, erlernt Jakob die deutsche Sprache: Um als deutsche Juden anerkannt zu werden, änderte er seinen Namen in Max und den seines Sohnes in Georg, sprach nur noch Deutsch mit ihm und zwang ihn so, sich an die neue Heimat anzupassen. Der kleine Jurek vergisst das Polnische bereits, ehe er des Deutschen mächtig ist.
Auf dieses Gefühl der Sprachlosigkeit führt Becker später sein Unvermögen zurück, sich an die Zeit in den Lagern zu erinnern. Diesen Zustand des Ausgegrenztseins und doch Teilhaben-Wollens fand er im Laufe seines Lebens immer unerträglicher, so klagte er: “Ohne Erinnerungen an die Kindheit zu sein, das ist, als wärst du verurteilt, ständig eine Kiste mit dir herumzuschleppen, deren Inhalt du nicht kennst. Und je älter du wirst, um so schwerer kommt sie dir vor, um so ungeduldiger wirst du, das Ding endlich zu öffnen.”1Diese Ungewissheit der Vergangenheit beschäftigte Becker Zeit seines Lebens. So bezeichnet er in einem Gespräch mit Heinz-Ludwig Arnold und auch in einigen Schriften das Getto von Lodz als die für ihn "unsichtbare Stadt". Ohne eigene Erinnerung also, erforschte er die Geschichte seiner Vergangenheit und bemühte sich, eigene Gedächtnislücken durch authentische Berichte und Dokumente zu füllen.
Den Anstoß zum Entstehen von Jakobs Geschichte gab Beckers Vater: Er erzählte Jurek von einem Mann, der damals wirklich ein Radio im Getto versteckt hielt, jedoch nicht sehr heldenhaft, durch den Schuss eines SS-Beamten, endete. Zuerst als Drehbuch geschrieben, doch in der sozialistischen DDR nicht als "volkstauglich" erachtet, blieb die Erzählung vom Juden Jakob Jahre ungenutzt. Belletristik wurde nicht als gefährlich erachtet, als Film konnte die Geschichte jedoch nicht an die breiten Massen weitergegeben werden. Aus Verärgerung über die Ablehnung aus obersten Reihen schrieb Becker sie in einen Roman um, der mit dem Titel "Jakob der Lügner" weltberühmt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die "unsichtbare Stadt"
- Figuren im Roman
- Das Radio spaltet die Juden
- Radiofreunde
- Radiogegner
- Die dunkle Bedrohung durch die Deutschen
- Das Radio spaltet die Juden
- Komposition der Räume im Roman
- Der ambivalente Großraum "Ghetto"
- Die Wandlung der Räume im Roman (an ausgewählten Beispielen)
- Realer Raum: Mischas Zimmer
- Illusionärer Raum: Linas Rezeption des Märchens von der Wolke
- Ideeller Raum: Jakobs Lügen im Spiegel der Wirklichkeit
- Die binäre Struktur des Raumes in den beiden Endversionen
- Die Stilistik der Sprache im Roman
- Unfreiwilliges Erzählen im Stile der jüdischen Erzähltradition?
- "Tauben Ohren predigen"- von der Not des Erzählers
- Schluss: Widerstehen statt Widerstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Jurek Beckers Roman "Jakob der Lügner" im Hinblick auf die Darstellung von Raum und Erinnerung im Kontext des Holocaust. Der Roman thematisiert die Erfahrung des Gettos in Lódz und die Auswirkungen der Shoah auf das Leben der Figuren. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle der Sprache, des Raumes und der Illusionen als Mittel zur Bewältigung der traumatischen Vergangenheit.
- Die "unsichtbare Stadt": Die Bedeutung von Raum und Erinnerung im Getto
- Die Konstruktion von Illusionen als Schutzmechanismus
- Die Ambivalenz von Sprache und Identität im Kontext der Shoah
- Die Rolle des Radios als Symbol für Hoffnung und Verzweiflung
- Die Grenzen von Widerstand und die Bedeutung des Überlebens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund des Romans dar und beleuchtet die biografischen Bezüge Jurek Beckers zur Shoah. Sie führt den Begriff der "unsichtbaren Stadt" ein und erläutert die besondere Bedeutung des Gettos von Lódz für die Geschichte Beckers und seines Romans.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Charakterisierung der Figuren im Roman und teilt sie in zwei Gruppen ein: die Radiofreunde und die Radiogegner. Im Fokus steht dabei die Figur des Jakob, dessen Lügen als Schutzmechanismus für die Gettobewohner, aber auch als Mittel zur Bewältigung seiner eigenen Traumata fungieren.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Komposition der Räume im Roman. Die Analyse untersucht die Wandlung der Räume im Laufe der Geschichte, insbesondere die ambivalente Bedeutung des Gettos als sowohl realer als auch symbolischer Ort. Dabei wird die räumliche Gestaltung des Romans als Mittel zur Verdeutlichung von Illusion und Wirklichkeit genutzt.
Das vierte Kapitel widmet sich der sprachlichen Gestaltung des Romans. Die Analyse untersucht den Erzählstil und die Rolle der Sprache im Kontext des Holocaust, insbesondere die Verwendung von Ironie und Humor als Mechanismen zur Bewältigung der Traumata.
Schlüsselwörter
Jurek Becker, Jakob der Lügner, Getto von Lódz, Holocaust, Shoah, Raum, Erinnerung, Sprache, Identität, Illusion, Widerstand, Überleben.
Häufig gestellte Fragen
Welchen biografischen Hintergrund hat Jurek Becker?
Becker überlebte als Kind das Getto von Lodz und die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen, was sein späteres literarisches Schaffen tief prägte.
Was symbolisiert das Radio in "Jakob der Lügner"?
Das Radio ist ein Symbol für Hoffnung. Obwohl Jakob gar kein Radio besitzt, schenken seine erfundenen Nachrichten den Menschen im Getto den Mut zum Überleben.
Was meint Becker mit der "unsichtbaren Stadt"?
Damit bezeichnet er das Getto von Lodz, an das er aufgrund seines jungen Alters und der traumatischen Sprachlosigkeit keine eigenen bewussten Erinnerungen mehr hatte.
Warum wurde die Geschichte erst als Roman und nicht als Film veröffentlicht?
Das ursprüngliche Drehbuch wurde in der DDR als nicht „volkstauglich“ abgelehnt; erst der Erfolg des Romans ermöglichte später die berühmte Verfilmung.
Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Räume im Roman?
Die Analyse unterscheidet zwischen realen Räumen (das Getto), illusionären Räumen (Märchenwelten) und ideellen Räumen, die durch Jakobs Lügen entstehen.
- Citation du texte
- Anja Nickel (Auteur), 2005, Mit dem Erzählen festhalten, was Erinnerung nicht bewahrt hat. Die Dimensionen des Raumes im Roman Jakob der Lügner von Jurek Becker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46197