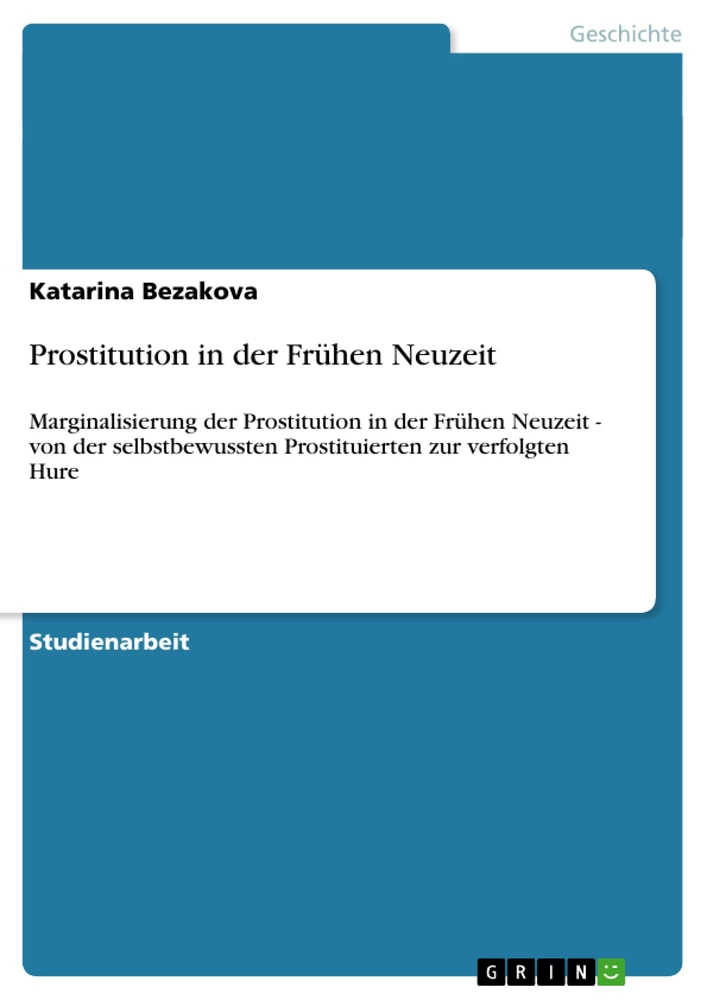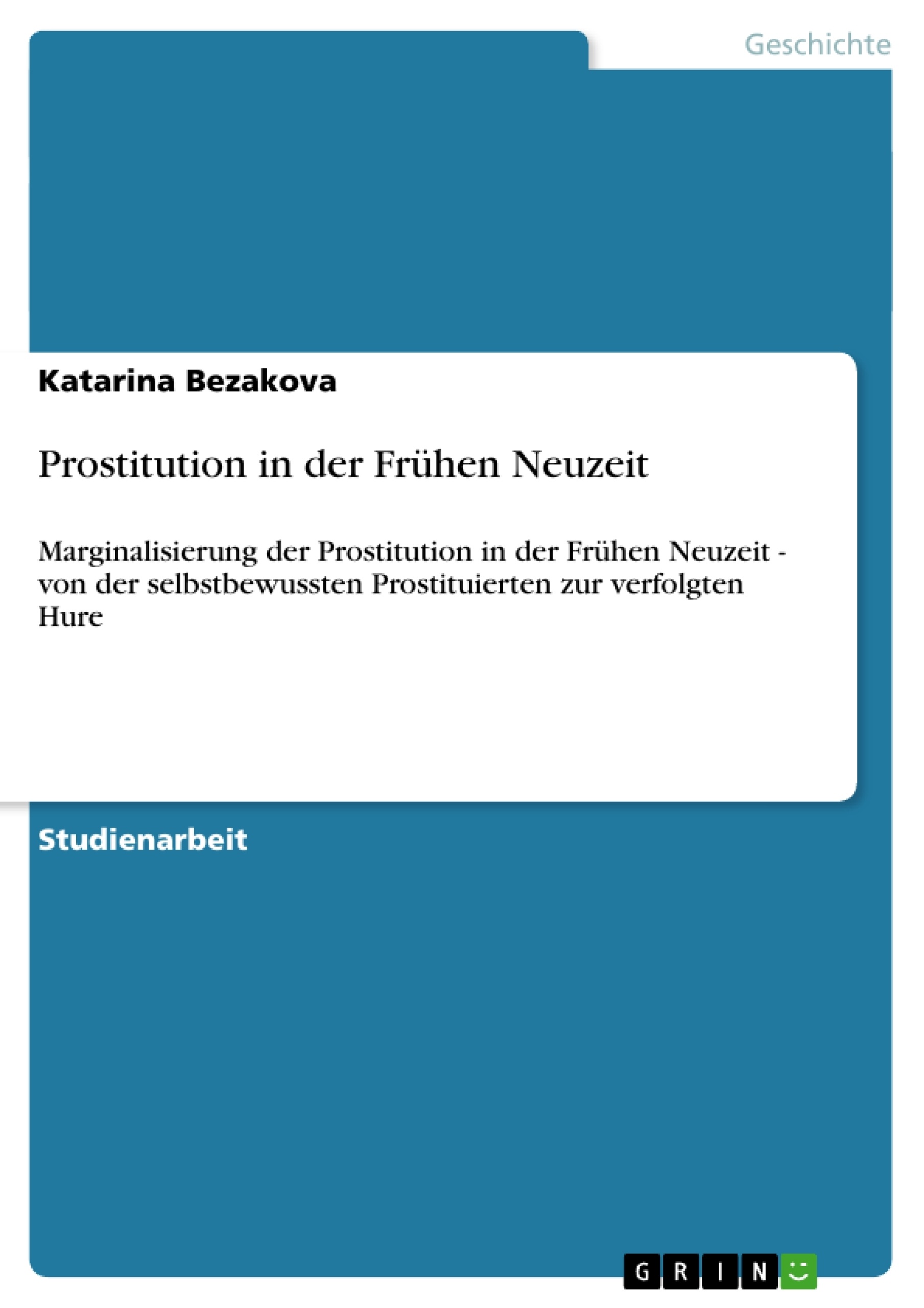Meine Arbeit möchte die Marginalisierung und Kriminalisierung der Prostituierten in der Gesellschaft vom späten Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit ins Blickfeld rücken. Das bedeutet nicht nur, den Wandel der öffentlichen Wahrnehmung auf die Prostitution zu thematisieren, sondern auch das Vorgehen gegen die Prostitution aufzuzeigen. Meine zentrale These ist, dass Prostituierte im späten Mittelalter zwar von der Gesellschaft verachtet wurden, aber trotzdem integriert waren. In der Frühen Neuzeit wurden Prostituierte nicht nur ausgegrenzt, sondern kriminalisiert. Dabei ist die entworfene These von Peter Schuster zentral, die die Entwicklungslinien des Moralsystems erläutert: „Mitteleuropa erlebte im 16. Jahrhundert ein goldenes Zeitalter der öffentlichen und privaten Moral‘, das eine Epoche des ‚sittliche[n] Niedergang[s] im Laufe des 15. Jahrhunderts‘ ablöste.“
Die Art, wie die mittelalterliche Gesellschaft über Prostitution dachte, ist im Allgemeinen nur schwer zu beschreiben. Sie unterscheidet sich nicht nur regional – von Stadt zu Stadt und zeitlich, sondern sogar gegenüber der einzelnen Prostituierten. Die fahrende Frau wurde in der Regel stärker diskriminiert als die Dirne des städtischen Frauenhauses.
Zunächst werden Indikatoren angeführt, die die Einbindung der Prostitution zeigen. Darauf folgen solche, an Hand derer sich die Distanzierung und die damit verbundene Marginalisierung der Dirnen aufzeigen lässt. Laut Peter Schuster wurde die um 1500 geschehene Wende nicht durch die Reformation hervorgerufen, jedoch war es für sie möglich darauf aufzubauen. Mit der Frage, warum es zu dieser Wende kam und was die Änderung der Einstellung der Menschen zur Prostitution verursachte, beschäftige ich mich dann im letzten Teil. Somit wird der Wandel von der selbstbewussten Prostituierten zur verfolgten Hure deutlich dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Indikatoren der gesellschaftlichen Integration der Prostitution
- I Einrichtung der Frauenhäuser
- II Anerkennung der Prostitution durch die Kirche
- III Anerkennung der Prostitution durch die Obrigkeit
- IV Teilnahme der Prostituierten am gesellschaftlichen Leben
- C Indikatoren der gesellschaftlichen Ausgrenzung
- I Ambivalente Stellung zur Prostitution
- II Räumliche Trennung
- III Kleiderordnung
- D Gründe und Folgen der Änderung der Einstellung zur Prostitution
- I Prostitution und Syphilis
- II Prostitution und die neuen reformatorischen Moralvorstellungen
- III Prostitution als Kriminaltat
- E Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Marginalisierung und Kriminalisierung der Prostituierten vom späten Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit. Dabei werden nicht nur die Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung der Prostitution thematisiert, sondern auch die Maßnahmen gegen sie. Die zentrale These ist, dass Prostituierte im späten Mittelalter zwar verachtet wurden, aber trotzdem integriert waren. Im Gegensatz dazu wurden sie in der Frühen Neuzeit nicht nur ausgegrenzt, sondern kriminalisiert. Die Arbeit basiert auf der These von Peter Schuster, die die Entwicklung des Moralsystems beschreibt und darauf hinweist, dass Mitteleuropa im 16. Jahrhundert eine Blütezeit der öffentlichen und privaten Moral erlebte, die auf eine Phase des sittlichen Niedergangs im 15. Jahrhundert folgte.
- Wandel der öffentlichen Wahrnehmung der Prostitution vom späten Mittelalter zur Frühen Neuzeit
- Integration und Marginalisierung von Prostituierten in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft
- Gründe für die Änderung der Einstellung zur Prostitution
- Rolle von Moralvorstellungen und Reformation in der Entwicklung der Prostitution
- Entwicklung des Moralsystems in Mitteleuropa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und die zentrale These der Arbeit erläutert. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Prostitution in der Vergangenheit, die von Stadt zu Stadt und zeitlich variierten. Die Einleitung beschreibt auch die historische Entwicklung des Forschungsgegenstandes, von frühen Werken zur Prostitution bis hin zu aktuellen Ansätzen der Genderforschung. Die Arbeit teilt sich anschließend in verschiedene Kapitel ein, die verschiedene Aspekte der gesellschaftlichen Integration und Ausgrenzung der Prostitution beleuchten.
Im zweiten Kapitel werden Indikatoren der gesellschaftlichen Integration der Prostitution im späten Mittelalter dargestellt. Hier werden die Einrichtung von Frauenhäusern, die Anerkennung der Prostitution durch die Kirche und die Obrigkeit sowie die Teilnahme der Prostituierten am gesellschaftlichen Leben untersucht. Im dritten Kapitel werden Indikatoren der gesellschaftlichen Ausgrenzung der Prostituierten in der Frühen Neuzeit dargestellt. Hier werden die ambivalente Stellung zur Prostitution, die räumliche Trennung und die Kleiderordnung beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Gründe und Folgen der Änderung der Einstellung zur Prostitution. Hier werden die Rolle von Syphilis, die neuen reformatorischen Moralvorstellungen und die Kriminalisierung der Prostitution untersucht. Die Arbeit endet mit einem Schluss, der die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und die Bedeutung des Themas für die heutige Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themen der Prostitutionsgeschichte in der Frühen Neuzeit. Wichtige Schlüsselwörter sind: Marginalisierung, Kriminalisierung, Prostitution, Dirne, Hure, Frauenhäuser, Reformation, Moralvorstellungen, Geschlechterverhältnisse, Integration, Ausgrenzung, Syphilis, gesellschaftliche Wahrnehmung, städtische Organisation, öffentliche Ordnung, gesellschaftliche Funktion.
- Arbeit zitieren
- Katarina Bezakova (Autor:in), 2005, Prostitution in der Frühen Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46200