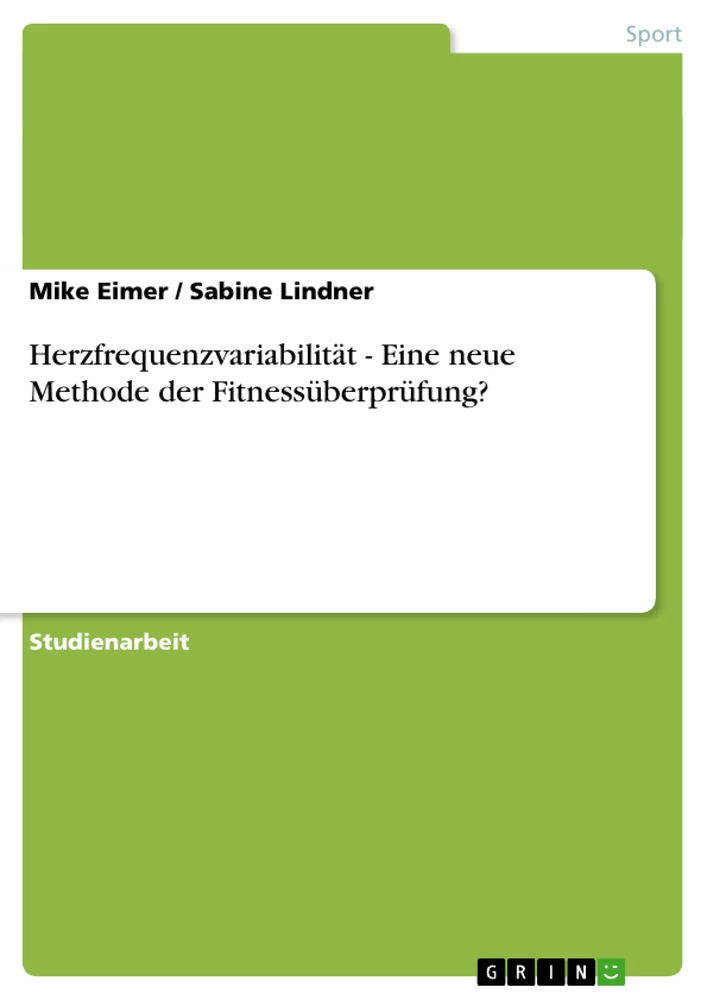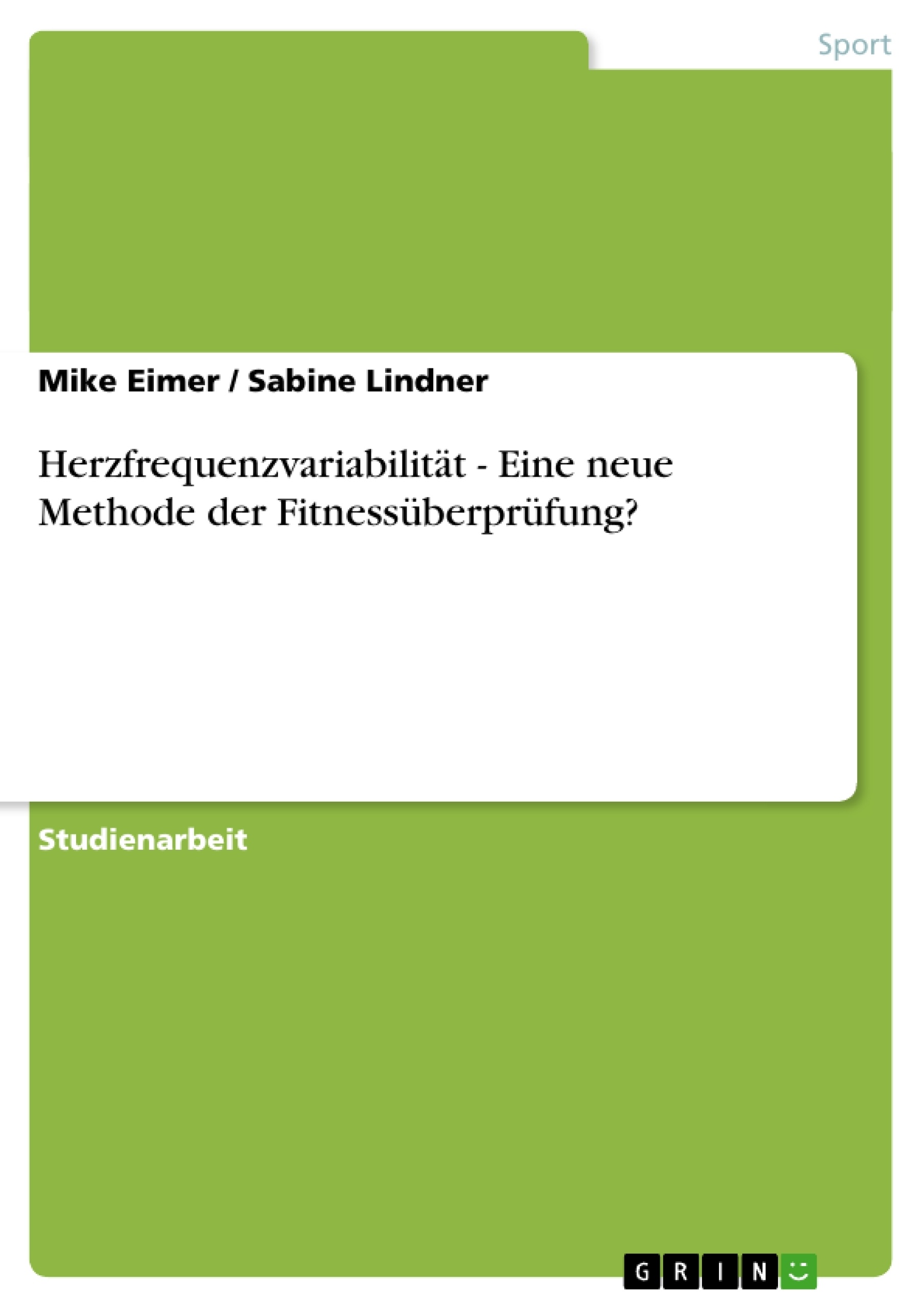Wissenschaftliche Studien zum körperlichen Aktivitätsverhalten ergaben, dass sportlich aktive Menschen ein geringeres Herzinfarktrisiko aufweisen, für Stress weniger anfällig sind als Inaktive, wenig Aktive. Allerdings kommt es bei zu hoher, intensiver sportlicher Aktivität zur Schwächung des Immunsystems, zum Leistungsrückgang. Somit ist die richtige Bewegungsdosierung, die Steuerung der Belastungsintensität für jeden Sportler, egal ob Leistungs-, Fitness- oder Gesundheitssportler, von großer Bedeutung. Eine Abstimmung der Trainingsbelastung auf die individuelle Leistungsfähigkeit, den aktuellen Trainingszustand, die Tagesform ist unabdingbar. Sie stellt den Schlüssel zum Erfolg dar.
Die bei Leistungssportlern angewandte Leistungsdiagnostik zur Bestimmung der Herzfrequenz, Lactatkonzentration, Sauerstoffaufnahme ist sehr aufwendig in ihrer Durchführung und kostspielig; somit kann sie im Trainingsjahr nicht oft durchgeführt werden. Für den Freizeitsportler ist sie unter normalen Umständen nicht nutzbar. Somit braucht man einfache (nicht- invasive) Testverfahren, die von allen sportlich Aktiven genutzt werden können, kurzfristige Veränderungen des Leistungszustandes erfassen, den täglichen Leistungszustand bewerten und daraus Empfehlungen für das Training geben. Ein solches Verfahren stellt die Kontrolle der Herzfrequenz dar. Trainier und Athleten nutzen regelmäßige Kontrollen der Ruheherzfrequenz, „um aktuelle Zustandsänderungen des Organismus auf Trainingsbelastungen, veränderte Trainingsbedingungen (Klimafaktoren, Höhenexposition) und mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen (beginnender Infekt, Flüssigkeitsdefizit) frühzeitig zu erfassen.“ (BERBALK, 1999, S.1) Eine weitere, viel versprechende Möglichkeit der Leistungsdiagnostik bietet die Herzfrequenzvariabilität. Die in der klinischen Medizin schon seit langem genutzte Messgröße hat in den letzten Jahren auch Einzug in der Sportmedizin, Arbeitsmedizin und Trainingswissenschaft gehalten. Allerdings sind der Begriff und die diagnostische Wertigkeit der Herzfrequenzvariabilität nicht allgemein bekannt und es sind in den kommenden Jahren noch viele Fragen dazu zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Physiologische Grundlagen der Herzfrequenzvariabilität
- Die Herzfrequenz
- Die Herzfrequenzvariabilität
- Modulatoren der Herzfrequenzvariabilität
- Einflussfaktoren der Herzfrequenzvariabilität
- Methodik
- Erfassung der Herzfrequenzvariabilität
- Parameter der Frequenzanalyse
- Pointcaré Plot/ Streudiagramme
- Diagnostische Parameter der Herzfrequenzvariabilität
- Parameter der Zeitbereichsanalyse
- Untersuchungen bezüglich der Anwendbarkeit der HRV im Sport
- Aussagefähigkeit der HRV-Parameter bei Messungen im Ruhezustand (zwischen 4 und 6 Uhr morgens; liegend oder sitzend)
- Vergleichswerte der HRV bei Ausdauersportlern/Innen
- Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und HRV
- HRV in Abhängigkeit von der Trainings- und Wettkampfbelastung
- HRV in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand und unterschiedlicher psychophysischer Belastung
- Diagnostische Wertigkeit der einzelnen Parameter der Herzfrequenzvariabilität
- Aussagefähigkeit der HRV-Parameter bei Messungen während Belastung
- Aussagefähigkeit der HRV-Parameter bei Messungen im Ruhezustand (zwischen 4 und 6 Uhr morgens; liegend oder sitzend)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) als neue Methode zur Fitnessüberprüfung. Die Arbeit analysiert die physiologischen Grundlagen der HRV und betrachtet die Anwendbarkeit der HRV-Parameter im Sport, sowohl im Ruhezustand als auch während Belastung.
- Die physiologischen Grundlagen der Herzfrequenzvariabilität
- Die Erfassung und Analyse der HRV-Parameter
- Die Aussagekraft der HRV-Parameter bei Messungen im Ruhezustand
- Die Aussagekraft der HRV-Parameter bei Messungen während Belastung
- Die diagnostische Wertigkeit der einzelnen Parameter der Herzfrequenzvariabilität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Herzfrequenzvariabilität für die Sportmedizin und die Trainingswissenschaft dar. Kapitel 2 erläutert die physiologischen Grundlagen der Herzfrequenzvariabilität, einschließlich der Herzfrequenz, der Modulatoren und der Einflussfaktoren. Kapitel 3 beschreibt die Methodik zur Erfassung und Analyse der HRV. In Kapitel 4 werden Untersuchungen zur Anwendbarkeit der HRV im Sport zusammengefasst, wobei sowohl Messungen im Ruhezustand als auch während Belastung betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Herzfrequenzvariabilität, HRV, Fitnessüberprüfung, Sportmedizin, Trainingswissenschaft, Ruhezustand, Belastung, Parameter, Diagnostik, Gesundheitszustand.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Herzfrequenzvariabilität (HRV)?
Die HRV beschreibt die natürliche Variation der Zeitabstände zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen und gilt als Indikator für die Anpassungsfähigkeit des Organismus.
Wie kann die HRV zur Steuerung der Trainingsintensität genutzt werden?
Durch regelmäßige Messungen (z.B. morgens im Ruhezustand) lässt sich der aktuelle Erholungsstatus feststellen und das Training individuell anpassen.
Warum ist die HRV für Freizeitsportler vorteilhaft?
Sie bietet eine kostengünstige und nicht-invasive Alternative zu aufwendigen Labortests wie Laktatmessungen oder Sauerstoffaufnahme-Analysen.
Welche Faktoren beeinflussen die HRV-Werte?
Neben sportlicher Belastung wirken sich auch Stress, Schlafqualität, Klima und beginnende Infekte auf die Variabilität aus.
Was ist ein Poincaré Plot in der HRV-Analyse?
Es handelt sich um ein grafisches Streudiagramm, das die zeitliche Abfolge der Herzschläge visualisiert und Rückschlüsse auf die autonome Regulation erlaubt.
- Quote paper
- Mike Eimer (Author), Sabine Lindner (Author), 2004, Herzfrequenzvariabilität - Eine neue Methode der Fitnessüberprüfung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46222