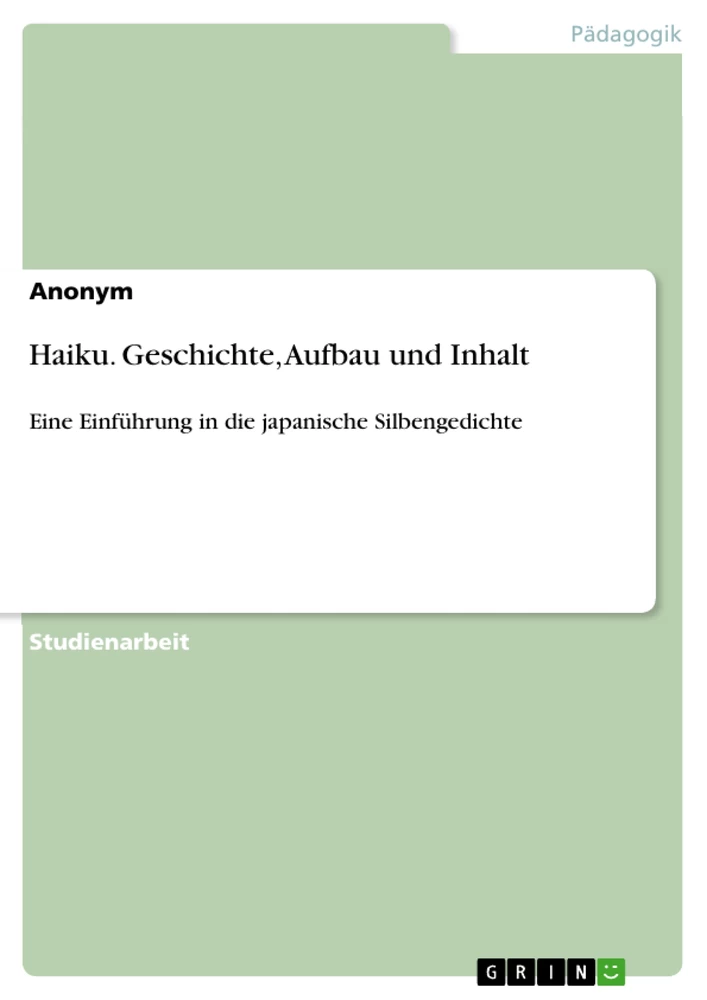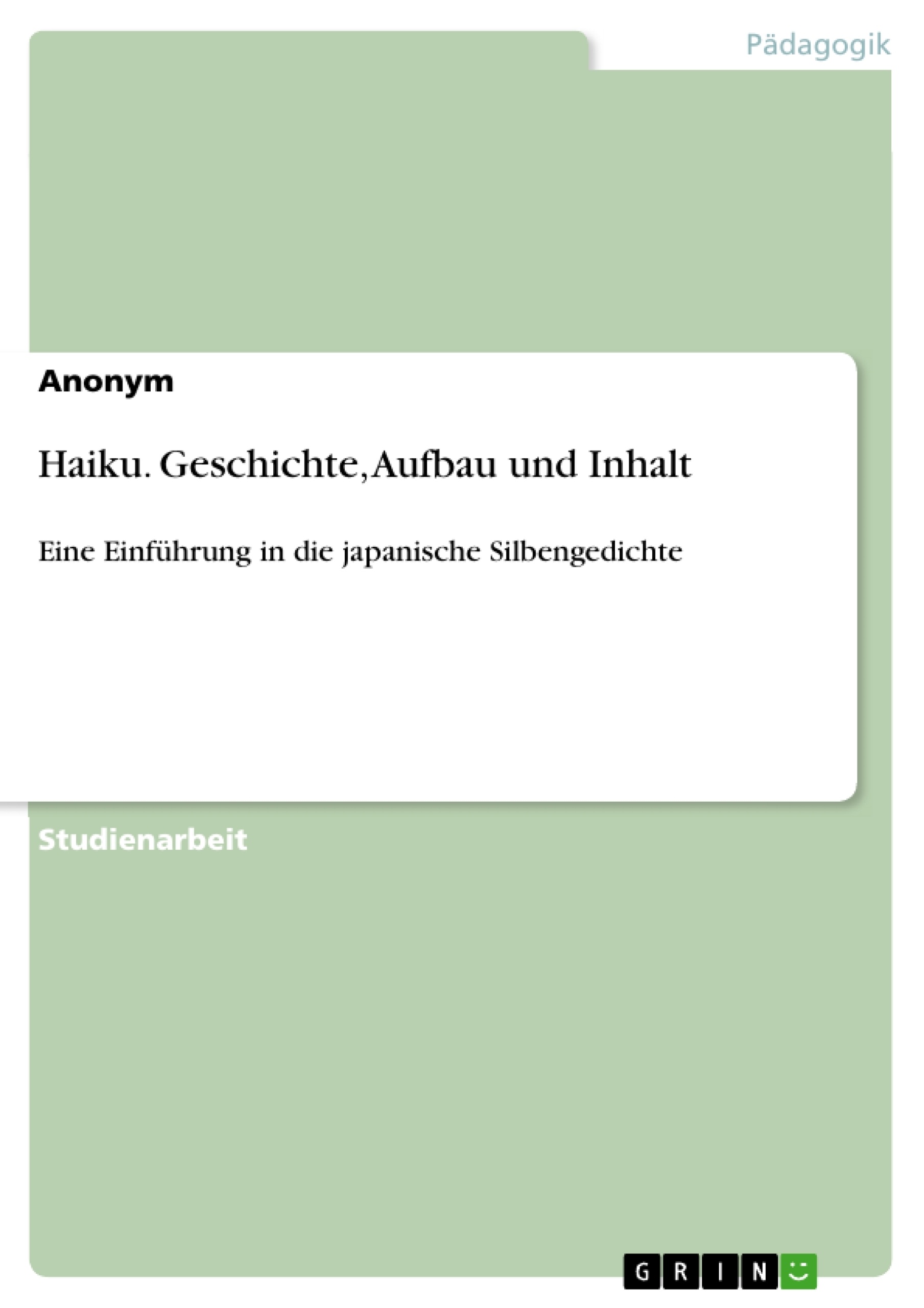Im Deutschunterricht sind Haikus ein beliebtes Mittel um in das Thema „Lyrik“ einzuführen und lyrisches Schreiben zu üben. Doch nicht jedes Silbengedicht ist automatisch ein Haiku. Ziel der vorliegenden Hausarbeit ist es, näher in die lyrische Gattung Haiku einzuführen.
Zunächst möchte ich die Geschichte des Haiku und seine Entwicklung skizzieren. Im Zuge dessen werde ich mich mit dem Vorgänger des Haiku, dem Renga näher auseinandersetzen und darauffolgend auf den sogenannten Großmeister und Begründer der heutigen Haiku-Dichtung Matsuo Basho eingehen.
Anschließend daran beschäftige ich mich mit dem Aufbau des Haiku, indem ich zunächst genauer auf die japanische Schrift und danach auf den stilistischen Aufbau und die inhaltlichen Aspekte des Haiku eingehe.
Abschließend möchte ich zwei weitere japanische Silbengedichte vorstellen, die durch ihre Ähnlichkeit zu dem Haiku oftmals unwissentlich damit verwechselt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Geschichte des Haiku
- 2.1 Renga und die Entstehung des Haiku
- 2.2 Die Blütezeit der Haiku in der Edo-Periode
- 2.2.1 Matsuo Basho- Der Großmeister des Haiku
- 2.3 Haiku Heute
- 3 Der Aufbau des Haiku
- 3.1 Die Japanische Schrift
- 3.2 Der Stilistische Aufbau und Inhalt des Haiku
- 4 Weitere Japanischen Silbengedichte
- 4.1.1 Tanka
- 4.1.2 Senryu
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, die lyrische Gattung Haiku umfassend einzuführen. Sie beleuchtet die Geschichte des Haiku, seine Entwicklung aus dem Renga, und die Bedeutung von Matsuo Basho. Der Aufbau des Haiku, inklusive der japanischen Schrift und stilistischer Aspekte, wird ebenso behandelt. Abschließend werden verwandte japanische Gedichtformen vorgestellt, um Verwechslungen vorzubeugen.
- Die historische Entwicklung des Haiku
- Der Einfluss des Renga auf die Entstehung des Haiku
- Der Aufbau und die stilistischen Merkmale des Haiku
- Matsuo Basho und seine Bedeutung für die Haiku-Dichtung
- Verwandte japanische Gedichtformen und ihre Unterscheidung vom Haiku
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Haiku ein und benennt das Ziel der Arbeit: eine umfassende Einführung in die lyrische Gattung Haiku. Es wird der gängige Einsatz von Haikus im Deutschunterricht erwähnt und die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung dieser Gedichtform hervorgehoben. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, der die historische Entwicklung, den Aufbau und verwandte Gedichtformen umfasst.
2 Die Geschichte des Haiku: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Haiku. Es widerlegt die Annahme, Haiku seien die ursprünglichste Form japanischer Dichtung, und positioniert sie als relativ junge Gattung. Im Zentrum steht die Entwicklung aus dem Renga, einer Partnerdichtungsform. Der Beitrag Matsuo Bashos zur Entwicklung des modernen Haiku wird als zentraler Punkt hervorgehoben.
2.1 Renga und die Entstehung des Haiku: Dieses Unterkapitel beschreibt detailliert die Entwicklung des Haiku aus dem Renga, einer traditionellen japanischen Partnerdichtung. Es erläutert die Struktur des Renga mit seinen Erst- und Zweitversen und wie sich aus dem "Hokku" (dem ersten Vers des Renga) die eigenständige Form des Haiku entwickelte. Es wird die Entwicklung vom eher lyrischen Renga hin zu einer volkstümlicheren Form, dem Haikai, beschrieben, die durch scherzhafte und verspielte Themen geprägt war. Die zunehmende Eigenständigkeit des Hokku als Kurzgedicht wird als entscheidender Schritt in der Entstehung des Haiku hervorgehoben.
2.2 Die Blütezeit der Haiku in der Edo-Periode: Dieses Unterkapitel beleuchtet die Blütezeit des Haiku während der Edo-Periode (1603-1867) in Japan. Der historische Kontext des Bürgerkriegs und der anschließenden Tokugawa-Herrschaft wird kurz skizziert. Der Einfluss dieser politischen und sozialen Veränderungen auf die Entwicklung und Verbreitung des Haiku wird angedeutet, ohne jedoch detailliert darauf einzugehen. Der Abschnitt erwähnt Matsuo Basho als zentralen Akteur dieser Blütezeit, ohne seine Rolle jedoch detailliert zu beschreiben (dies geschieht wahrscheinlich in einem späteren Unterkapitel).
3 Der Aufbau des Haiku: Dieses Kapitel widmet sich dem Aufbau des Haiku, wobei sowohl die japanische Schrift als auch der stilistische Aufbau und der Inhalt des Haiku betrachtet werden. Es liefert detaillierte Informationen über die Struktur, die Silbenzählung und die typischen Merkmale, die ein Haiku ausmachen. Die Bedeutung der Sprache und der Bildhaftigkeit wird herausgearbeitet und vermutlich werden konkrete Beispiele zur Illustration verwendet.
4 Weitere Japanischen Silbengedichte: Dieses Kapitel stellt zwei weitere japanische Silbengedichte vor, die aufgrund ihrer Ähnlichkeiten oft mit dem Haiku verwechselt werden. Es handelt sich wahrscheinlich um eine differenzierte Betrachtung dieser verwandten Formen, um die eindeutige Identifizierung von Haikus zu gewährleisten. Der Fokus liegt vermutlich auf den Unterscheidungsmerkmalen zu den Haikus.
Schlüsselwörter
Haiku, Renga, Matsuo Basho, japanische Lyrik, Silbengedicht, Edo-Periode, Hokku, Tanka, Senryu, Stilistik, Aufbau, Geschichte der japanischen Literatur.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: "Eine umfassende Einführung in die Lyrikform Haiku"
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet eine umfassende Einführung in die japanische Gedichtform Haiku. Sie behandelt die Geschichte des Haiku, seine Entwicklung aus dem Renga, den Aufbau und stilistische Merkmale, die Bedeutung von Matsuo Basho und verwandte Gedichtformen wie Tanka und Senryu. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Lyrikform Haiku zu vermitteln und Verwechslungen mit ähnlichen Gedichtformen zu vermeiden.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: die historische Entwicklung des Haiku, den Einfluss des Renga auf seine Entstehung, den Aufbau und die stilistischen Merkmale, Matsuo Basho und seine Bedeutung, sowie verwandte japanische Gedichtformen (Tanka und Senryu) und deren Unterscheidung vom Haiku. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel, sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschichte des Haiku (einschließlich der Entwicklung aus dem Renga und der Bedeutung von Matsuo Basho), ein Kapitel zum Aufbau des Haiku (inklusive der japanischen Schrift und stilistischer Aspekte), ein Kapitel über verwandte japanische Gedichtformen (Tanka und Senryu) und ein Fazit. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet und in der Zusammenfassung der Kapitel einzeln beschrieben.
Welche Rolle spielt Matsuo Basho in der Hausarbeit?
Matsuo Basho wird als zentrale Figur in der Entwicklung und Blütezeit des Haiku hervorgehoben. Seine Bedeutung für die moderne Haiku-Dichtung wird ausführlich behandelt, obwohl die detaillierte Beschreibung seiner Rolle wahrscheinlich in einem der Unterkapitel zum Thema Geschichte des Haiku erfolgt.
Wie werden verwandte japanische Gedichtformen behandelt?
Die Arbeit stellt neben dem Haiku auch die Gedichtformen Tanka und Senryu vor. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung dieser Formen vom Haiku, um Verwechslungen vorzubeugen und ein klares Verständnis der jeweiligen Merkmale zu ermöglichen.
Was ist der Zweck des Kapitels über den Aufbau des Haiku?
Das Kapitel über den Aufbau des Haiku beschreibt detailliert die Struktur, die Silbenzählung und die typischen Merkmale von Haikus. Es beleuchtet die Bedeutung der Sprache und der Bildhaftigkeit und verwendet wahrscheinlich konkrete Beispiele zur Illustration.
Worum geht es im Kapitel über die Geschichte des Haiku?
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Haiku, widerlegt die Annahme, es sei die ursprünglichste Form japanischer Dichtung und positioniert es als relativ junge Gattung. Die Entwicklung aus dem Renga, einer Partnerdichtungsform, wird detailliert erläutert, ebenso wie die Bedeutung von Matsuo Basho.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Haiku, Renga, Matsuo Basho, japanische Lyrik, Silbengedicht, Edo-Periode, Hokku, Tanka, Senryu, Stilistik, Aufbau, Geschichte der japanischen Literatur.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit ist für alle gedacht, die sich umfassend mit der japanischen Gedichtform Haiku auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich insbesondere für den akademischen Kontext und dient dem Verständnis der historischen Entwicklung, des Aufbaus und der stilistischen Merkmale dieser Gedichtform.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Haiku. Geschichte, Aufbau und Inhalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462344