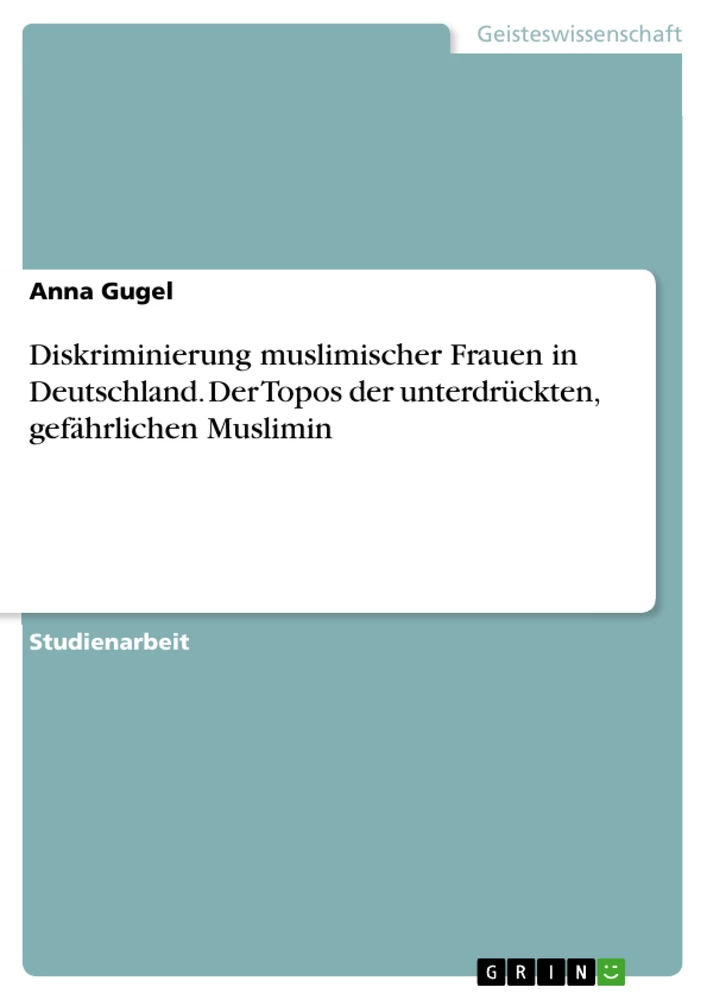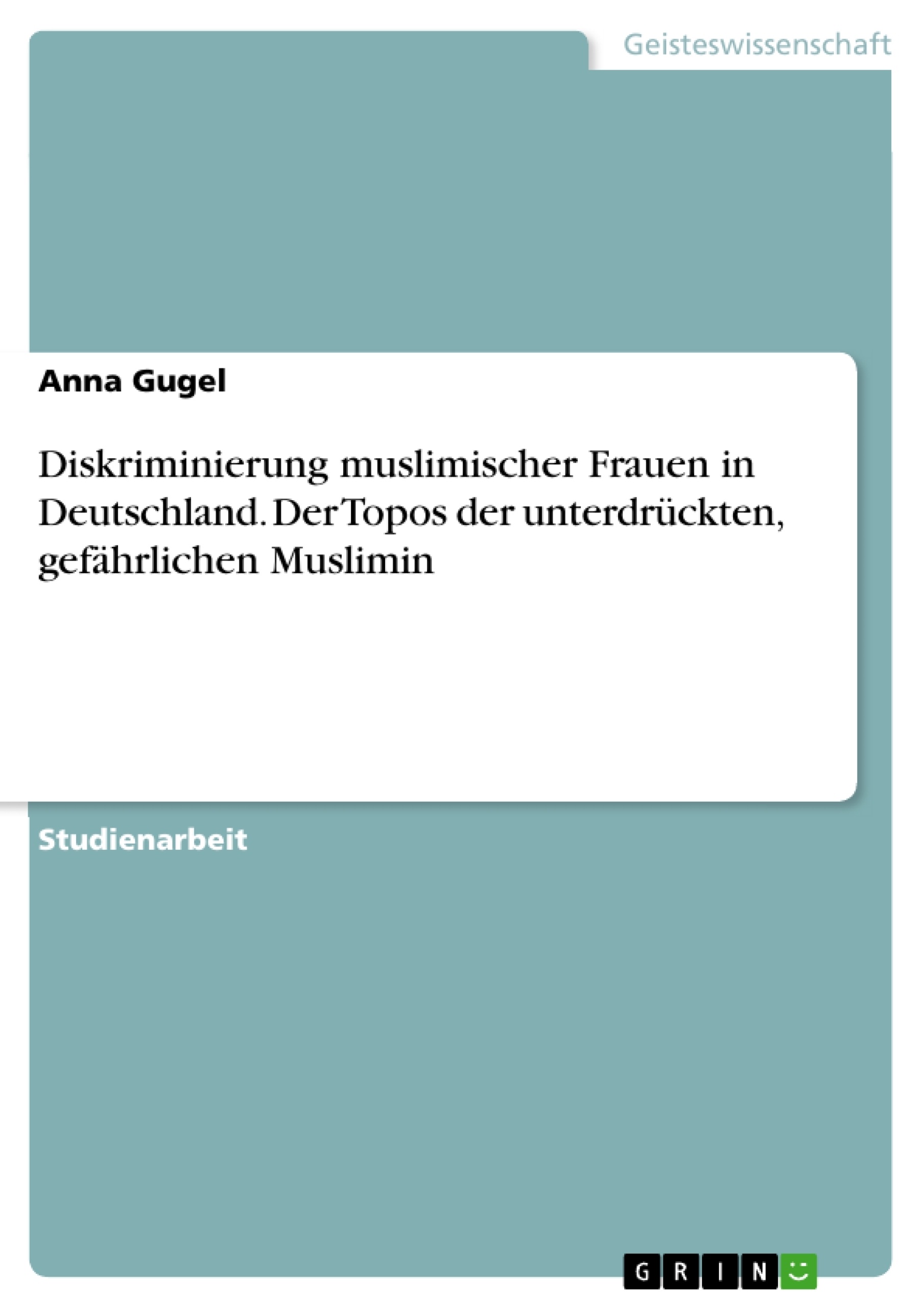Die Arbeit setzt sich mit der gesellschaftlichen Situation muslimischer Frauen in Deutschland auseinander. Welcher Mehrfachdiskriminierung sind Musliminnen in Deutschland ausgesetzt?
Das mediale Bild der Muslimin oszilliert zwischen der Rolle der unterdrückten und verschleierten Muslimin und der muslimischen Fundamentalistin, die Frauenrechte unterwandern will. Die von Fereshta Ludins 1998 losgetretene Kopftuchdebatte bietet ein Paradebeispiel der konträren Vorurteile und Diskriminierungen, denen muslimische Frauen in Deutschland ausgesetzt sind.
Laut dem Spiegel wurde sie nicht nur durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft abgelehnt und sogar rassistisch angegriffen, auch die muslimische Welt kritisierte ihr Vorgehen genauso wie einige Frauenbewegungen. Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer, die das Kopftuch schon immer als politisches Symbol ablehnte, ist der Ansicht, dass Ludin durch ihre islamistische Ideologie eine Gefahr für Deutschland darstelle, weil sie die Grundgesetze nicht respektieren würde. Sie stellt damit Kopftuchträgerinnen per se unter Extremismusverdacht und verhärtet gängige Zuschreibungen. Die in diesen Debatten entworfenen Zuschreibungen und Vorurteile über Musliminnen haben konkrete Auswirkungen auf die gesellschaftliche Situation muslimischer Frauen in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Begriffserklärungen
- Stereotyp
- Soziale Kategorisierung
- Vorurteile
- Diskriminierung
- Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber muslimischen Frauen
- Theorie der Intersektionalität
- Rassismus
- Topos der „unterdrückten, gefährlichen Muslimin“
- Geschlecht als Querschnittskategorie von Diskriminierung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Vorurteile und Diskriminierungen, denen muslimische Frauen in Deutschland ausgesetzt sind. Im Fokus steht die Frage, ob mehrdimensionale Diskriminierungen vorliegen und wie sich diese im Kontext der Theorie der Intersektionalität beschreiben lassen.
- Analyse der Stereotypisierung und Vorurteilsbildung gegenüber muslimischen Frauen in Deutschland
- Anwendung der Theorie der Intersektionalität auf die Situation muslimischer Frauen
- Begutachtung des „Topos der unterdrückten, gefährlichen Muslimin“ als Ausdruck von Mehrfachdiskriminierung
- Untersuchung der Auswirkungen von Vorurteilen und Diskriminierungen auf die Lebensbedingungen muslimischer Frauen
- Bedeutung von Antidiskriminierungsmaßnahmen und der Förderung von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Begriffe Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung aus sozialpsychologischer Perspektive. Anschließend wird die Theorie der Intersektionalität vorgestellt, die die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen beleuchtet. Kapitel 3 fokussiert auf die Benachteiligungen muslimischer Frauen in Deutschland, wobei insbesondere der anti-muslimische Rassismus und der „Topos der unterdrückten, gefährlichen Muslimin“ im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Stereotypisierung, Vorurteile, Diskriminierung, Intersektionalität, Mehrfachdiskriminierung, muslimische Frauen, Anti-muslimischer Rassismus, Topos, Benachteiligung, Inklusion, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Vorurteilen begegnen muslimische Frauen in Deutschland?
Muslimische Frauen werden oft zwischen den Stereotypen der „unterdrückten, verschleierten Frau“ und der „gefährlichen Fundamentalistin“ wahrgenommen, was zu Mehrfachdiskriminierungen führt.
Was bedeutet Intersektionalität im Kontext dieser Arbeit?
Die Theorie der Intersektionalität beschreibt die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen, wie Geschlecht, Religion und Herkunft.
Was war die Bedeutung der Kopftuchdebatte um Fereshta Ludin?
Die Debatte von 1998 dient als Paradebeispiel für konträre Vorurteile, bei denen das Kopftuch oft pauschal als politisches Symbol oder Zeichen von Extremismus gewertet wurde.
Wie wirkt sich anti-muslimischer Rassismus aus?
Er führt zu konkreten Benachteiligungen in der gesellschaftlichen Situation und beeinträchtigt die Lebensbedingungen muslimischer Frauen in Deutschland massiv.
Werden in der Arbeit Lösungsvorschläge diskutiert?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Antidiskriminierungsmaßnahmen und der Förderung von Inklusion, um Vorurteile abzubauen.
- Quote paper
- Anna Gugel (Author), 2018, Diskriminierung muslimischer Frauen in Deutschland. Der Topos der unterdrückten, gefährlichen Muslimin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462466