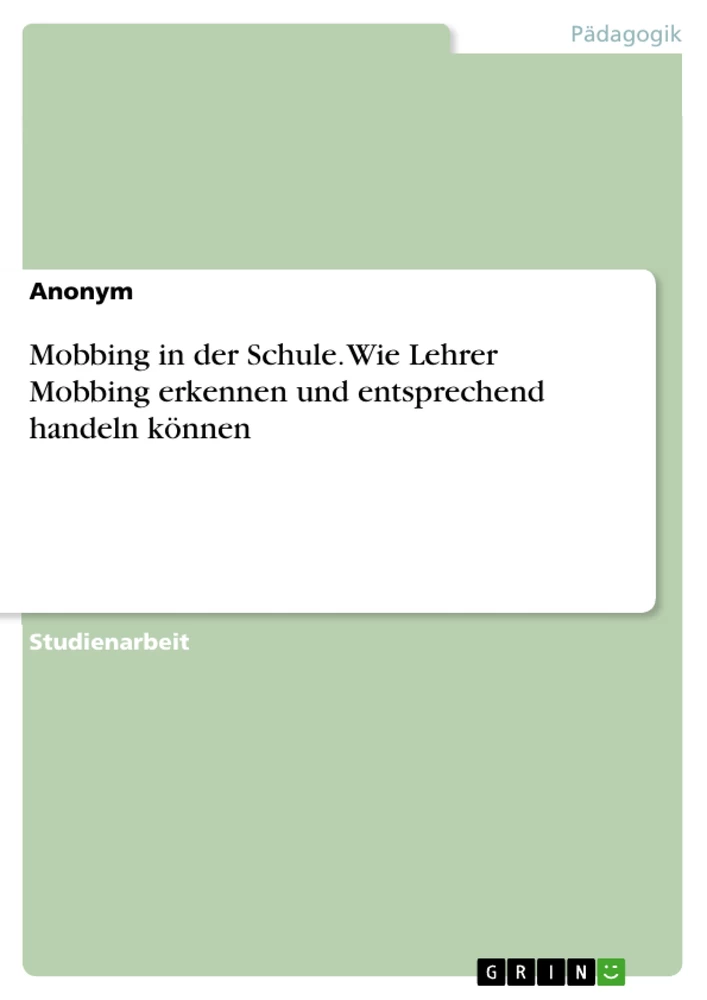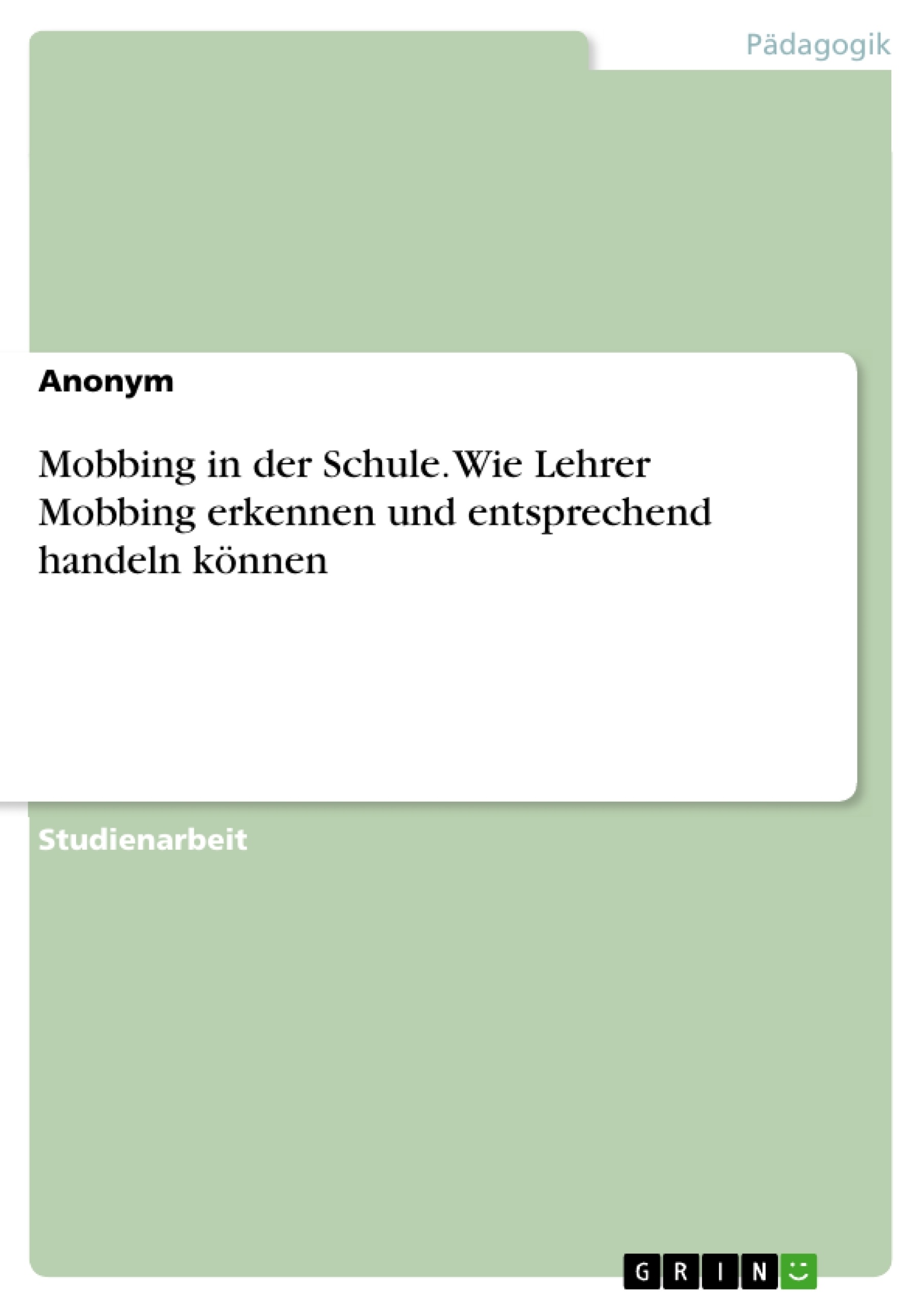Diese Arbeit soll dazu dienen, einen groben Einblick in das Thema Mobbing zu erhalten. Die vorliegende Arbeit mit dem Titel: „Mobbing im schulischen Kontext. Ursachen, Folgen und Handlungsmöglichkeiten“ beschäftigt sich außerdem mit der Frage, ob und inwieweit Lehrer Mobbing erkennen und auch dementsprechend handeln können.
Aufgrund der Gefahren, die von jeglicher Form der Gewalt ausgeht, ist es essentiell, dass Pädagogen nicht nur entgegenwirken, sondern sich auch empathisch in ihre Schüler hineinversetzen können, um etwaige Problematiken zu erkennen. Grundsätzlich ist das Gespräch zwischen Lehrern und Schülern wichtig, aber auch, dass Lehrer die Risiken und Konsequenzen der Gewalt aufzeigen, sodass sich die Schüler kritisch mit der Thematik auseinandersetzen können.
Zunächst werden die Begriffe Gewalt und Mobbing trennscharf dargestellt und typische Aspekte von Mobbing in der Schule zusammengestellt. Des Weiteren wird Mobbing in seinen unterschiedlichen Formen vorgestellt sowie deren Ursachen und Folgen. Davon leitet sich die Frage ab, welche Faktoren Mobbing begünstigen und welche Rollen von den einzelnen Akteuren übernommen werden. Auf Grundlage der Beschreibung dieser Mechanismen des Mobbings werden Präventions- und Interventionsmöglichkeiten abgeleitet und im Fazit wird abschließend nochmal die wichtigsten Faktoren zusammengefasst und ein Ausblick hinsichtlich der Prävention- und Interventionsmaßnahmen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Definition und Arten von Gewalt
- 3. Eine Art der Gewalt: Mobbing
- 3.1. Arten von Mobbing
- 3.2. Ursachen von Mobbing
- 3.3. Folgen von Mobbing
- 3.4. Folgen für das Opfer und den Täter
- 4. Präventionsmaßnahmen
- 4.1. Interventionsmaßnahmen
- 4.2. Alternative Maßnahmen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Mobbing im schulischen Kontext und zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in dessen Ursachen, Folgen und Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Insbesondere wird die Rolle der Lehrer bei der Erkennung und Bewältigung von Mobbing untersucht.
- Definition und verschiedene Formen von Gewalt
- Mobbing als spezifische Form der Gewalt
- Ursachen und Folgen von Mobbing
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Die Rolle von Lehrern bei der Erkennung und Bewältigung von Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Aktualität und Relevanz des Themas Mobbing dar, indem sie auf aktuelle Studien und Statistiken verweist, die die Häufigkeit von Gewalt und Abwertung in Schulen aufzeigen. Dabei wird die Bedeutung von Lehrerintervention und empathischem Verständnis für Schülerproblematiken hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Gewalt und deren verschiedenen Formen. Es wird deutlich, dass Gewalt ein breites Spektrum umfasst, von physischer bis hin zu psychischer Gewalt, die wiederum in verschiedene Unterformen wie verbale, nonverbale und indirekte Gewalt unterteilt werden kann. Die zunehmende Digitalisierung führt zu neuen Formen der psychischen Gewalt, wie Cybermobbing, Happy-Slapping und Handy-Slapping.
Kapitel drei beleuchtet Mobbing als eine spezifische Form von Gewalt. Es wird der Ursprung des Begriffs "Mobbing" erläutert und auf die Definition nach Dan Olweus und Alsaker Bezug genommen. Mobbing wird als systematisches, aggressives Verhalten einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen gegenüber einem bestimmten Kind oder Jugendlichen beschrieben, das sich gegen die negativen Handlungen nur schlecht oder gar nicht wehren kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte der Arbeit sind Mobbing, Gewalt, Schule, Prävention, Intervention, Schüler, Lehrer, psychische Gewalt, physische Gewalt, Cybermobbing, Happy-Slapping, Handy-Slapping, Unterlassene Hilfeleistung, systematische Verwahrlosung, Sozialbeziehungen, Empathie, Risiken und Konsequenzen von Gewalt, Kritikfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing in der Schule definiert?
Mobbing ist ein systematisches, über einen längeren Zeitraum anhaltendes aggressives Verhalten, bei dem ein Schüler oder eine Schülerin von einer Gruppe körperlich oder psychisch schikaniert wird und sich nicht wirksam wehren kann.
Welche Formen von Mobbing gibt es im schulischen Kontext?
Man unterscheidet physische Gewalt, verbale Attacken (Beleidigen), nonverbale Schikanen (Ausgrenzen) sowie zunehmend Cybermobbing über digitale Medien.
Was sind die Warnsignale für Lehrer, um Mobbing zu erkennen?
Warnsignale sind plötzlicher Leistungsabfall, Rückzug aus der Klassengemeinschaft, häufiges Fehlen, beschädigte Schulsachen oder psychosomatische Beschwerden beim betroffenen Schüler.
Welche Folgen hat Mobbing für die Opfer?
Die Folgen reichen von Angstzuständen und Depressionen bis hin zu langanhaltenden Traumatisierungen und im Extremfall Suizidgedanken.
Welche Präventionsmaßnahmen können Schulen ergreifen?
Wichtig sind die Förderung der Empathie, klare Regeln gegen Gewalt, regelmäßige Klassengespräche und die Etablierung einer Vertrauenskultur zwischen Lehrern und Schülern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Mobbing in der Schule. Wie Lehrer Mobbing erkennen und entsprechend handeln können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462614