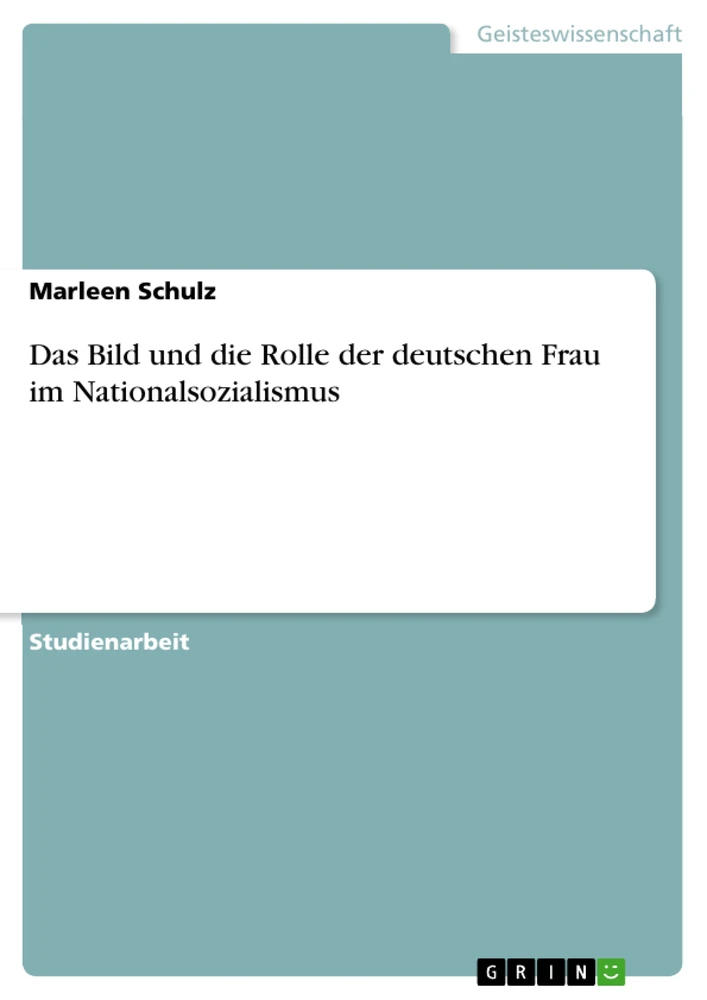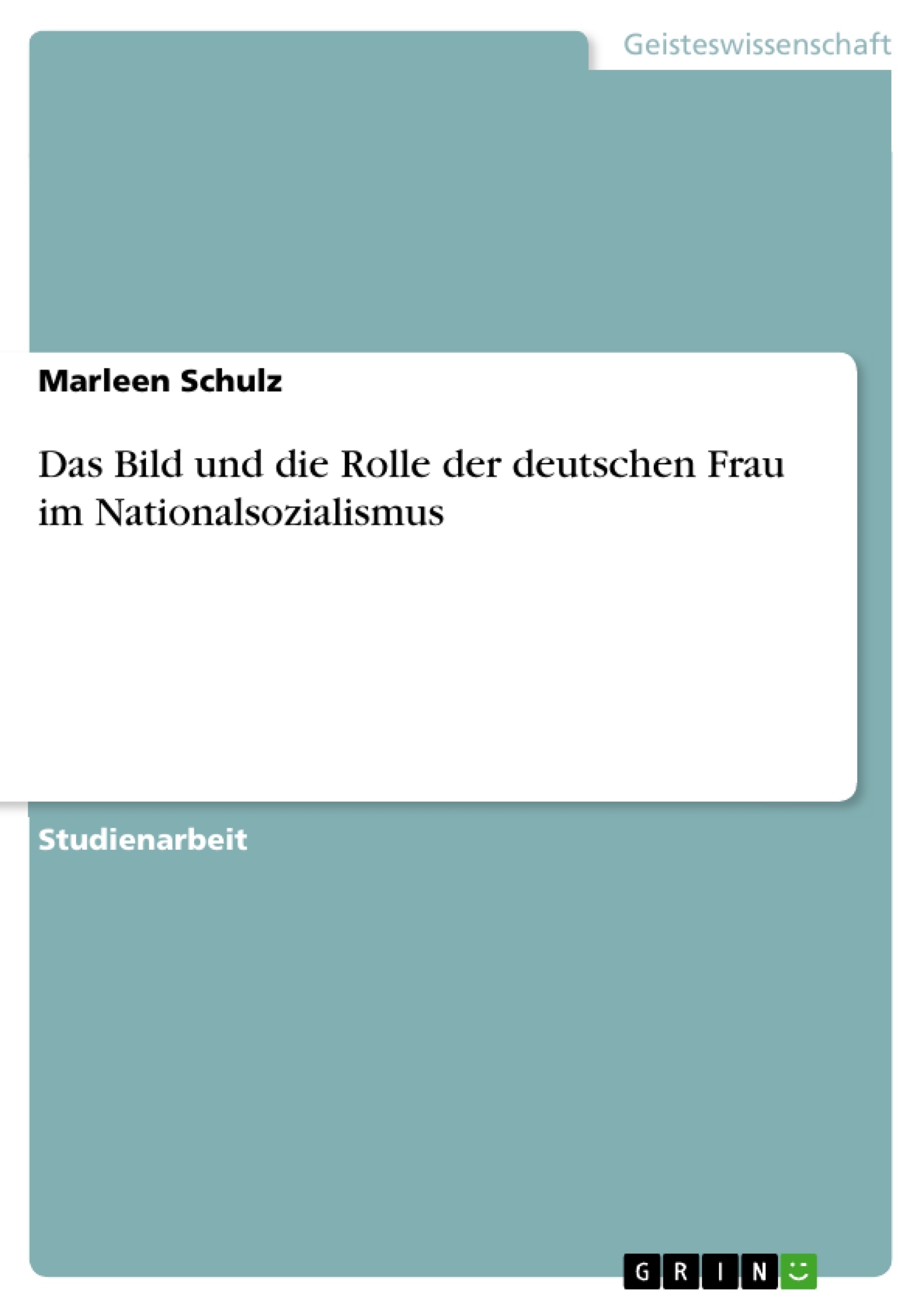Welches Bild und welche Rolle hatte die deutsche Frau im Nationalsozialismus?
Um dieser Frage nachzugehen, wird zunächst das Bild der Frau vor der Machtergreifung 1933 beleuchtet. Während des Nationalsozialismus stand die Frau vor allem im Kontext der Familienförderung und des Mutter-seins, jedoch ging sie paradoxerweise auch häufig einer Erwerbstätigkeit nach. Um diese Widersprüche in einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte aufzuzeigen und zu hinterfragen, wird zunächst eine historischer Überblick gegeben und anschließend die Frauenrolle unter verschiedenen Aspekten analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frau vor 1933
- Die Frau im Nationalsozialismus
- Frauenbild
- Familienförderung und Ehrung der Mutterrolle
- Frauen und Erwerbstätigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Frau im Nationalsozialismus, indem sie die vom Regime propagierte Ideologie mit der tatsächlichen Lebensrealität der Frauen kontrastiert. Der Fokus liegt dabei auf der Ambivalenz zwischen dem Ideal der Frau als Mutter und Hausfrau und den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit.
- Das Frauenbild im Nationalsozialismus: Vergleich zwischen Ideologie und Realität
- Die Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft im Nationalsozialismus
- Ambivalenzen in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Frauen
- Der Einfluss der NS-Ideologie auf die Stellung der Frau
- Die Kontinuität und die Veränderungen des Frauenbildes im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Stellung der Frau in Deutschland vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus, mit Fokus auf die bürgerliche Frauenbewegung und die Errungenschaften der Weimarer Republik.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Frauenbild im Nationalsozialismus und zeigt die Diskrepanz zwischen dem propagierten Ideal der Frau als Mutter und Hausfrau und der Realität der Frauen in der NS-Gesellschaft auf.
Das dritte Kapitel untersucht die Bereiche der Familienförderung und Mutterschaft im Nationalsozialismus. Dabei werden die Ambivalenzen zwischen der Ideologie und der Realität, die Frauen durchlebten, beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich der Erwerbstätigkeit der Frau im Nationalsozialismus und stellt die Herausforderungen und Ambivalenzen dar, denen Frauen im Arbeitsleben begegneten.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Frauenbild, Familienpolitik, Erwerbstätigkeit, Nationalsozialismus, Ideologie und Realität, Ambivalenzen, Emanzipation und bürgerliche Frauenbewegung.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild herrschte im Nationalsozialismus vor?
Das NS-Regime propagierte das Ideal der Frau als Mutter und Hausfrau, die primär für die Familienförderung zuständig war.
Gab es Widersprüche zwischen Ideologie und Realität der Frauenrolle?
Ja, trotz der Idealisierung der Mutterrolle gingen während des Nationalsozialismus viele Frauen aufgrund wirtschaftlicher Notwendigkeiten einer Erwerbstätigkeit nach.
Wie wurden Mütter im NS-Staat geehrt?
Die Mutterrolle wurde durch staatliche Maßnahmen der Familienförderung und symbolische Ehrungen ideologisch überhöht.
Wie veränderte sich die Rolle der Frau nach der Weimarer Republik?
Während die Weimarer Republik Fortschritte in der bürgerlichen Frauenbewegung brachte, versuchte der Nationalsozialismus, diese Emanzipation zugunsten eines traditionellen Rollenbildes zurückzudrängen.
Was untersucht die Hausarbeit konkret?
Die Arbeit kontrastiert die NS-Ideologie mit der tatsächlichen Lebensrealität der Frauen unter Berücksichtigung von Familie, Beruf und gesellschaftlichem Einfluss.
- Citar trabajo
- Marleen Schulz (Autor), 2018, Das Bild und die Rolle der deutschen Frau im Nationalsozialismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462623