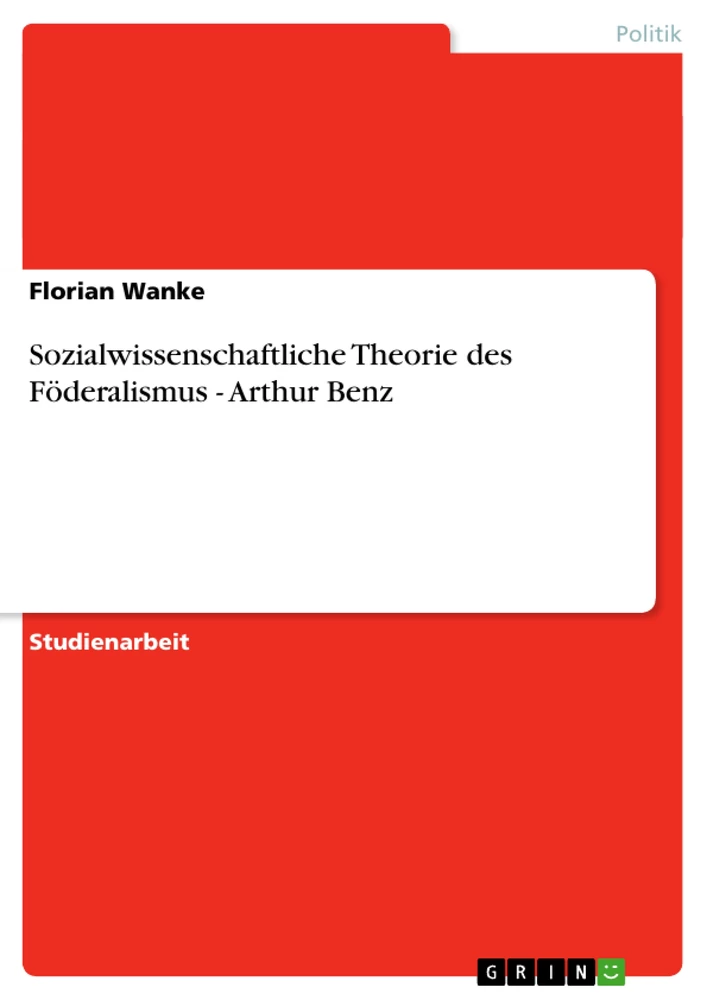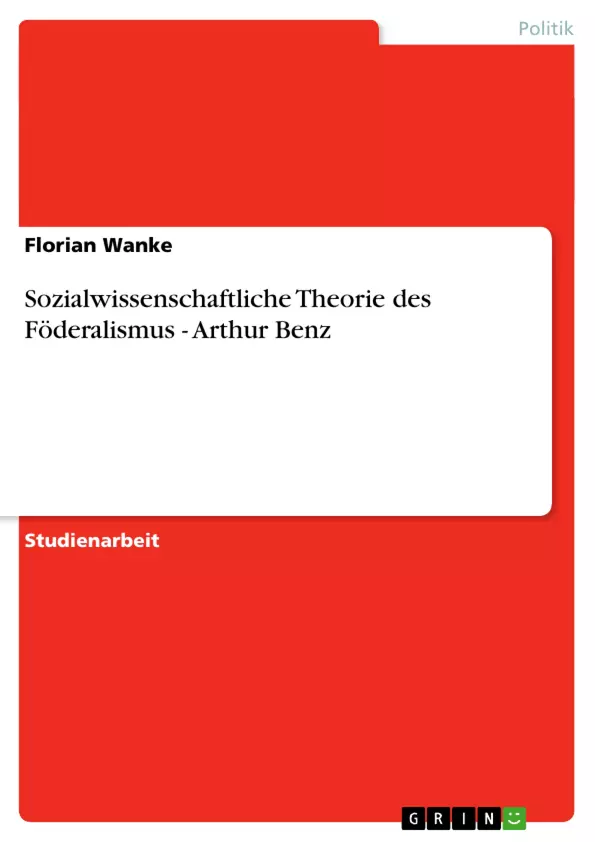In der öffentlichen Diskussion ebenso wie in einem weiten Teil der Wissenschaft wird die spezifische Ausgestaltung des deutschen föderalen Systems für zahlreiche Ineffizienzen und, besonders in den letzten Jahren, einen weitgehenden Reformstillstand verantwortlich gemacht: Deutschland befinde sich in der „Politikverflechtungsfalle“.
Tatsächlich ist in Deutschland eine stark ausgeprägte Politikverflechtung beobachtbar, bei der eine Vielzahl von Entscheidungen im Verbund verschiedener Entscheidungsebenen (Bund und Länder bzw. Länderkooperation untereinander) getroffen werden.
Die wichtigste sozialwissenschaftliche Theorie zum Föderalismus in Deutschland ist die Theorie der Politikverflechtungsfalle, die ab Mitte der 1970er von Fritz W. Scharpf entwickelt worden ist. Diese zunächst an empirischen Beobachtungen der Gemeinschaftsaufgaben in Deutschland entwickelte (und später am europäischen Mehrebenensystem weiter ausgeführte) akteurszentrierte Theorie erklärt Entstehung und Folgen der Politikverflechtung mit Hilfe spieltheoretischer Verfahren. Verflochtene Systeme führen danach durch die Zunahme der entscheidungsbeteiligten, jeweils ihre eigenen Interessen verfolgenden Akteure zu einer Erhöhung des Konfliktniveaus und einer höheren Wahrscheinlichkeit von Entscheidungsblockaden. Konsensuale Entscheidungen könnten nur durch konfliktminimierende Strategien erzielt werden, die häufig suboptimale, innovationshemmende Ergebnisse erzielen. Die Politikverflechtungsfalle bestehe schließlich darin, dass innerhalb der Strukturen der Politikverflechtung keine institutionellen Reformen zur Überwindung der Tendenz zur Selbstblockade beschlossen werden könnten.
Im Gegensatz zu Scharpf zeichnet Arthur Benz ein deutlich positiveres Bild des deutschen Föderalismus. Seine theoretischen Überlegungen, die in diesem Referat skizziert werden sollen, beschäftigen sich vor allem mit den Wechselwirkungen zwischen institutionellen Strukturen und Akteursverhalten. Insbesondere interessiert ihn die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten den Akteuren auch innerhalb verflochtener Mehrebenensystems bleiben. Auf diese konstruktiven Strategien zur Vermeidung von Entscheidungsblockaden werde ich im Punkt 2) eingehen. Unter Punkt 3) werde ich Benz’ Theorie des dynamischen Föderalismus vorstellen, welche ein Modell zur Analyse der Entwicklung föderaler Systeme bereitstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Föderalismus als komplexes Verhandlungssystem
- Inkompatibilitäten zwischen Entscheidungsarenen.
- Akteursverhalten im verflochtenen Staat: Konstruktive Strategien.
- Fazit: Eigendynamik.
- Theorie der Entwicklung föderaler Systeme
- Modell des dynamischen Föderalismus
- Strukturelle Veränderungen als flexible Anpassungen.
- Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit der sozialwissenschaftlichen Theorie des Föderalismus, insbesondere mit den theoretischen Überlegungen von Arthur Benz zum deutschen Föderalismus. Im Gegensatz zur etablierten Theorie der Politikverflechtungsfalle von Fritz W. Scharpf, die von Ineffizienzen und Reformstillstand ausgeht, zeichnet Benz ein positiveres Bild. Er untersucht die Wechselwirkungen zwischen institutionellen Strukturen und Akteursverhalten und zeigt auf, welche Handlungsmöglichkeiten Akteuren auch innerhalb verflochtener Mehrebenensysteme bleiben.
- Kritik an der Politikverflechtungsfalle und Entwicklung einer konstruktiven Perspektive auf den deutschen Föderalismus.
- Analyse der Inkompatibilitäten zwischen Entscheidungsarenen im föderalen System.
- Bedeutung des Akteursverhaltens und der konstruktiven Strategien zur Vermeidung von Entscheidungsblockaden.
- Vorstellung von Benz' Theorie des dynamischen Föderalismus als Modell für die Analyse der Entwicklung föderaler Systeme.
- Bewertung der unterschiedlichen Perspektiven auf den deutschen Föderalismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des deutschen föderalen Systems dar und führt die Theorie der Politikverflechtungsfalle von Scharpf ein. Im Gegensatz dazu wird Benz' positivere Sichtweise auf den Föderalismus vorgestellt, die sich auf die Wechselwirkungen zwischen Institutionen und Akteursverhalten konzentriert.
Kapitel 2 untersucht den Föderalismus als komplexes Verhandlungssystem. Die Inkompatibilitäten zwischen den Entscheidungsarenen (föderale und parteipolitische Arena) werden analysiert, wobei die Unterschiede in den Funktionslogiken und Entscheidungsmechanismen hervorgehoben werden. Der Konflikt zwischen Entscheidungsfähigkeit und Legitimation im verflochtenen System wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Akteursverhalten innerhalb des verflochtenen Systems. Die Bedeutung von "Grenzstelleninhabern" wird betont, die in verschiedenen Ebenen und Arenen agieren und somit zur Lösung der Probleme beitragen können. Die verschiedenen Strategien, die Akteure zur Vermeidung von Blockaden anwenden, werden vorgestellt, wobei der Fokus auf den konstruktiven Strategien liegt, die zu innovativen Lösungen führen und die Interessen berücksichtigen.
In Kapitel 4 wird Benz' Theorie des dynamischen Föderalismus vorgestellt. Diese Theorie dient als Modell zur Analyse der Entwicklung föderaler Systeme und betont die Bedeutung von strukturellen Veränderungen als flexible Anpassungen an neue Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Politikverflechtung, Politikverflechtungsfalle, Entscheidungsarenen, Akteursverhalten, Konstruktive Strategien, Dynamischer Föderalismus, Mehrebenensystem, Grenzstelleninhaber.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Politikverflechtungsfalle"?
Ein von Fritz W. Scharpf geprägter Begriff für ein System, in dem Entscheidungen zwischen Bund und Ländern so stark verflochten sind, dass es zu Blockaden und ineffizienten Kompromissen kommt.
Welche Position vertritt Arthur Benz im Vergleich zu Scharpf?
Benz zeichnet ein positiveres Bild und betont die konstruktiven Strategien und Handlungsmöglichkeiten der Akteure innerhalb des verflochtenen Systems.
Was versteht Benz unter "dynamischem Föderalismus"?
Es ist ein Modell zur Analyse föderaler Systeme, das strukturelle Veränderungen als flexible Anpassungen an neue Herausforderungen begreift.
Wer sind "Grenzstelleninhaber" im föderalen System?
Akteure, die gleichzeitig in verschiedenen Ebenen oder Arenen agieren und dadurch helfen können, Inkompatibilitäten zu überbrücken und Blockaden zu lösen.
Welche konstruktiven Strategien gibt es zur Vermeidung von Blockaden?
Dazu gehören Verhandlungsprozesse, die innovative Lösungen hervorbringen und die Interessen der beteiligten Ebenen ausgleichen, statt nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen.
- Quote paper
- Diplom-Politologe Florian Wanke (Author), 2005, Sozialwissenschaftliche Theorie des Föderalismus - Arthur Benz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46306