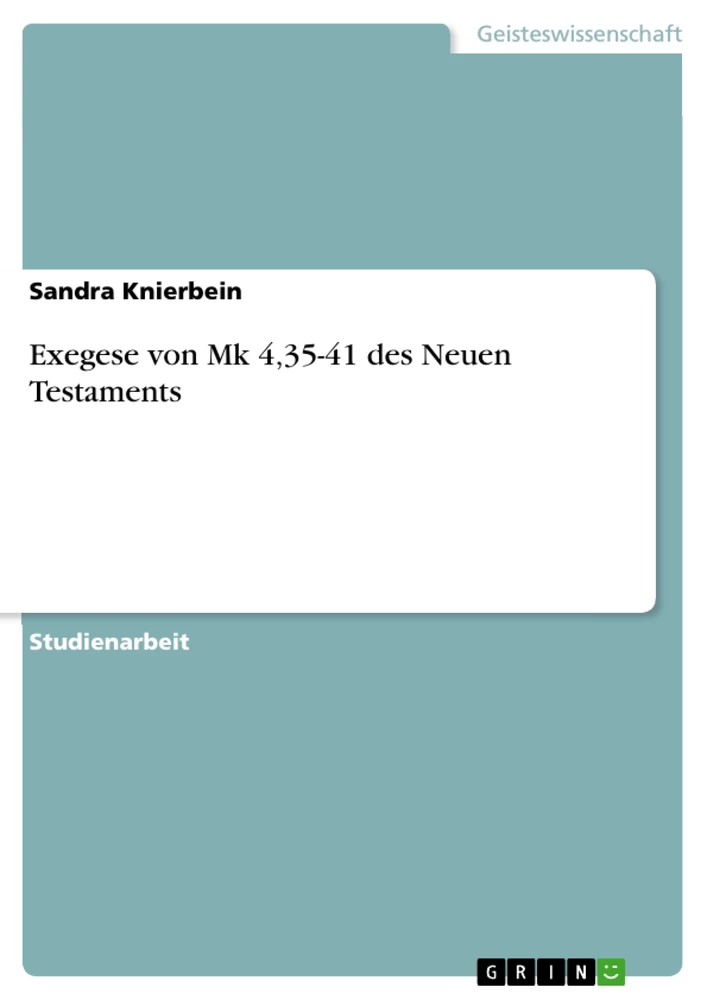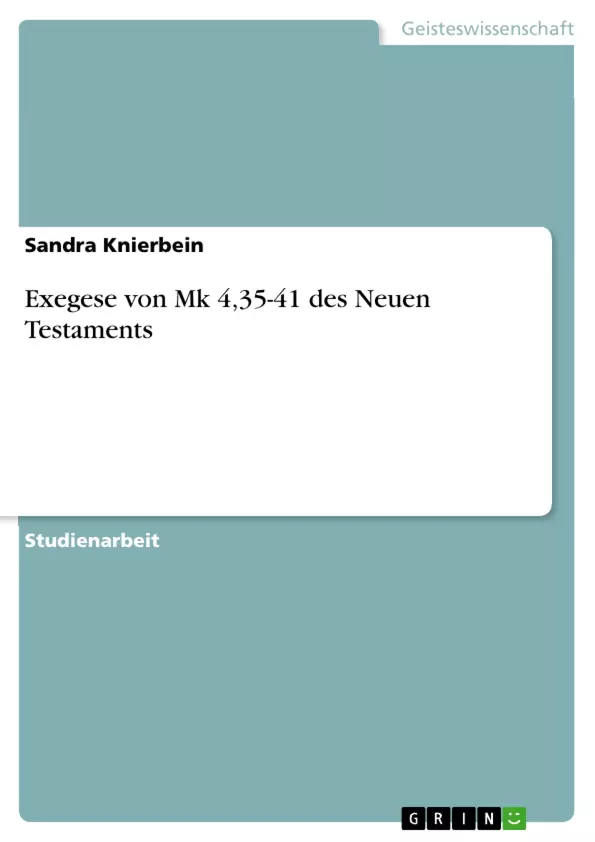Die vorliegende exegetische Hausarbeit behandelt die Perikope Mk 4,35-41. In dieser geht es um die Stillung eines Sturms durch Jesus, während er sich mit den zwölf Aposteln, seinen Jüngern, auf dem Meer befindet. Jesus stillt den Sturm, indem er zum Wind und zum Meer spricht.
Doch was bedeutet es genau, einen Sturm zu stillen, eine Naturmacht zu besiegen? Wie reagieren die Jünger auf dieses Geschehen und was bedeutet dies für ihr Verhältnis zu Jesus? Um das heraus zu finden, ist es Ziel dieser Hausarbeit, durch exegetische Methoden die syntaktischen, semantischen und weitere Merkmale im Textabschnitt zu analysieren und zu interpretieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Vorstellung der exegetischen Methoden
- Aufbau der Arbeit
- Exegese von Mk 4,35-41
- Präsentation des Textes nach ÄE
- Analyse des Textabschnitts
- Textabgrenzung
- Formanalyse
- Gattungsanalyse
- Erzählanalyse
- Interpretation des Textabschnitts
- Vers-für-Vers-Exegese
- Theologische Schwerpunkte
- Einleitungsfragen zum Mk
- Verfasser
- Abfassungsort
- Abfassungszeit
- Struktur des Mk
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende exegetische Hausarbeit analysiert die Perikope Mk 4,35-41, die die Stillung eines Sturms durch Jesus beschreibt. Das Ziel der Arbeit ist es, durch die Anwendung exegetischer Methoden die syntaktischen, semantischen und weiteren Merkmale des Textabschnitts zu untersuchen und zu interpretieren, um das Geschehen besser zu verstehen und die Bedeutung der Stillung des Sturms für das Verhältnis der Jünger zu Jesus zu beleuchten.
- Die Macht Jesu über die Natur
- Das Vertrauen der Jünger auf Jesus
- Die Bedeutung des Wunders für die Jünger
- Die Rolle der Natur in der biblischen Erzählung
- Die Interpretation des Sturms als Metapher für die Herausforderungen des Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, beschreibt die exegetische Methode, die angewendet wird, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Exegese von Mk 4,35-41: Dieser Abschnitt beinhaltet eine Analyse des Textes nach Äußerungseinheiten, eine Textabgrenzung, Formanalyse, Gattungsanalyse und Erzählanalyse. Außerdem werden die semantischen und theologischen Aspekte des Textes beleuchtet.
- Einleitungsfragen zum Mk: Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Fragen zum Markusevangelium, wie Verfasser, Abfassungsort, Abfassungszeit und Struktur, vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Mk 4,35-41, Jesus, Sturm, Stillung, Jünger, Vertrauen, Macht, Natur, Wunder, Interpretation, exegetische Methoden, historisch-kritische Methode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Inhalt der Perikope Mk 4,35-41?
In diesem Textabschnitt des Markusevangeliums wird die Stillung eines Sturms durch Jesus auf dem Meer beschrieben.
Was bedeutet die Stillung des Sturms theologisch?
Sie symbolisiert Jesu Macht über die Naturmächte und dient als Metapher für das Vertrauen in Gott angesichts der Herausforderungen des Lebens.
Wie reagieren die Jünger auf das Wunder?
Die Jünger reagieren mit Furcht und Staunen, was die zentrale Frage nach ihrer Erkenntnis über die wahre Identität Jesu aufwirft.
Welche exegetischen Methoden werden in der Hausarbeit angewendet?
Es kommen Methoden wie die Textabgrenzung, Formanalyse, Gattungsanalyse und Erzählanalyse zum Einsatz.
Wer gilt als Verfasser des Markusevangeliums?
Die Arbeit behandelt Einleitungsfragen zum Markusevangelium, darunter die Diskussion über den Verfasser, den Abfassungsort und die zeitliche Einordnung.
- Quote paper
- Sandra Knierbein (Author), 2015, Exegese von Mk 4,35-41 des Neuen Testaments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463063