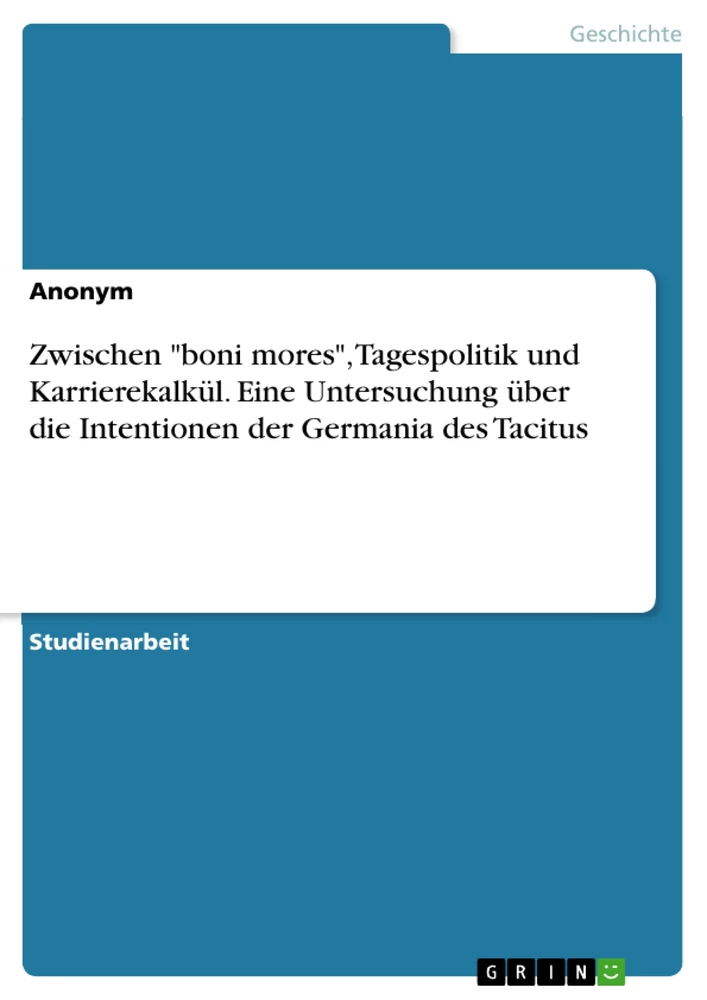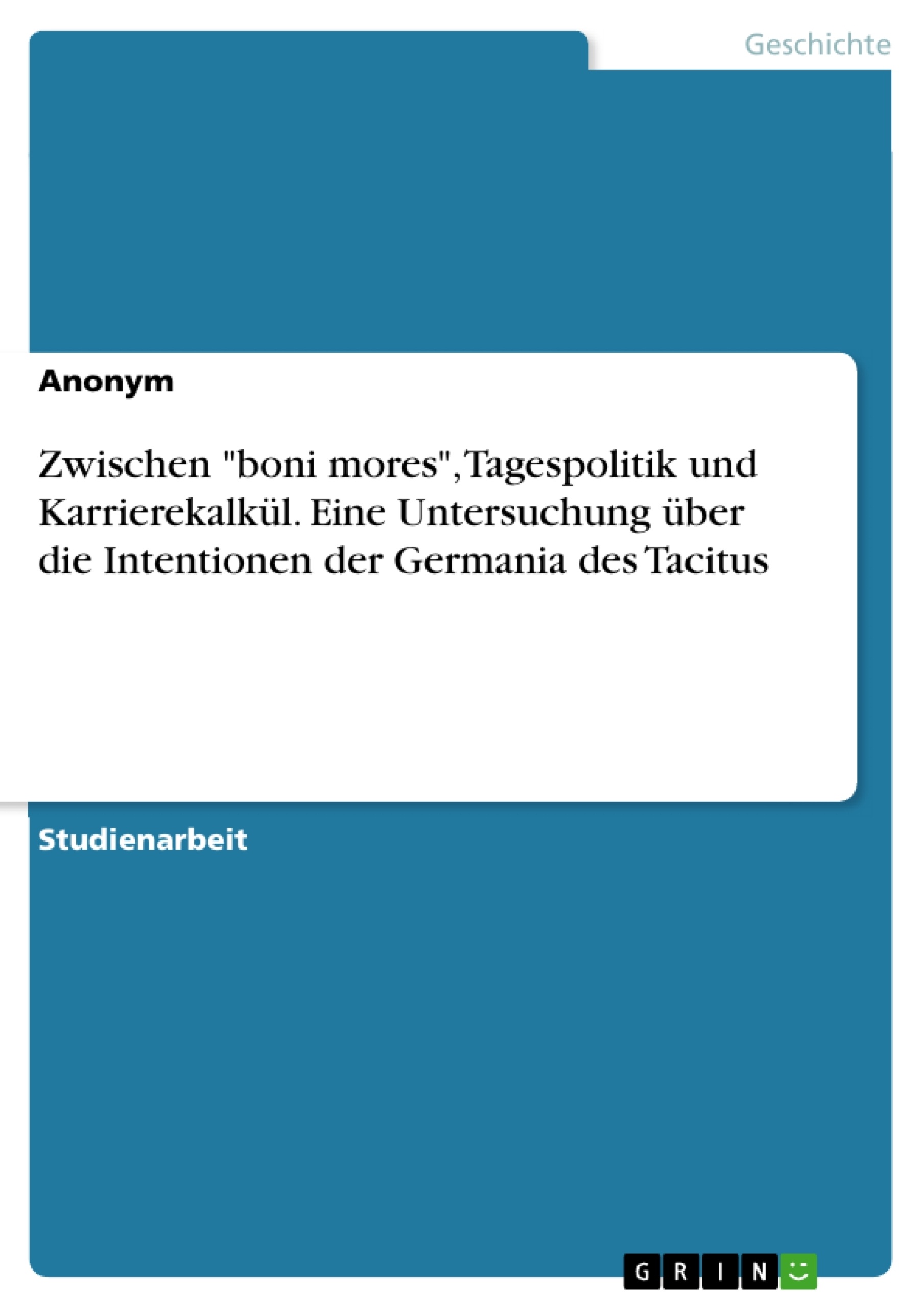Die Germania hat aufgrund ihrer Bedeutung und ihrer Einzigartigkeit in der Wissenschaft eine so große Rezeption erfahren, dass die Fülle an Interpretationen beinahe unüberblickbar geworden ist. Je nach Perspektive wurde die Vielzahl der in ihr enthaltenen Informationen schon als Quelle über die Germanen oder über die Römer, über Wertvorstellungen oder über politische Zustände gedeutet. Diese Deutungsvielfalt ergibt sich unter anderem daraus, dass über die Beweggründe, warum Tacitus die Germania schrieb, Unklarheit herrscht – schließlich fehlen in der Arbeit Proömium, Epilog oder sonstige Bemerkungen über die Absichten und Vorsätze des Autors. Für die Frage, wie die vielen einzelnen Auskünfte über die Germanen zu interpretieren sind, ist es aber unerlässlich, die Intentionen des Autors zu verstehen: „Es macht etwas aus, ob Tacitus als Forscher und Geograph, ob er als Sittenprediger, ob er als politischer Tagesschriftsteller oder in welcher Absicht sonst geschrieben hat.“
Um zu prüfen, mit welcher Intention die Germania geschrieben wurde, wird diese zunächst mit all ihren Eigenheiten als Quelle vorgestellt. Anschließend werden die verschiedenen Ansätze zur Entschlüsselung der Intentionen des Autors charakterisiert, wobei sie anhand von Quellenmaterial und Forschungsmeinungen bewertet werden, bevor abschließend ein Ergebnis formuliert wird. Der Zweck dieses Beitrages ist es, durch die gewonnenen Erkenntnisse das Verständnis über die Aussagekraft der Germania zu präzisieren und zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Tacitus' Germania
- 3. Die Intention der Germania
- 3.1 Die Germania im Kontext Tacitus' schriftstellerischer Karriere
- 3.2 Die Germania als tagespolitische Schrift
- 3.3 Die Germania als Sittenspiegel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Intentionen Tacitus' bei der Verfassung seiner Germania. Ziel ist es, die vielfältigen Interpretationen des Werkes zu beleuchten und aufzuzeigen, dass mehrere Intentionen gleichzeitig Gültigkeit beanspruchen können. Die Arbeit analysiert die Germania als Quelle und bewertet verschiedene Theorien zu Tacitus' Beweggründen.
- Tacitus' politische Karriere und ihr Einfluss auf die Germania
- Die Germania als Beitrag zur politischen Debatte über die Germanenkriege
- Die Germania als ethnografische Monografie und ihre Einzigartigkeit
- Die Rolle der Germania im Kontext der schriftstellerischen Tradition
- Die Bewertung der Germania als Sittenspiegel und ihre Relevanz für das Verständnis des Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die umfangreiche und vielschichtige Rezeption der Germania und die daraus resultierende Unübersichtlichkeit der Interpretationen. Sie stellt die zentrale Frage nach Tacitus' Intentionen bei der Abfassung des Werkes in den Mittelpunkt und hebt die Unsicherheit über seine Beweggründe hervor, da das Werk weder Proömium noch Epilog enthält. Die Einleitung erwähnt verschiedene bestehende Theorien zur Intention der Germania, darunter die Betrachtung als Beiwerk zu den Historien, als Positionierung gegen Domitian, als Beitrag zur politischen Diskussion über die Germanenkriege und als Sittenspiegel. Sie betont die Notwendigkeit, diese verschiedenen Intentionen zu untersuchen, um die Aussagekraft der Germania besser zu verstehen und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an, der darin besteht, die verschiedenen Intentionen zu charakterisieren und anhand von Quellenmaterial und Forschungsmeinungen zu bewerten.
2. Tacitus' Germania: Dieses Kapitel befasst sich mit Aspekten der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Germania, die für das Verständnis der Intentionen Tacitus' relevant sind. Es wird die Entstehungszeit um 98 n. Chr. und Tacitus' politische Stellung als einflussreicher Senator in Rom betont, was ihm Zugang zu vielfältigen Quellen ermöglichte. Die formale Einzigartigkeit der Germania als ethnografische Monografie im Kontext der antiken völkerkundlichen Literatur wird hervorgehoben und die Frage nach den Gründen für die Wahl dieser Gattung aufgeworfen. Das Kapitel diskutiert die Bedeutung der Germania als einzigartige Informationsquelle, da viele zeitgenössische Quellen verloren gegangen sind. Es stellt die differierenden historischen Bewertungen des Werkes heraus, von der ideologischen Instrumentalisierung bis hin zur Verehrung als nationale Urgeschichte, und deren Einfluss auf die Interpretation. Die unterschiedliche Bewertung des Werks im Laufe der Geschichte wird ebenfalls diskutiert.
3. Die Intention der Germania: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Interpretationen der Intentionen Tacitus' bei der Abfassung der Germania. Es wird systematisch auf verschiedene Aspekte eingegangen, um die Vielschichtigkeit der möglichen Intentionen aufzuzeigen. Der Kapitel analysiert die Germania im Kontext von Tacitus' schriftstellerischer Karriere und untersucht deren Bedeutung als tagespolitische Schrift. Abschließend werden Varianten der Sittenspiegeltheorie beleuchtet und bewertet. Der Fokus liegt darauf, verschiedene Interpretationen nebeneinander zu betrachten und deren jeweilige Gültigkeit zu prüfen.
3.1 Die Germania im Kontext Tacitus' schriftstellerischer Karriere: Dieser Abschnitt betrachtet die Germania im Kontext von Tacitus' Leben und Werk. Die Entstehungszeit nach Domitians Tod und Tacitus' Position als einflussreicher Politiker werden als relevante Faktoren für die Interpretation seiner Intentionen herangezogen. Der Abschnitt analysiert das Verhältnis zur vorhergehenden Schrift "Agricola" und untersucht, ob die Germania als Reaktion auf die Herrschaft Domitians entstanden ist. Es wird geprüft, inwieweit die Germania als Reaktion auf die Herrschaft Domitians interpretiert werden kann, und ob dies der Hauptgrund für das Schreiben des Werkes war. Eine eingehende Untersuchung sucht nach direkten Anspielungen auf Domitian in der Germania. Das Kapitel beleuchtet auch die Positionierung Tacitus' in der römischen Literaturszene und seinen Versuch, sich durch ein außergewöhnliches Werk zu profilieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Tacitus' Germania
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Intentionen Tacitus' bei der Verfassung seiner "Germania". Ziel ist es, die vielschichtigen Interpretationen des Werkes zu beleuchten und aufzuzeigen, dass mehrere Intentionen gleichzeitig Gültigkeit beanspruchen können. Die Arbeit analysiert die "Germania" als Quelle und bewertet verschiedene Theorien zu Tacitus' Beweggründen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht Tacitus' politische Karriere und deren Einfluss auf die "Germania", die "Germania" als Beitrag zur politischen Debatte über die Germanenkriege, die "Germania" als ethnografische Monografie und ihre Einzigartigkeit, die Rolle der "Germania" im Kontext der schriftstellerischen Tradition und die Bewertung der "Germania" als Sittenspiegel und deren Relevanz für das Verständnis des Werkes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beleuchtet die Rezeption der "Germania" und die zentrale Frage nach Tacitus' Intentionen. Kapitel 2 (Tacitus' Germania) befasst sich mit Aspekten der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte. Kapitel 3 (Die Intention der Germania) untersucht verschiedene Interpretationen der Intentionen Tacitus', unterteilt in 3.1 (Die Germania im Kontext Tacitus' schriftstellerischer Karriere), 3.2 (Die Germania als tagespolitische Schrift) und 3.3 (Die Germania als Sittenspiegel). Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Intention der Germania im Detail untersucht?
Kapitel 3 analysiert die "Germania" systematisch in verschiedenen Kontexten: im Kontext von Tacitus' schriftstellerischer Karriere (inkl. Beziehung zu "Agricola" und möglicher Reaktion auf Domitian), als tagespolitische Schrift im Bezug auf die Germanenkriege und als Sittenspiegel. Der Fokus liegt auf der gleichzeitigen Gültigkeit verschiedener Interpretationen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die "Germania" selbst, berücksichtigt deren Entstehungszeit und den historischen Kontext, bezieht Tacitus' politische Karriere und seine anderen Werke mit ein und analysiert verschiedene Forschungsmeinungen und Interpretationen der "Germania".
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Intention der "Germania" vielschichtig ist und nicht auf eine einzige Erklärung reduziert werden kann. Mehrere Intentionen (politische Stellungnahme, ethnografische Darstellung, Sittenspiegel etc.) können gleichzeitig Gültigkeit beanspruchen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit (Kapitel 4) detailliert dargestellt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich akademisch mit Tacitus' "Germania" auseinandersetzen möchten und Interesse an einer detaillierten Analyse der Intentionen des Werkes haben. Sie ist für Studenten, Wissenschaftler und alle geeignet, die sich vertieft mit der antiken Literatur und Geschichte beschäftigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Zwischen "boni mores", Tagespolitik und Karrierekalkül. Eine Untersuchung über die Intentionen der Germania des Tacitus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463100