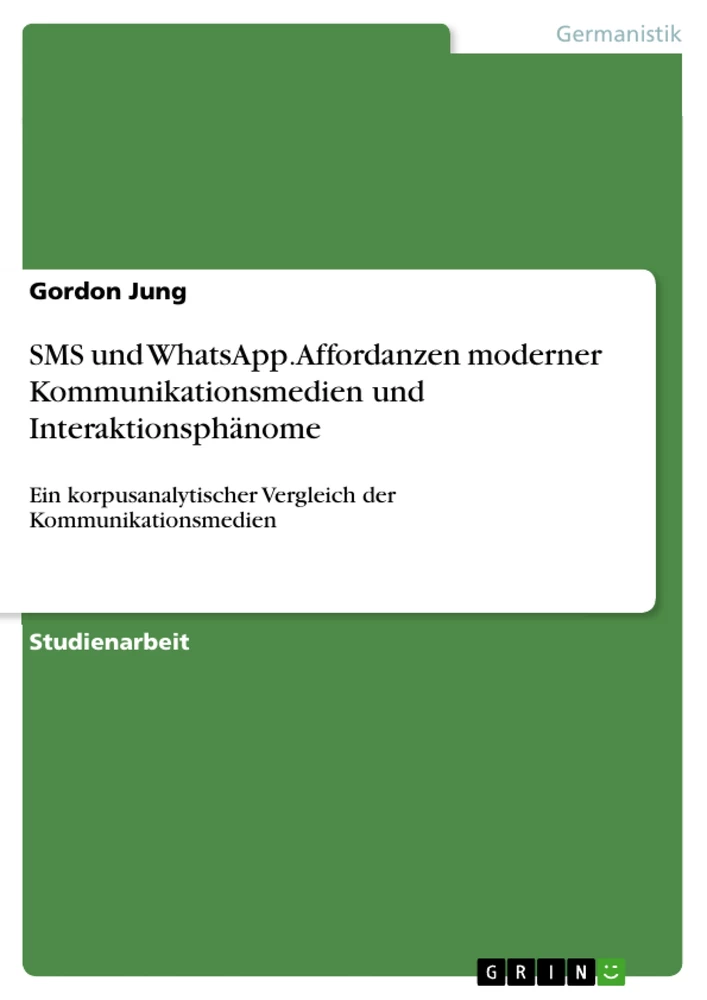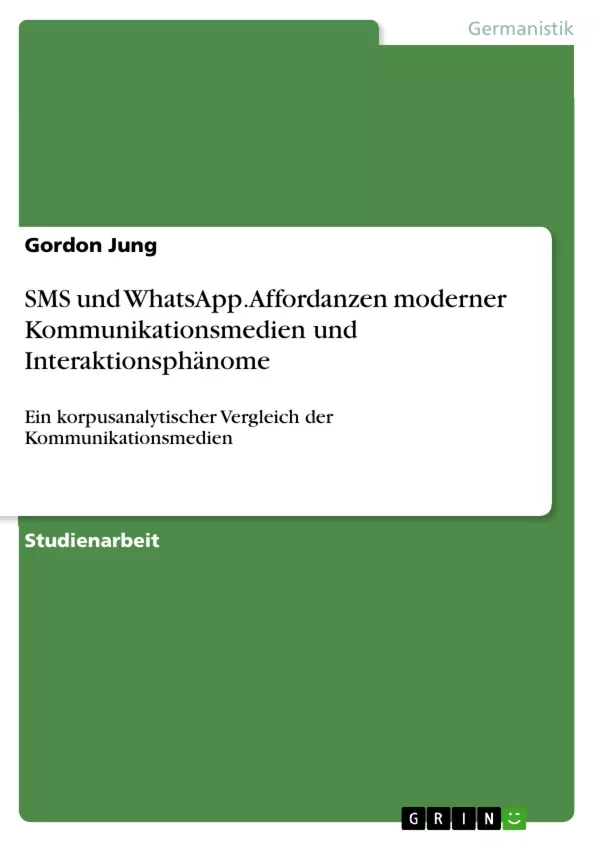Da vor allem WHATSAPP noch ein relativ unerforschtes Terrain der Linguistik darstellt, widmet sich diese Arbeit der Fragestellung, wie Menschen Kommunikation über die verschiedenen modernen Medien SMS und WHATSAPP organisieren und welche Rolle die Nutzeroberfläche bzw. der Angebotscharakter des jeweiligen Massenmediums hierbei spielt. Die durchaus bekanntere Form der SMS soll mit der neuen Plattform WHATSAPP unter dem Stichwort der Affordanz verglichen und die einhergehenden Interaktionsphänomene aufgezeigt werden, um zu analysieren, wie sich kommunikative Interaktionsphänomene durch die verschiedenen Angebotscharaktere verändern.
Die zugrundeliegenden Hypothesen sind zum einen, dass die Nutzungsoberfläche eines Kommunikationsmediums zu einer Veränderung der Kommunikation beiträgt: Etwa von verstärkten Tendenzen zur Mündlichkeit oder zur Bildhaftigkeit, wobei das Prinzip medialbedingter Ökonomisierung zum Tragen kommt. Zum anderen, dass die medialen "[…] Unterschiede unserer Einschätzung nach v.a. im Bereich der Kommunikationspraxis, weniger im Sprachgebrauch selbst liegen, dass es aber auch zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen SMS und WhatsApp gibt."
Wie verschiedene alltägliche Phänomene findet auch Kommunikation vermehrt digitalisiert und medialisiert via interpersonale Medien wie FACEBOOK, TWITTER, SMS oder WHATSAPP statt. Diese "Mediatisierung des Alltags" verändert durch fortwährende Entwicklung der Funktionsweisen und Oberflächen sowohl die Nutzungsmöglichkeiten des Mediums als auch "die Kommunikationsweisen". Jener Zusammenhang kann mit der Wortneuschöpfung der Affordanz (Angebotscharakter) beschrieben werden, wobei die technischen Rahmenbedingungen verantwortlich für verschiedene Interaktionsphänomene erscheinen.
Jener zunehmende Wandel hin zu einer digitalen Kommunikation mittels des Internets und technischer Innovationen zeichnet sich etwa bei den Keyboard-to-Screen-Kommunikationsformen der SMS und des Messengerdienstes WHATSAPP deutlich ab. Der Kommunikationsraum Internet ist jedoch hierbei kein homogenes Netzwerk und formt so zum einen „[…] eine Kommunikationsform […], die an die Nutzung der neuen Medien gebunden ist […]“ und zum anderen eine Konvergenz von Medien und Kommunikationsformen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Forschungsgegenstand
- I. SMS - Eine alte Kommunikationsform
- II. WhatsApp - Eine neue Kommunikationsplattform
- 3. Affordanz - Der Angebotscharakter
- 4. Korpora - MoCODA 1 und 2
- I. MoCODA - Mobile Communication Database
- II. MoCODA2 - Mobile Communication Database (Open-Beta-Phase)
- 5. SMS und WhatsApp - Ein korpusanalytischer Vergleich
- I. Datenanalyse SMS-Kommunikation
- II. Datenanalyse WhatsApp-Kommunikation
- 6. Fazit WhatsApp - Die bessere Alternative zur SMS?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Organisation von Kommunikation über die Medien SMS und WhatsApp und die Rolle der jeweiligen Nutzeroberfläche (Affordanz) dabei. Der Vergleich soll aufzeigen, wie sich kommunikative Interaktionsphänomene durch unterschiedliche Angebotscharaktere verändern. Die Arbeit basiert auf der Analyse bestehender Korpora (MoCODA 1 und 2).
- Vergleich der Kommunikationsformen SMS und WhatsApp
- Analyse des Einflusses der Nutzeroberfläche auf die Kommunikation
- Untersuchung medialer Unterschiede in der Kommunikationspraxis
- Bedeutung der Affordanz für Interaktionsphänomene
- Anwendung korpuslinguistischer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Diese Einleitung führt in die Thematik der digitalisierten und mediatisierten Kommunikation ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Organisation von Kommunikation über SMS und WhatsApp sowie dem Einfluss der jeweiligen Nutzeroberfläche. Der zunehmende Wandel hin zu digitaler Kommunikation wird beleuchtet, wobei die Affordanz als zentraler Begriff eingeführt wird. Die Arbeit zielt auf einen Vergleich von SMS und WhatsApp ab, um die sich daraus ergebenden Interaktionsphänomene zu analysieren. Die Hypothesen besagen, dass die Nutzeroberfläche die Kommunikation beeinflusst (z.B. Tendenzen zur Mündlichkeit oder Bildhaftigkeit) und dass die medialen Unterschiede primär in der Kommunikationspraxis liegen.
2. Forschungsgegenstand: Dieses Kapitel definiert und erläutert zentrale Begriffe wie Mediatisierung und Multimedialität im Kontext digitaler Massenmedien. Es wird auf die unterschiedlichen Ausgestaltungen und interaktionalen Möglichkeiten von SMS und WhatsApp eingegangen. Der Begriff der Multimedialität wird im Detail erklärt, wobei die Multimodalität und Multikodalität als wichtige Eigenschaften hervorgehoben werden. Zusätzlich wird die begriffliche Abgrenzung zwischen SMS und WhatsApp im Hinblick auf die Nutzung von Smartphones und Apps vorgenommen.
Schlüsselwörter
Affordanz, SMS, WhatsApp, Kommunikation, Interaktion, Korpusanalyse, MoCODA, Mediatisierung, Multimedialität, digitale Kommunikation, Nutzeroberfläche, Keyboard-to-Screen-Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Korpusanalytischer Vergleich von SMS und WhatsApp
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Organisation von Kommunikation über die Medien SMS und WhatsApp und den Einfluss der jeweiligen Nutzeroberfläche (Affordanz) darauf. Es wird ein Vergleich der beiden Kommunikationsformen durchgeführt, um aufzuzeigen, wie sich kommunikative Interaktionsphänomene durch unterschiedliche Angebotscharaktere verändern. Die Analyse basiert auf den Korpora MoCODA 1 und 2.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie organisiert sich Kommunikation über SMS und WhatsApp, und welchen Einfluss hat die jeweilige Nutzeroberfläche? Die Arbeit untersucht, wie sich kommunikative Interaktionsphänomene durch die unterschiedlichen Angebotscharaktere von SMS und WhatsApp verändern. Es werden Hypothesen geprüft, die besagen, dass die Nutzeroberfläche die Kommunikation beeinflusst (z.B. Tendenzen zur Mündlichkeit oder Bildhaftigkeit) und dass die medialen Unterschiede primär in der Kommunikationspraxis liegen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet korpuslinguistische Methoden zur Analyse der Kommunikationsdaten aus den Korpora MoCODA 1 und 2. Es werden die Daten der SMS- und WhatsApp-Kommunikation verglichen und interpretiert, um die Auswirkungen der unterschiedlichen Nutzeroberflächen auf die Kommunikation aufzuzeigen.
Was sind MoCODA 1 und 2?
MoCODA steht für Mobile Communication Database. Es handelt sich um Korpora (Datensammlungen), die Daten zur mobilen Kommunikation enthalten. MoCODA 1 ist die ältere Version, während MoCODA 2 eine Open-Beta-Phase darstellt und wahrscheinlich einen größeren Umfang oder neue Features bietet.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Affordanz, SMS, WhatsApp, Kommunikation, Interaktion, Korpusanalyse, MoCODA, Mediatisierung, Multimedialität, digitale Kommunikation, Nutzeroberfläche und Keyboard-to-Screen-Kommunikation.
Wie werden SMS und WhatsApp in der Arbeit verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Unterschiede in der Organisation der Kommunikation und den Einfluss der jeweiligen Nutzeroberflächen. Es wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen Möglichkeiten der beiden Plattformen (z.B. Multimedialität, Länge der Nachrichten) auf die Kommunikationspraxis auswirken. Die Analyse umfasst die Datenanalyse der SMS- und WhatsApp-Kommunikation.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird die Frage beantworten, ob WhatsApp eine bessere Alternative zu SMS darstellt. Es wird die Ergebnisse des korpusanalytischen Vergleichs zusammenfassen und die Bedeutung der Affordanz für die Interaktionsphänomene in beiden Kommunikationsformen beleuchten. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, wie die Nutzeroberfläche die Kommunikation prägt.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Forschungsgegenstand (inkl. SMS und WhatsApp als Kommunikationsformen), Affordanz, Korpora (MoCODA 1 und 2), SMS und WhatsApp - Ein korpusanalytischer Vergleich (inkl. Datenanalyse für beide Kommunikationsformen) und Fazit.
- Quote paper
- Gordon Jung (Author), 2019, SMS und WhatsApp. Affordanzen moderner Kommunikationsmedien und Interaktionsphänome, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463342