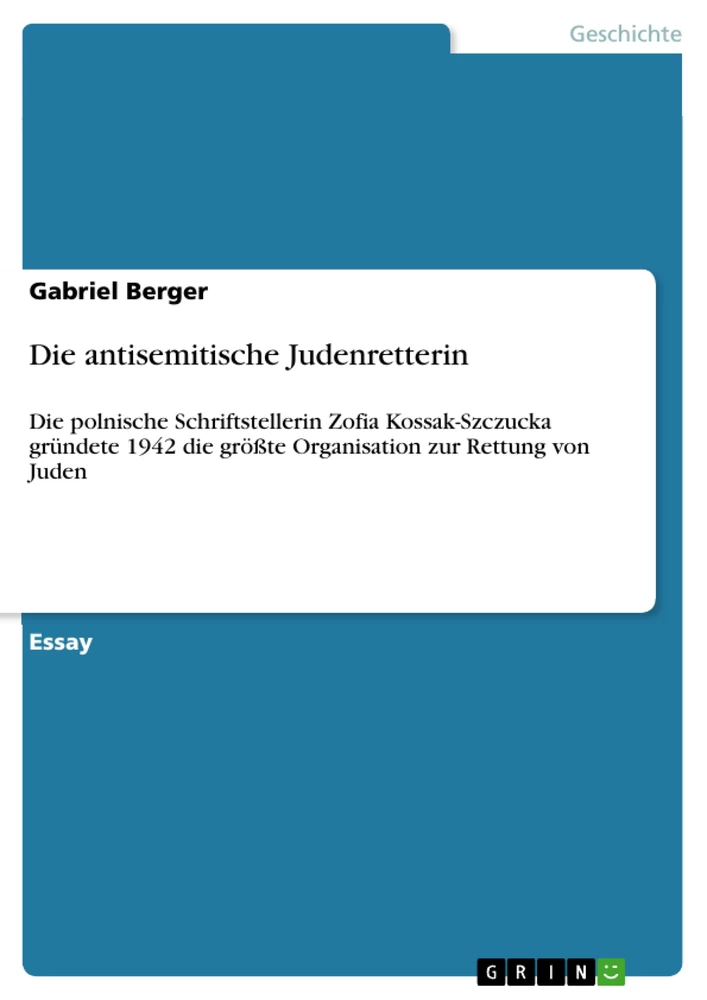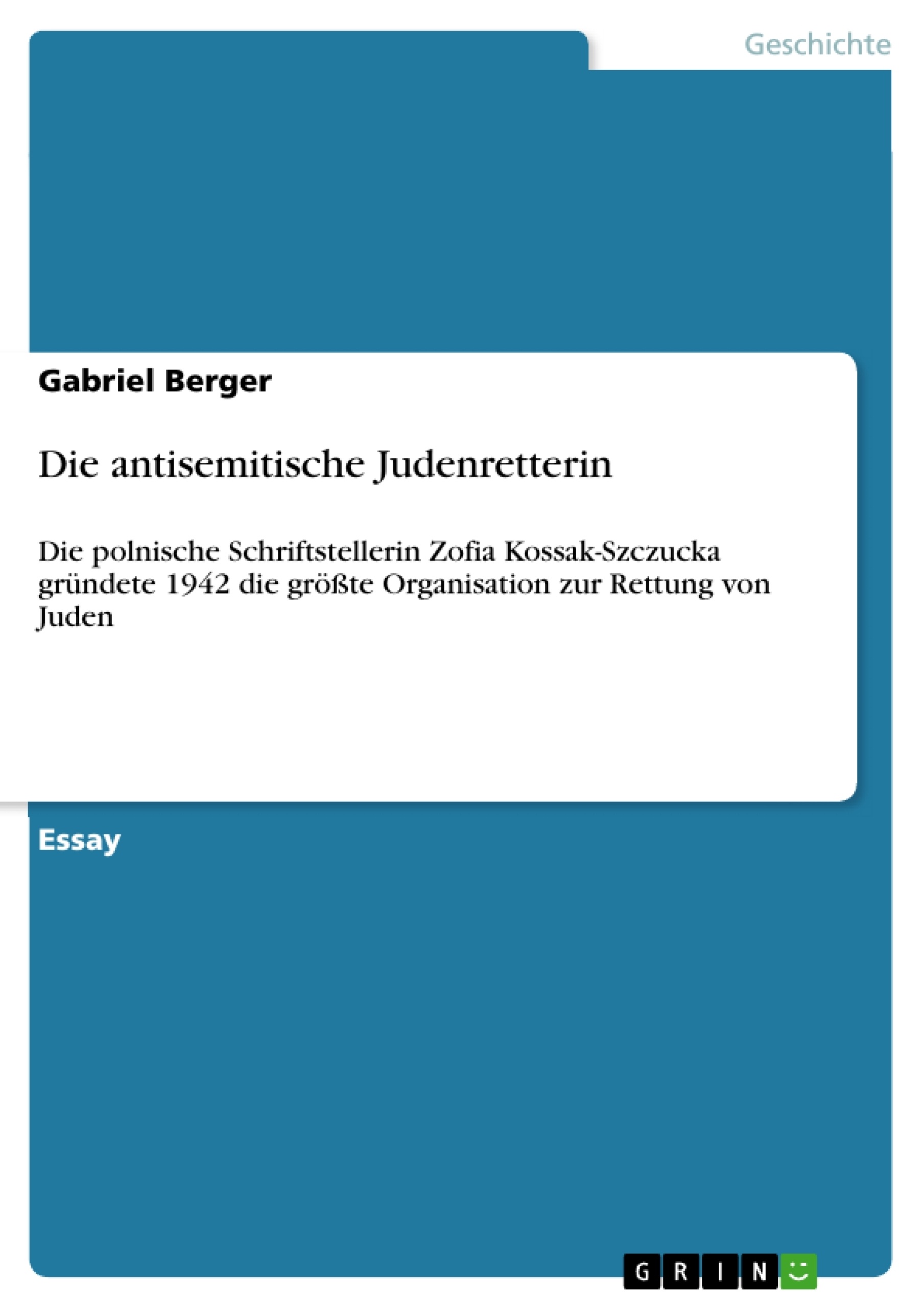Die vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen sehr bekannte Schriftstellerin Zofia Kossak-Szczucka verfasste in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts extrem nationalistische und antisemitische Romane und Presse-Beiträge. Und dennoch wurde sie während der deutschen Besatzung angesichts der barbarischen Verfolgung und Ermordung von polnischen Juden zur Initiatorin und Organisatorin der größten Organisation zur Rettung von Juden mit dem Code-Namen "Żegota". Sie und ihre Mitstreiter beriefen sich als gläubige Katholiken in ihren Hilfsaktionen für Juden auf die christliche Nächstenliebe, die es gebiete, auch Feinden zu helfen.
In ihren während der Nazi-Besatzung in der polnischen Untergrundpresse veröffentlichten Beiträgen verurteilte Zofia Kossak-Szczucka die Kollaboration zahlreicher Polen mit den Nazis beim aufspüren und Ermorden versteckter Juden.
Inhaltsverzeichnis
- Die antisemitische Judenretterin
- Die polnische Schriftstellerin Zofia Kossak-Szczucka gründete 1942 die größte Organisation zur Rettung von Juden.
- Ausschnitt aus dem 2016 veröffentlichten Buch „Umgeben von Hass und Mitgefühl“.
- Spätestens seit dem Erscheinen des Buches „Nachbarn“ von Jan Tomasz Gross im Jahre 2001 ist die in Polen zum gesellschaftlichen Konsens erhobene Saga vom unbeugsamen und makellosen polnischen Volk ins Wanken geraten.
- In dem Buch „Nachbarn“ beschreibt der Autor, wie unter der deutschen Besatzung in dem nordostpolnischen Dorf Jedwabne im Jahre 1941 von den polnischen Bewohnern, ohne eine Anweisung der Besatzer, alle jüdischen Einwohner des Dorfes brutal in eine Scheune getrieben wurden, die danach angezündet wurde.
- Dem Massaker fielen geschätzt 300 bis 400 Menschen zum Opfer.
- Die Veröffentlichung des Buches wurde in Polen zum öffentlichen Skandal.
- Er zwang eine Diskussion, die am stolzen Selbstbild der polnischen Nation kratzte, weshalb der Fall Jedwabne gern zum nicht mehr rekonstruierbaren Einzelfall heruntergespielt wird.
- Nach und nach wurde die in polnischen Historikerkreisen spätestens seit den frühen 1990er Jahren bekannt gewordene Massenerscheinung der Kollaboration von Polen mit der deutschen Besatzungsmacht bei der Vernichtung der Juden, besonders auf dem Land, zum Thema öffentlicher Diskussion.
- Es erschien eine ganze Reihe von historischen Veröffentlichungen zu diesem Sachverhalt.
- Besonders provokant hat es Stefan Zgliczyński 2013 mit seiner Buchpublikation unter dem Titel „Wie Polen den Deutschen halfen Juden zu ermorden“2 auf den Punkt gebracht.
- In ihrer Publikation unter dem Titel ,,Nach dem Mord gingen wir nach Hause“ beschreibt Barbara Engelking sehr drastisch den totalen Verlust moralischer Maßstäbe, der in der Zeit deutscher Besatzung auf polnischen Dörfern in ganz Polen aufgetreten ist:
- „Die Polen waren nicht gezwungen, Juden auszuliefern oder zu ermorden. Und doch war das ein Alltagsgeschehen auf polnischen Dörfern.
- Sie wurden in allen Regionen des besetzten Polen [an die Deutschen] ausgeliefert, in dörflichen Siedlungen, in Landgütern.
- Sie wurden mit dem getötet, was gerade zur Hand war, mit einer Axt, einem Knüppel, einem Stein, auf Feldern, in Wäldern, auf Wegen.
- Die Leichen warf man in einen Brunnen, verstaute sie unter Kartoffeln vergrub sie in Gruben, auf ,,Pferdefriedhöfen\", in Wäldern.
- Anders als in den Städten waren die Deutschen auf polnischen Dörfern faktisch nicht anwesend.
- Das Fangen von versteckten Juden und das Denunzieren der Versteckten bei den Deutschen war fast ausschließlich das Werk von Bewohnern.
- Wohl gab es nicht wenige polnische Dorfbewohner, meistens Nachbarn, die ihnen persönlich bekannten Juden halfen, sie versteckten.
- Doch sie waren gezwungen ein Doppelleben zu führen, weniger aus Angst vor den Deutschen, als vor der Feindseligkeit seitens ihrer polnischen Nachbarn oder der polnischen Partisanen.
- Sie mussten nach außen demonstrieren, dass sie die Juden hassen.
- Der nach dem Krieg als Judenretter von Yad Vashem mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern" ausgezeichnete Stanisław Pokorski erinnerte sich an sein Dorf Podwierzbie südlich von Warschau in der Kriegszeit:
- ,,Dort hat man die Deutschen nur einmal im halben Jahr gesehen. [...] Wenn man sich bei den Deutschen nicht beschwert hat, sind sie nie dorthin gekommen.\"6
- Er berichtete aber, dass polnische Partisanen der Untergrundarmee NSZ zu ihm gekommen seien und ihm für das Verstecken von Juden mit dem Tod drohten:
- ,,Vor den Deutschen hatte ich keine Angst, aber ich hatte Angst vor dieser Organisation.\"
- In seiner 1969 in Paris erschienenen Erzählung „Der Sieg“ beschrieb der polnisch-jüdische Schriftsteller Henryk Grynberg das Schicksal der Juden während der deutschen Besatzung auf der polnischen Seite wie folgt:
- ,,Sie überlebten, indem sie sich bei Bauern versteckten. Für Geld.
- Nie gaben sie das Geld vorweg und verweilten nicht zu lange bei einem Bauern.
- Zahlte man im Voraus, so hörte man, dann bemühte sich der Bauer, den Juden loszuwerden - und wurde ihn schließlich auch los, so gut er konnte.
- Gefährlich war es auch, zu lange bei einem Bauern zu bleiben, denn ein Bauer, der schon,, etwas verdient hatte\", war bemüht, sich des Problems zu entledigen.
- So starben in Rudzienki die Schwester der Frydowa und ihr Ehemann, erschlagen von dem Menschen, der sie versteckt hatte.
- Fand man einen anständigen Bauern, konnte man auch bei ihm nicht lange bleiben, denn er hatte Angst.
- Nicht vor den Deutschen, denn es war sehr unwahrscheinlich, dass die Deutschen kommen würden, um Juden zu suchen.
- Er hatte Angst vor Denunzianten, vor den Nachbarn, die krank vor Neid waren, dass jemand Geld verdiente, indem er Juden versteckte.
- Deshalb sagten die Nusens, wenn sie die Hütte eines Bauern verließen, nie wohin sie gingen.
- Missfiel ihnen irgendetwas im Verhalten des Bauern, stahlen sie sich nachts ohne sein Wissen aus der Hütte heraus.
- Sie waren immer wachsam, glaubten niemandem.\"8
- Da auf das Verstecken von Juden die Todesstrafe stand, wurden nach der Denunziation neben den versteckten Juden meist auch deren mutige Helfer von den Deutschen standrechtlich erschossen.
- Als Belohnung erhielt der Denunziant gewöhnlich einen Sack Zucker, manchmal war es nur 1 Kilogramm, eine Flasche Schnaps und die Kleidung der Erschossenen.
- Zu den individuellen Morden und Denunziationen bei der deutschen Polizei mit sofortigen tödlichen Folgen kamen Treibjagden auf Juden, ausgeführt durch die polnische Polizei („,granatowa policja“), oft mit Unterstützung polnischer Dorfbewohner, im Auftrag der deutschen Besatzer, aber häufig auf eigene Initiative und Verantwortung.
- Ähnlich kooperativ beim Eintreiben der Juden verhielt sich auch die polnische Kriminalpolizei.¹
- Wie viele Juden während der deutschen Besatzung auf dem Territorium Vorkriegspolens von den Polen ermordet wurden lässt sich nur schwer abschätzen.
- Jan T. Groß vermutet, dass es einige Hunderttausend gewesen sind¹², manche Quellen sprechen von „nur“ einigen Dutzend Tausend.
- Hinzu kommen Juden und Judenretter, die von Denunzianten den Deutschen ans Messer geliefert wurden.
- Diese erschreckenden Tatsachen erzwingen nach Meinung Stefan Zgliczyńskis die folgende Frage:
- ,, Gegen wen haben die Polen während des letzten Krieges vorrangig gekämpft – gegen die deutsche Besatzung oder gegen die eigenen jüdischen Nachbarn und Mitbürger?“
- Doch neben dem unter anderen von Zliczyński und einigen polnischen Historikern minutiös beschriebenen barbarischen Massenphänomen der individuellen und Gruppenmorde, Treibjagden, Erpressungen und Raub, verübt an Juden in polnischen Dörfern und Kleinstädten auf eigene Initiative der Bewohner.
- Es gab aber auch das Gegenteil, den Mut, den zahlreiche Polen unter Beweis stellten, indem sie sich der vorherrschenden Haltung und der von der deutschen Besatzung geschürten Angst entgegen stellten und Juden retteten.
- Von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sind 6.620 Polen als Judenretter mit dem Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet worden.
- Das sind immerhin 25,3 % von insgesamt 26.119 weltweit an alle Judenretter vergebenen Titeln.
- Menschenverachtende Barbarei und vom Humanismus oder christlicher Nächstenliebe getragenes Heldentum waren in Polen nah beieinander anzutreffen.
- Jedes positive oder negative Pauschalurteil über das Verhalten der Polen gegenüber Juden in der Nazizeit greift zu kurz.
- Auch Handlungen und Haltungen einzelner Personen, die durch den von der deutschen Besatzung verübten Massenmord an Juden einer harten moralischen Prüfung ausgesetzt waren, entziehen sich oft einem eindeutigen Urteil.
- Geht es um die Rettung von Juden in Polen, wird in historischer Literatur an erster Stelle die Organisation „Żegota “16 genannt.
- Der vollständige Name „Konrad Żegota “17 war der Code-Name für das ,,Hilfskomitee für Juden“18.
- Anders als auf dem Land war in den Großstädten die Präsenz der deutschen Besatzer und somit ihre Kontrolle permanent.
- Außerordentlich war unter diesen Umständen der Heldenmut der Mitglieder und Unterstützer von „Żegota“, da ihnen bekannt war, dass für jegliche Art der Hilfe für Juden von den Besatzern die Todesstrafe angedroht und oft auch vollstreckt wurde.
- Ungewöhnlich war auch die Vorgeschichte dieser Hilfsorganisation.
- Im August 1942 kursierte in Warschau ein Flugblatt, das von der damals in Polen bekannten Schriftstellerin Zofia Kossak-Szczucka verfasst wurde.
- Unter der Überschrift „Protest\" schrieb sie unter anderem: „Erheben wir, Katholiken und Polen, unsere Stimme.
- Unsere Gefühle gegenüber Juden bleiben unverändert.
- Wir betrachten sie nach wie vor als die politischen, wirtschaftlichen und ideellen Feinde Polens!
- Darüber hinaus wissen wir, dass sie uns mehr als die Deutschen hassen, dass sie uns für ihr Unglück verantwortlich machen.
- Doch die Kenntnis dieser Gefühle befreit uns nicht von der Pflicht, die Verbrechen (an den Juden) zu verurteilen.
- Verhalten wir uns nicht wie Pilatus.
- Wir haben keine Möglichkeiten, uns aktiv den von Deutschen begangenen Morden entgegenzustellen, doch unser Protest kommt aus der Tiefe unserer Herzen, die von Mitleid, Empörung und Grauen erregt werden.
- Wer sich unserem Protest nicht anschließt ist kein Katholik.\"19
- Ähnlich aufrüttelnde Worte schrieb Zofia Kossak-Szczucka später in der Untergrundpresse der „Front für die Wiedergeburt Polens“: „Man kann die Juden nicht mögen, man kann sich wünschen, dass sie nach dem Krieg das Land verlassen, aber solange sie verfolgt und ermordet werden, muss man ihnen helfen, auch wenn man dabei das eigene Leben und das Leben der Nächsten gefährdet.\"
- Sie selbst lieferte ein Beispiel für eine so selbstlose und solidarische Haltung, zu der sie trotz ihrer vorurteilsbeladenen Einstellung allem Jüdischen gegenüber und trotz ihrer tiefen Ablehnung der Juden fähig war.
- Doch ihre Appelle an das Gewissen der polnischen Landsleute sind ohne Frage befremdlich.
- Denn hier rief eine erklärte Antisemitin, die in ihren Schriften alle Register des traditionellen Antisemitismus zog, zur Hilfe für die Juden auf, unter Gefährdung oder gar Aufopferung des eigenen Lebens.
- Zofia Kossak-Szczucka betrachtete die Juden als Fremde und als Feinde Polens und meinte, damit die Haltung der Mehrheit damaliger Polen zu artikulieren.
- Der Aufruf der Schriftstellerin zur Hilfe für die vom Massenmord bedrohten Juden schloss folglich deren Bekämpfung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.
- Nichts kann krasser das Dilemma der katholischen Gesellschaft Polens in ihrer Haltung zu den Juden ausdrücken.
- Noch 1936 hatte sie geschrieben: „Sie sind uns so sehr fremd und abstoßend, weil sie einer fremden Rasse angehören.
- Alle ihre Eigenschaften stören uns, sind uns unangenehm.
- Orientalische Hektik, Streitsucht, spezifische Denkweise, ihre Augenpartie, die Form der Ohren, die herabhängenden Augenlider, die Form der Lippen, alles.\"22
- Doch ausgerechnet die Autorin dieser rassistischen Tirade hat nicht nur ihr eigenes und das Leben ihrer Tochter für die Rettung der Juden riskiert, sondern auch zahlreiche Polen motiviert, Juden zu helfen.
- Das wurde ihr 1985 in Israel posthum mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern\" honoriert.
- Es war die auf die Spitze getriebene Verwirklichung der Idee der christlichen Nächstenliebe, die gemäß der im Neuen Testament Jesus Christus zugesprochenen Worte auch die Feinde einschließen soll:
- „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist.
- Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten?\" (Math. 5, 43-45)
- Doch trotz ihrer Abscheu vor den vermeintlich angeborenen abstoßenden Eigenschaften von Juden hielt die Schriftstellerin sie nicht für verloren, weshalb es sich lohne, sie zu retten, im wörtlichen und im geistlichen Sinne: „Der Jude ist vor allem ein Mensch, der für das Heiligste Blut von Christus zu sühnen hat.
- Er ist mein Nächster.
- Aber er ist kein Christ.
- Es ist meine Pflicht, ihn zum richtigen Glauben zu bekehren.
- Von dem Moment an, in dem das eintritt, darf ich ihm gegenüber keine Vorbehalte haben, er wird zu meinem Bruder.\"23
- Es war ihr Ziel, die Juden vor dem Tod zu bewahren, damit sie aus Dankbarkeit den christlichen Glauben annehmen können.
- Nicht zuletzt wegen dieses von christlicher Nächstenliebe getragenen Missionsgedanken rechnete Zofia Kossak-Szczucka in der Untergrund-presse schonungslos mit den Erpressern ab, die sich an der tödlichen Bedrohung versteckter Juden schamlos bereicherten: „,Seien wir keine Heuchler: Die Sorge um den guten Leumund Polens im Ausland kann nicht als Begründung erhalten, die Existenz polnischer Kanaillen zu verschweigen, die vom Schmerz und Leid anderer profitieren.
- Die Banden von Denunzianten 24 und Erpressern wachsen und erreichen unvorstellbare, furchterregende Dimensionen.
- Die Erpresser machen der ständig wachsenden Anzahl der Opfer nazistischer Verfolgung das Leben unmöglich.
- Sie lauern den Opfern ständig nach.
- Kein Wunder, dass sich die Juden wie gejagte Tiere fühlen.
- Wir sind um die Juden besorgt, denn sie sind das Hauptobjekt der Erpresser.
- In der Vergangenheit haben wir unsere Haltung zu den Juden geklärt.
- Doch heute möchten wir unterstreichen, dass wir Zeugen schändlicher Taten jener sind, die aus deren Unglück Vorteile für sich ziehen.
- Solches Verhalten kann nicht entschuldigt werden.
- Kein ideologischer Antisemitismus kann die vollständige Entmenschlichung der Erpresser rechtfertigen.
- Diese scharfe Kritik der polnischen Nationalistin und bekennenden Antisemitin Zofia Kossak-Szczucka an der Haltung vieler Polen zu den Juden in der Zeit deutscher Besatzung ist aus heutiger Sicht besonders glaubwürdig.
- Denn in den heutigen nationalistischen Kreisen Polens wird jegliche Form der Kollaboration von Polen mit den nationalsozialistischen Besatzern, als auch die Verfolgung und Ermordung von Juden durch Polen während der deutschen Besatzung strikt geleugnet.
- Zofia Kossak-Szczucka befürchtete, dass es unter dem Einfluss der hemmungslosen Brutalität der deutschen Besatzungsmacht, welche die Juden zum Freiwild erklärt hatte, in Polen zur Verwilderung der Sitten kommen könnte.
- In einem Ihrer Beiträge für die Untergrundpresse schrieb sie: „Eine brennende Angelegenheit ist die durch Morde an Juden in unser Leben eingedrungene Demoralisierung und Brutalität.
- Es sind nicht nur die litauischen Kollaborateure, Volksdeutsche oder Ukrainer, die für die furchtbaren Exekutionen missbraucht wurden.
- In vielen Ortschaften (Kolno, Stawiski, Jagodno²7, Szumów, Dębin) hat die lokale Bevölkerung freiwillig an den Massakern teilgenommen.
- Man muss mit allen Mitteln diese Schande bekämpfen, die Menschen darüber informieren, dass sie so zu Folterknechten des Herodes werden, man muss sie in der Presse verurteilen, zum Boykott der Henker aufrufen, ihnen drohen, den Mördern die schärfsten Strafen vor Gericht ankündigen.
- Derzeit widmet sich niemand diesem Problem, die Presse28 hüllt sich in schändliches Schweigen und das Böse verbreitet sich wie eine Epidemie, das Verbrechen wird zur Gewohnheit.
- Man darf auf keinen Fall zulassen, dass sich die Seuche der Brutalität und des Sadismus unter uns ausbreitet.\"29
- Die Ursache dieser Verrohung sah Zofia Kossak-Szczucka in der von den Deutschen verbreiteten Ideologie des Hasses: „Die Deutschen haben die Überzeugung verbreitet, dass der Jude ein teuflisches Geschöpf ist, an dem ungestraft jedes Verbrechen begangen werden kann.
- Diese Überzeugung hat zur Folge, dass Fälle aktiver Teilnahme von Bauern an deutschen Ausrottungsaktionen leider immer häufiger werden.\"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Polen und Juden während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Er stellt die Frage nach dem Verhalten der polnischen Bevölkerung gegenüber den Juden und beleuchtet die verschiedenen Reaktionen auf die Judenverfolgung durch die deutsche Besatzungsmacht.
- Die Rolle der polnischen Bevölkerung bei der Judenverfolgung: Kollaboration und Widerstand.
- Die Bedeutung des "Judenretters" Stanisław Pokorski als Beispiel für den individuellen Mut und das entgegengebrachte Mitgefühl.
- Die Rolle der Organisation "Żegota" als wichtigstes Hilfskomitee für Juden im besetzten Polen.
- Die Persönlichkeit von Zofia Kossak-Szczucka: eine Antisemitin, die zur Rettung von Juden aufrief.
- Die Ursachen und Auswirkungen der verbreiteten Demoralisierung und Brutalität in der polnischen Gesellschaft während der Besatzungszeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beleuchtet zunächst die Debatte um die Rolle des polnischen Volkes im Holocaust, die durch das Buch "Nachbarn" von Jan Tomasz Gross im Jahr 2001 ausgelöst wurde. Das Buch beschreibt das Massaker an Juden in Jedwabne, das von polnischen Einwohnern ohne Anweisung der Besatzer verübt wurde. Der Text verdeutlicht, dass die Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht bei der Vernichtung der Juden in Polen weit verbreitet war, besonders auf dem Land. Die Darstellung des Verhaltens der polnischen Bevölkerung ist hier besonders drastisch und schildert die verbreiteten Morde, Denunziationen und Erpressungen von Juden.
Im weiteren Verlauf des Textes wird die Geschichte des Judenretters Stanisław Pokorski erzählt, der während der Besatzung Juden in seinem Dorf versteckte und durch Yad Vashem als "Gerechter unter den Völkern" ausgezeichnet wurde.
Der Fokus verlagert sich dann auf die Organisation "Żegota", die im besetzten Polen Juden half und deren Geschichte und Vorgehensweise in der Zeit der deutschen Besatzung dargestellt wird.
Schließlich wird die Persönlichkeit von Zofia Kossak-Szczucka, einer bekannten polnischen Schriftstellerin, beleuchtet. Sie war eine erklärte Antisemitin, die jedoch zur Rettung von Juden aufrief und sich aktiv in der Hilfe für Juden engagierte.
Die Geschichte von Zofia Kossak-Szczucka ist ein Beispiel für die Komplexität der polnischen Gesellschaft während der Besatzung und die Ambivalenz der damaligen Haltung gegenüber den Juden. Der Text geht auf die Gründe für die verbreitete Demoralisierung und Brutalität ein, die sich unter den Polen während der Zeit der deutschen Besatzung durchsetzte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Holocaust, Antisemitismus, Judenrettung, Kollaboration, Widerstand, "Żegota", Zofia Kossak-Szczucka, Demoralisierung, Brutalität, polnische Gesellschaft, deutsche Besatzung, Judenverfolgung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Zofia Kossak-Szczucka?
Sie war eine bekannte polnische Schriftstellerin, die trotz ihrer antisemitischen Ansichten die Organisation „Żegota“ zur Rettung von Juden während der NS-Besatzung gründete.
Was war die Organisation „Żegota“?
„Żegota“ war der Code-Name für das Hilfskomitee für Juden, die größte Organisation im besetzten Polen, die Juden vor der Vernichtung rettete.
Wie begründete Kossak-Szczucka ihre Hilfe für Juden?
Sie berief sich auf die christliche Nächstenliebe und die moralische Pflicht der Katholiken, Verbrechen zu verurteilen, auch wenn sie die Opfer als „politische Feinde“ betrachtete.
Welche Rolle spielte die polnische Bevölkerung auf dem Land?
Historische Forschungen (z.B. von Jan T. Gross) belegen Fälle von Kollaboration, Denunziation und Massakern (wie in Jedwabne) durch polnische Dorfbewohner an ihren jüdischen Nachbarn.
Warum hatten Judenretter Angst vor ihren Nachbarn?
Oft war die Angst vor Denunziation durch neidische oder feindselige polnische Nachbarn größer als die Angst vor den selten anwesenden deutschen Besatzern.
- Quote paper
- Gabriel Berger (Author), 2016, Die antisemitische Judenretterin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463421