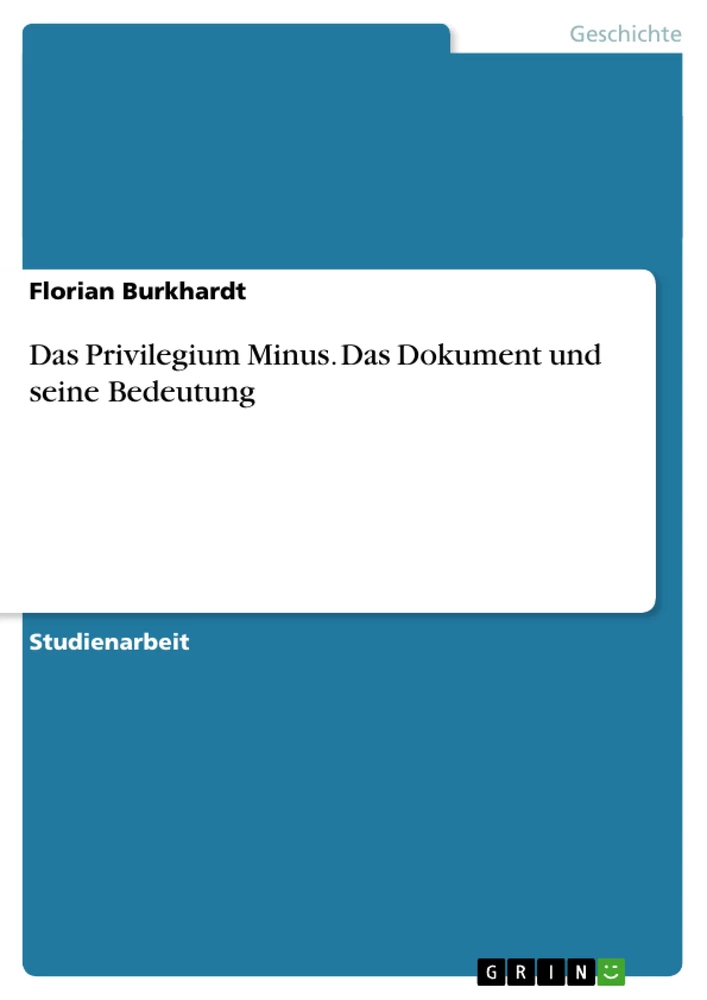Das Privilegium Minus wurde im Auftrag Kaiser Friedrichs I. für den ersten österreichischen Herzog Heinrich Jasomirgott am 17. September 1156 erstellt. Es ist die erste schriftliche Belehnungsurkunde eines deutschen Kaisers. Die Bestimmungen, die im Privilegium Minus schriftlich festgehalten sind, schlichten den Streit zwischen dem Welfen Heinrich dem Löwen und seinem babenbergischen Konkurrenten Heinrich Jasomirgott um das Herzogtum Bayern. Damit konnte der frisch gekrönte Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, den schwierigsten „innerdeutschen“ Machtkonflikt im Reiche lösen und hatte damit den Rücken frei für seine Italienpolitik. Das Privilegium Minus zeichnet aber vor allen Dingen aus, dass es Heinrich Jasomirgott ungewöhnliche Vorrechte als Herzog von Österreich gewährt. Damit trägt es zu einer Weiterentwicklung des Lehenrechtes bei, auf dem die Staatenwelt dieser Zeit fußt. Das Privilegium Minus ist daher auch ein Dokument für den sich wandelnden Umgang mit dem Lehenrecht und zeigt, dass sich unter Friedrich Barbarossa der neue Reichsfürstenstand herauszubilden beginnt. Gerade weil das Privilegium Minus so herausragend und ungewöhnlich erscheint, wurde von Historikern oft vermutet, dass es gefälscht oder interpoliert, also verfälscht,wurde. Heute gilt jedoch beides als widerlegt und die Echtheit wird nicht mehr angezweifelt. Die historische Bedeutung konnte das Privilegium Minus erst erlangen, nachdem das sog. Privilegium Maius definitiv als Fälschung enttarnt wurde. Diese Fälschung, wahrscheinlich entstanden unter Herzog Rudolf IV. von Habsburg in den Jahren 1358/59, verbrieft dem österreichischen Herzog noch umfangreichere Rechte (daher „Maius“). Zur Verifizierung wurde die originale Goldbulle des Minus benutzt und so kommt es, dass sie das einzige ist, das vom Minus noch erhalten ist. Überliefert wurde das Privilegium Minus in verschiedene Abschriften, von denen die wichtigste, weil vollständige, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts aus einer Sammelschrift der Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg stammt.
In dieser Arbeit soll nun auf das Dokument selbst eingegangen und versucht werden, es in den historischen Lauf einzubetten. Kapitel II wird die Entstehung des Konfliktes um das Herzogtum Bayern und deren Auswirkungen auf die Reichspolitik beleuchten. Anschließend, in Kapitel III, wird die Schlichtung durch Friedrich Barbarossa im Zentrum unserer Betrachtungen stehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entstehung des Streites um Bayern
- III. Friedrich löst die bayerische Frage
- IV. Das Privilegium Minus
- V. Die Bedeutung der Urkunde
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Privilegium Minus, eine im Jahr 1156 ausgestellte Urkunde Kaiser Friedrichs I. Barbarossas. Die Zielsetzung besteht darin, das Dokument im historischen Kontext zu verorten und seine Bedeutung für das Lehenrecht und die Entwicklung des Reichsfürstenstandes zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen den Welfen und den Babenbergers um Bayern und die Rolle des Privilegiums Minus bei dessen Beilegung.
- Der Konflikt um das Herzogtum Bayern zwischen den Welfen und den Babenbergers
- Die Rolle Kaiser Friedrichs I. Barbarossas bei der Lösung des Konflikts
- Der Inhalt und die rechtlichen Bestimmungen des Privilegium Minus
- Die Bedeutung des Privilegium Minus für die Entwicklung des Lehenrechts
- Die historische Authentizität und die Überlieferung des Privilegium Minus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Privilegium Minus ein, einer Urkunde Kaiser Friedrichs I., die den Streit um Bayern zwischen Heinrich dem Löwen und Heinrich Jasomirgott schlichtete und diesem außergewöhnliche Vorrechte als Herzog von Österreich gewährte. Sie betont die historische Bedeutung des Dokuments für die Entwicklung des Lehenrechts und den Aufstieg des Reichsfürstenstandes, widerlegt frühere Zweifel an seiner Echtheit und skizziert den Aufbau der Arbeit.
II. Entstehung des Streites um Bayern: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge des Konflikts um Bayern, beginnend mit der Königswahl Konrads III. im Jahr 1138. Der Konflikt entstand aus dem Machtkampf zwischen den Welfen, repräsentiert durch Heinrich den Stolzen, und den Staufern. Die Aberkennung der Herzogtümer Sachsen und Bayern von Heinrich dem Stolzen und deren Vergabe an andere Fürsten führte zu anhaltenden Auseinandersetzungen. Die Heiratspolitik Konrads III., die Gertrud, Witwe Heinrichs des Stolzen, mit Heinrich Jasomirgott verband, löste den Konflikt nur vorübergehend. Der Tod Gertruds und die erneuten Ansprüche der Welfen führten zu einem andauernden Streit, der erst unter Friedrich Barbarossa beigelegt wurde.
III. Friedrich löst die bayerische Frage: Kapitel III konzentriert sich auf die Schlichtung des bayerischen Konflikts durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Nach dem Tod Konrads III. erbte Friedrich den Konflikt. Die Darstellung fokussiert auf Friedrichs Fähigkeit, den langjährigen Streit zwischen den Welfen und Babenbergers zu beenden, um seine eigene Politik im Reich und in Italien effektiv voranzutreiben. Die hier beschriebenen Maßnahmen zeigen Friedrichs Geschick in der Konfliktlösung und seine strategische Nutzung des Privilegium Minus zur Konsolidierung seiner Macht.
IV. Das Privilegium Minus: Dieses Kapitel analysiert das Privilegium Minus selbst. Es beschreibt detailliert die im Dokument festgelegten Bestimmungen und erklärt deren rechtliche Implikationen. Die Analyse fokussiert auf die ungewöhnlichen Vorrechte, die Heinrich Jasomirgott gewährt wurden und die weitreichenden Konsequenzen für das österreichische Herzogtum und das Lehenrecht im Allgemeinen. Das Kapitel beleuchtet die juristische Präzision des Dokuments und seine Bedeutung als Grundlage für die weitere Entwicklung des österreichischen Herzogtums.
V. Die Bedeutung der Urkunde: Kapitel V befasst sich mit der historischen Bedeutung des Privilegium Minus. Es analysiert den Einfluss des Dokuments auf die Entwicklung des Lehenrechts und die Herausbildung des Reichsfürstenstandes unter Friedrich Barbarossa. Die Bedeutung des Privilegium Minus als Schlüsselfaktor für die Stärkung der Babenberger und die langfristigen Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Kaiser und Reichsfürsten werden eingehend diskutiert, vor allem im Hinblick auf die Herausbildung von Eigenständigkeit innerhalb des Reiches.
Schlüsselwörter
Privilegium Minus, Friedrich Barbarossa, Heinrich der Löwe, Heinrich Jasomirgott, Herzogtum Bayern, Lehenrecht, Reichsfürstenstand, Konfliktlösung, Österreich, Goldbulle, mittelalterliches Recht.
Häufig gestellte Fragen zum Privilegium Minus
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Privilegium Minus, eine Urkunde Kaiser Friedrichs I. Barbarossas aus dem Jahr 1156. Sie analysiert das Dokument im historischen Kontext und beleuchtet dessen Bedeutung für das Lehenrecht und die Entwicklung des Reichsfürstenstandes.
Welchen Konflikt behandelt das Privilegium Minus?
Das Privilegium Minus behandelt den langjährigen Konflikt um das Herzogtum Bayern zwischen den Welfen (repräsentiert durch Heinrich den Löwen) und den Babenbergers (repräsentiert durch Heinrich Jasomirgott).
Welche Rolle spielte Kaiser Friedrich I. Barbarossa?
Kaiser Friedrich I. Barbarossa spielte eine entscheidende Rolle bei der Beilegung des Konflikts um Bayern. Er nutzte das Privilegium Minus strategisch, um den Streit zu schlichten und seine eigene Macht im Reich zu konsolidieren.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: den Konflikt um Bayern zwischen den Welfen und Babenbergers, die Rolle Kaiser Friedrichs I. Barbarossas, den Inhalt und die rechtlichen Bestimmungen des Privilegium Minus, die Bedeutung des Privilegium Minus für die Entwicklung des Lehenrechts, sowie die historische Authentizität und Überlieferung des Dokuments.
Was sind die wichtigsten Inhalte des Privilegium Minus?
Das Privilegium Minus gewährte Heinrich Jasomirgott, Herzog von Österreich, außergewöhnliche Vorrechte. Die Arbeit analysiert detailliert die im Dokument festgelegten Bestimmungen und deren rechtliche Implikationen für das österreichische Herzogtum und das Lehenrecht im Allgemeinen.
Welche Bedeutung hat das Privilegium Minus für die Entwicklung des Lehenrechts?
Das Privilegium Minus hatte einen weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung des Lehenrechts und die Herausbildung des Reichsfürstenstandes. Es wird analysiert, wie das Dokument die Stärkung der Babenberger und das Verhältnis zwischen Kaiser und Reichsfürsten beeinflusste, insbesondere im Hinblick auf die Herausbildung von Eigenständigkeit innerhalb des Reiches.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Entstehung des Streites um Bayern, Friedrich löst die bayerische Frage, Das Privilegium Minus, Die Bedeutung der Urkunde und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privilegium Minus, Friedrich Barbarossa, Heinrich der Löwe, Heinrich Jasomirgott, Herzogtum Bayern, Lehenrecht, Reichsfürstenstand, Konfliktlösung, Österreich, Goldbulle, mittelalterliches Recht.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit dem Privilegium Minus auf strukturierte und professionelle Weise.
- Citation du texte
- Florian Burkhardt (Auteur), 2004, Das Privilegium Minus. Das Dokument und seine Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46347