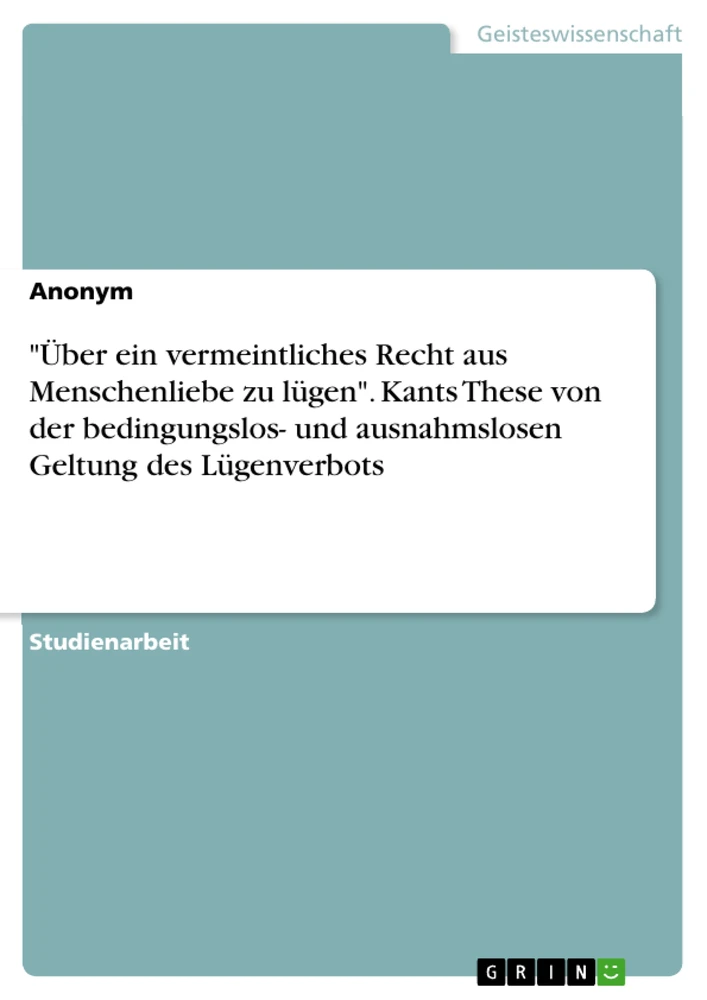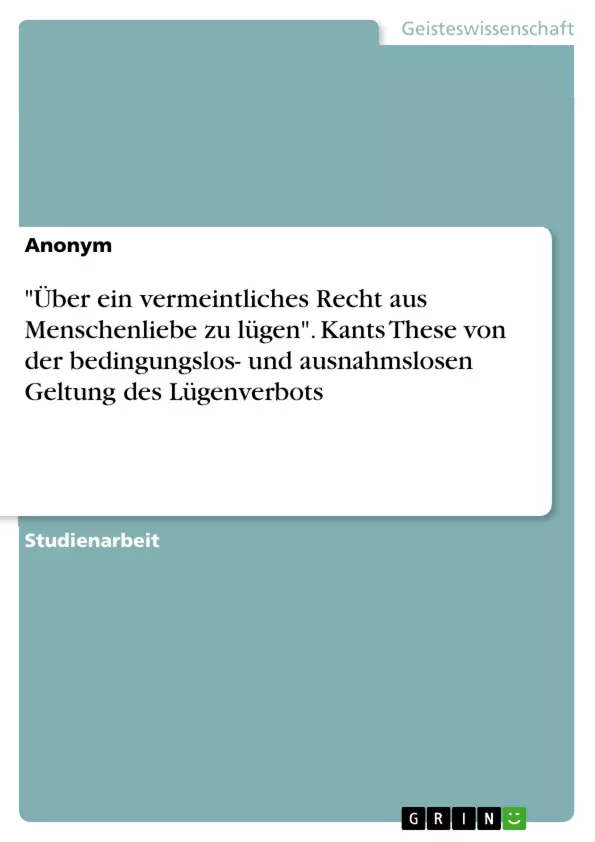Dass mit dem Lügen stets negative Gedanken assoziiert werden, stellt kein neues Phänomen dar. Die Verachtung der Lüge ist tief in der Gesellschaft verankert und besonders in der Philosophie präsent. Die Philosophie beschäftigt sich mit der Wahrheitsfindung, sodass sich die Lüge diesem Ziel entgegensetzt. Es wird einem quasi in die Wiege gelegt, dass man nicht lügen sollte und jede Lüge irgendwann ans Licht kommt und einem das Leben schwer macht. Dies veranschaulicht sogar die Kinderbuchfigur „Pinocchio“, dessen Nase bei jeder Lüge unmaßstäblich wächst.
Doch was ist die Lüge überhaupt? Gilt ein bloßes Verschweigen einer Tatsache bereits als Lüge? Wie verhält es sich mit einer Höflichkeits- oder Notlüge? Es wird kaum einen Menschen geben, der in seinem Leben noch nie auf eine Lüge zurückgegriffen hat. Sei es um einer unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen, sich besser darzustellen oder sogar um jemanden zu beschützen.
So wirft Ghandi die These in den Raum, dass : „Gutes niemals aus Lüge und Gewalt entstehen kann“. Entspricht dies der Wahrheit? Können mit einer Lüge lediglich negative Ziele verfolgt werden, die stets der Gesellschaft auf irgendeiner Weise Schaden zufügen? James Joyce widerspricht dem, denn „Der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit“.
Ich werde mich im Folgenden anhand des Aufsatzes „Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen“ von Immanuel Kant damit beschäftigen, was eine Lüge darstellt und ob es in bestimmten Fällen sogar gerechtfertigt ist, sich einer Lüge zu bedienen oder ob stets und ausnahmslos das Lügenverbot gilt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen - Ausgangssituation
- 1. Constants Lösung
- 2. Kants Lösung
- 3. Problematik
- III. Kantische Begriffserklärungen
- 1. Wahrhaftigkeit
- 2. Lüge
- IV. Kants Begründung für das absolute Lügenverbot
- 1. Unbrauchbarkeit der Rechtsquelle
- 2. Verletzung des Menschheitsrechts
- 3. Folgen der Lüge für den Lügner vor Gericht
- 4. Die gutmütige Lüge
- V. Kritik an Constants Vorschlag des Bedingten Lügenverbots als mittlerer Grundsatz
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz „Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen“ von Immanuel Kant setzt sich kritisch mit der These von Benjamin Constant auseinander, dass ein uneingeschränktes Lügenverbot unpraktikabel und gesellschaftsschädigend sei. Kant verteidigt die unbedingte Gültigkeit des Lügenverbots und untersucht die Konsequenzen einer möglichen Ausnahmeregelung in bestimmten Situationen.
- Die unbedingte Gültigkeit des Lügenverbots
- Die Problematik der Lüge als Verletzung des Menschheitsrechts
- Die Folgen der Lüge für den Lügner vor Gericht
- Die Kritik an Constants Theorie des bedingten Lügenverbots
- Die Anwendung von Kants Prinzipien auf realistische Szenarien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Lüge und deren gesellschaftliche Verankerung dar. Im zweiten Kapitel wird die Ausgangssituation des Aufsatzes skizziert, die sich aus Constants Argumentation für ein bedingtes Lügenverbot ergibt. Die Kapitel 3 und 4 gehen auf Kants Definitionen von Wahrhaftigkeit und Lüge sowie seine Argumentation für das absolute Lügenverbot ein. Im fünften Kapitel analysiert Kant die Problematik von Constants Vorschlag des bedingten Lügenverbots als mittleren Grundsatz und zeigt die potenziellen Gefahren auf, die sich aus solchen Ausnahmen ergeben könnten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Aufsatzes umfassen das absolute Lügenverbot, die Wahrhaftigkeit, das Menschheitsrecht, das Recht auf Wahrheit, die Kritik an Constant und die Folgen der Lüge für den Lügner.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, "Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen". Kants These von der bedingungslos- und ausnahmslosen Geltung des Lügenverbots, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463555