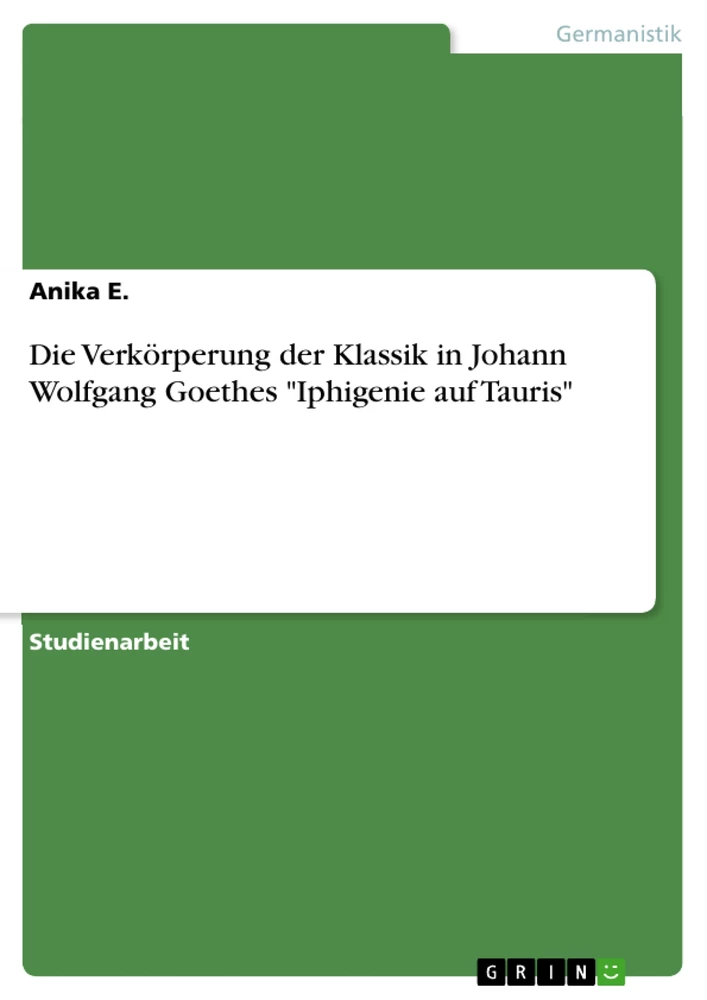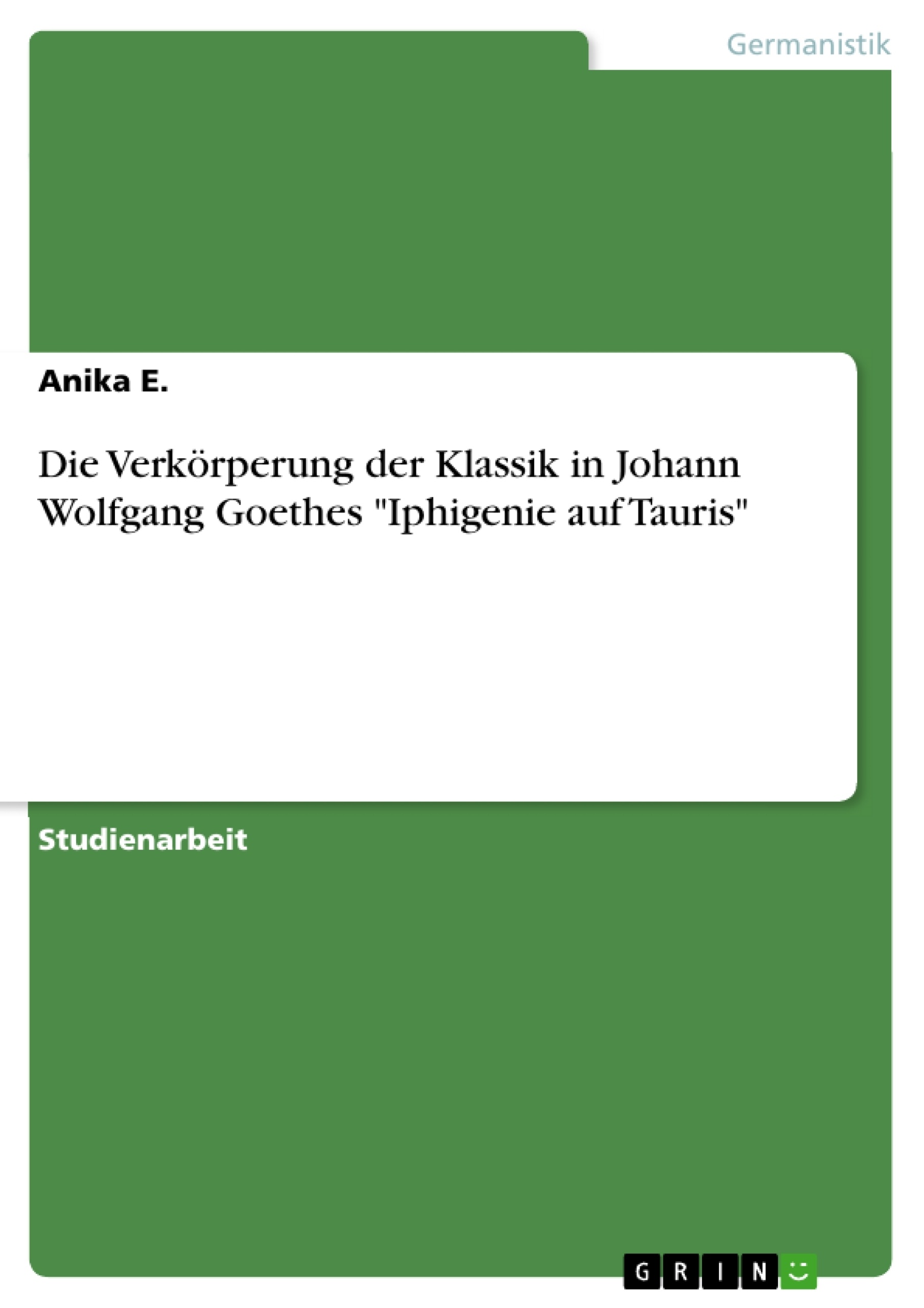Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und Friedrich Schiller (1759-1805) gelten als zwei der größten Dichter der deutschen Sprache. Während der Schulzeit kommt kein Schüler darum herum, diese beiden Persönlichkeiten kennen zu lernen. Noch heute werden durch viele Denkmäler, Theateraufführungen, Bücher, Gemälde, Filme und Namensgebungen von Straßen oder Gebäuden an sie und ihre geschaffenen Werke erinnert. Sie gelten als Meilenstein der deutschen Literatur und werden in vielen Ländern dieser Welt für ihr Schaffen verehrt. Ihre unzähligen Werke sind bis heute sehr bekannt und man kann sagen, dass durch die Dichter Goethe und Schiller Deutschland ein großes Kulturgut erhalten hat.
Obwohl Goethe und Schiller vor allem in den Epochen des Sturm und Drang und der Romantik gearbeitet haben, sagt unter anderem Volker C. Dörr, dass nicht zu Letzt Goethes Iphigenie auf Tauris, die schon 1776 in Rom fertiggestellt wurde, nicht zu Unrecht als eines der klassischen Dramen schlechthin gilt. Doch warum ist das so? Was macht dieses Werk zu einem klassischen Drama und was genau ist die Klassik, da sie als Epoche beinahe parallel zur Romantik verläuft? Vor allem der Hauptfigur, Iphigenie, wird nachgesagt, dass sie die klassischen Ideale in sich vereint. In meiner Hausarbeit untersuche ich, inwieweit die Kriterien der Klassik in Goethes Iphigenie auf Tauris zu finden sind. Dabei werde ich mich in erster Linie auf die Versfassung dieses Werkes von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1787 beziehen. Dieses Schauspiel und die zusätzlich verwendete Literatur kann in meiner Literaturliste nachvollzogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Klassik
- 1.1 Der Begriff der Klassik
- 1.2 Klassik als Epoche
- 1.2.1 historischer Kontext zur Epoche der Klassik
- 1.3 Vergleich Romantik und Klassik
- 2. Humanität und der klassische Mensch für Goethe
- 3. Die Klassik in der Iphigenie auf Tauris
- 3.1 kurze inhaltliche Gliederung des Werkes
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Kriterien der Klassik in Johann Wolfgang von Goethes "Iphigenie auf Tauris" zu finden sind. Dabei wird insbesondere die Versfassung des Werkes aus dem Jahr 1787 untersucht.
- Der Begriff der Klassik und seine verschiedenen Gebrauchsformen
- Die Klassik als Epoche und ihre historische Einordnung
- Vergleich der Klassik mit der Romantik
- Die Rolle der Humanität und des klassischen Menschen in Goethes Werk
- Analyse der "Iphigenie auf Tauris" im Hinblick auf ihre klassizistischen Elemente
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller als bedeutende deutsche Dichter heraus. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Goethes "Iphigenie auf Tauris" als ein klassisches Drama gilt und welche Merkmale der Klassik in diesem Werk zu finden sind. Der Fokus der Hausarbeit liegt auf der Analyse der klassischen Elemente in der 1787er Fassung von Goethes "Iphigenie auf Tauris".
1. Klassik
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Klassik aus verschiedenen Perspektiven. Es werden die drei Gebrauchsformen der Klassik (historische, normative, Epochenbegriff) erläutert und der historische Kontext der Epoche der Klassik im 18. Jahrhundert beleuchtet.
2. Humanität und der klassische Mensch für Goethe
Dieser Abschnitt behandelt die Rolle der Humanität und des klassischen Menschen in Goethes Werk. Es wird untersucht, welche Bedeutung diese Konzepte für das Verständnis von Goethes "Iphigenie auf Tauris" haben.
3. Die Klassik in der Iphigenie auf Tauris
Dieses Kapitel analysiert Goethes "Iphigenie auf Tauris" im Hinblick auf ihre klassizistischen Elemente. Es wird eine kurze inhaltliche Gliederung des Werkes gegeben und die zentralen Figuren und Handlungselemente betrachtet.
Schlüsselwörter
Klassik, Epoche, Antike, Humanität, klassischer Mensch, Johann Wolfgang von Goethe, "Iphigenie auf Tauris", Drama, Vergleich, Romantik, historischer Kontext, Weimarer Klassik
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt „Iphigenie auf Tauris“ als Werk der Weimarer Klassik?
Das Drama verkörpert die klassischen Ideale von Humanität, Ausgeglichenheit und sittlicher Läuterung, die zentral für die Epoche von Goethe und Schiller waren.
Was bedeutet der Begriff „Humanität“ bei Goethe?
Humanität bezeichnet die Erziehung des Menschen zu wahrer Menschlichkeit, Vernunft und moralischer Integrität, wie sie Iphigenie durch ihre Aufrichtigkeit zeigt.
Wie unterscheidet sich die Klassik von der Romantik?
Während die Klassik nach Ordnung, Maß und objektiven Idealen strebt, betont die Romantik das Subjektive, das Fantastische und die Sehnsucht nach dem Unendlichen.
Welche Rolle spielt die Antike in Goethes Drama?
Goethe greift auf einen antiken Stoff zurück, transformiert ihn jedoch im Sinne der Aufklärung und Klassik: Nicht mehr das Schicksal regiert, sondern die Freiheit des moralischen Handelns.
Warum ist die Versfassung von 1787 so bedeutend?
Die Übertragung in den Blankvers verlieh dem Werk die harmonische Form und sprachliche Eleganz, die es zum Musterbeispiel des klassischen Dramas machten.
- Arbeit zitieren
- Anika E. (Autor:in), 2018, Die Verkörperung der Klassik in Johann Wolfgang Goethes "Iphigenie auf Tauris", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463604