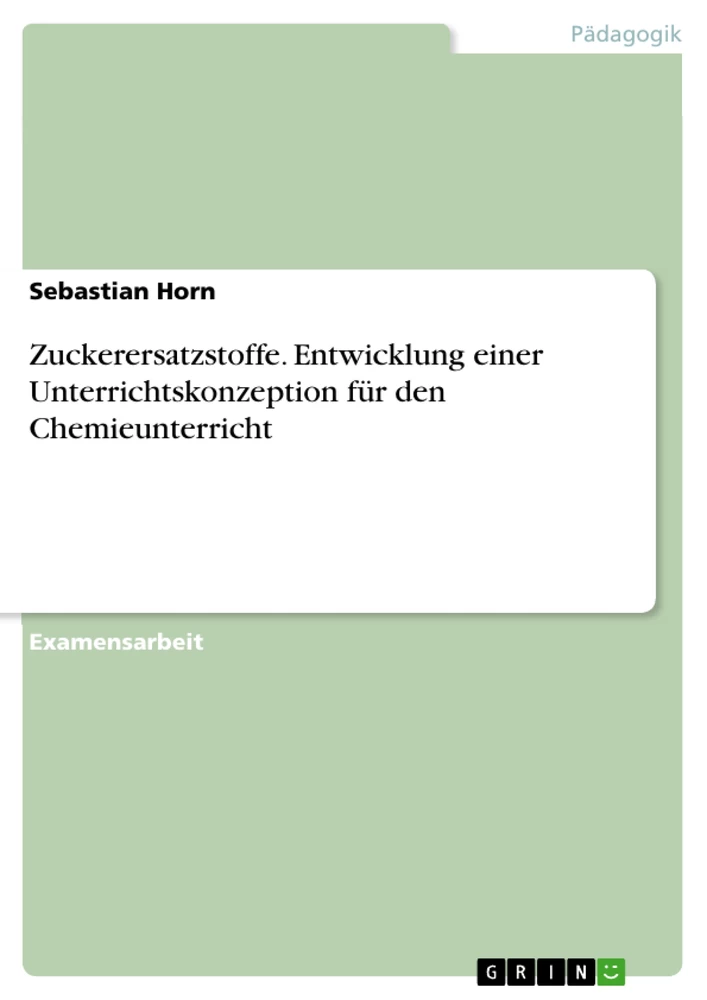Zuckerersatzstoffe sind eine Gruppe von Lebensmittelzusatzstoffen, welche in modernen Lebensmitteln eine wichtige Rolle spielen. Sie sollen unter anderem die Akzeptanz von Lebensmitteln beim Verbraucher sicherstellen, werden aber bezüglich ihrer physiologischen Auswirkungen auch kontrovers diskutiert. Zuckerersatzstoffe können unter verschiedenen Aspekten im Chemieunterricht behandelt werden.
Die Arbeit bietet ein vollständiges Unterrichtskonzept zu diesem Thema für die Klassenstufe 10 nach sächsischen Lehrplan mit ausgearbeiteten Arbeitsmaterialien und Lösungserwartungen. Leider wurde im Nachhinein festgestellt, dass der Rojahntest für Aspartam bei Durchführung nach Versuchsvorschrift nur scheinbar, aufgrund sich verändernder Löslichkeiten während des Zutropfens von Natronlauge, positiv ausfällt und eher nicht durchgeführt werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie wird ein Stoff als süß wahrgenommen?
- 3. Süßstoffe
- 3.1 Acesulfam-K (E950)
- 3.2 Aspartam (E 951)
- 3.3 Cyclamat (E 952)
- 3.4 Saccharin (E 954)
- 3.5 Sucralose (E955)
- 3.6 Thaumatin (E 957)
- 3.7 Neohesperidin-Dihydrochalkon (E 959)
- 3.8 Steviolglycoside (E 960)
- 3.9 Neotam (E 961)
- 3.10 Aspartam-Acesulfam-Salz (E 962)
- 3.11 Advantam (E 969)
- 4. Zuckeraustauschstoffe
- 5. Didaktische Grundlagen
- 5.1 Didaktische Analyse
- 5.2 Bezug zum Lehrplan in Sachsen für Gymnasien
- 5.3 Stationenlernen
- 6. Entwicklung und Optimierung der Experimente
- 6.1 Rojahntest
- 6.2 DNPH-Test
- 6.3 BTB-Test
- 6.4 Cernitrattest
- 6.5 Fehling-Test auf Aldehyde
- 6.6 Nachweis von Stickstoff in Saccharin und Cyclamat
- 6.7 Nachweis von Aspartam mit Ninhydrin
- 6.8 Nachweis von Schwefel in Cyclamat und Saccharin
- 6.9 Hygroskopische Eigenschaften von Zuckerersatzstoffen
- 6.10 Backbeständigkeit
- 6.11 Lösungswärme von Xylitol und Erythritol
- 6.12 Nachweis der in Aspartam enthaltenen Aminosäuren
- 6.13 Warum wirken Zuckeralkohole abführend
- 6.14 Nachweis von Saccharin mit Resorcin
- 6.15 Oxidation der Zuckeralkohole und Nachweis der entstandenen Zucker mit dem Fehling-Test
- 6.16 Komplexbildung mit Kupfersulfat
- 6.17 Modellexperiment zur Erklärung, warum zuckerfreie Kaugummis zahnschonend sind
- 6.18 Saccharinschmuggel
- 7. Optimierte Versuchsvorschriften
- 8. Darstellung des Gesamtkonzepts
- 8.1 Einführung: Unterscheidung von Zucker und Zuckerersatzstoffen
- 8.2 Weiterführende Bearbeitung
- 8.2.1 Station A: Aufbau von Aspartam
- 8.2.2 Station B: Physiologische Wirkungen der Zuckeralkohole
- 8.2.3 Station C: Sind Süßstoffe gefährlich
- 8.2.4 Station D: Produktentwicklung
- 8.2.5 Station E: Saccharin als Schmuggelware
- 8.3 Zusammenfassung
- 9. Arbeitsmaterialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit entwickelt eine Unterrichtskonzeption zum Thema Zuckerersatzstoffe für den Chemieunterricht. Ziel ist es, Schülern ein vertieftes Verständnis der chemischen Eigenschaften und der physiologischen Wirkung verschiedener Zuckerersatzstoffe zu vermitteln. Die Konzeption beinhaltet praktische Experimente zur Untersuchung dieser Stoffe.
- Chemische Eigenschaften verschiedener Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe
- Unterschiede zwischen Zucker und Zuckerersatzstoffen
- Physiologische Wirkungen von Zuckeralkoholen und Süßstoffen
- Didaktische Konzeption und Umsetzung im Chemieunterricht
- Experimentelle Untersuchung von Zuckerersatzstoffen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Zuckerersatzstoffe ein und beschreibt die Relevanz des Themas für den Chemieunterricht. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und die gewählte Methodik.
2. Wie wird ein Stoff als süß wahrgenommen?: Dieses Kapitel befasst sich mit den sensorischen und physiologischen Mechanismen der Wahrnehmung von Süße. Es erklärt den Prozess der Süßstoffbindung an Rezeptoren und die damit verbundenen Signalwege.
3. Süßstoffe: Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen künstlichen Süßstoffen, darunter ihre chemischen Strukturen, Herstellungsverfahren und Anwendungen. Jeder Unterabschnitt (3.1-3.11) beschreibt einen einzelnen Süßstoff mit seinen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten. Die Kapitel beleuchten sowohl die Vorteile als auch mögliche Nachteile und diskutieren die jeweilige Bedeutung im Kontext des Themas.
4. Zuckeraustauschstoffe: Dieses Kapitel untersucht Zuckeraustauschstoffe, ihre chemischen Eigenschaften und ihren Einsatz als Zuckerersatz. Es beleuchtet Unterschiede zu den künstlichen Süßstoffen und deren Verwendung in verschiedenen Produkten.
5. Didaktische Grundlagen: Hier werden die didaktischen Grundlagen der entwickelten Unterrichtskonzeption erläutert. Es wird eine didaktische Analyse durchgeführt, der Bezug zum sächsischen Lehrplan hergestellt und die Methode des Stationenlernens begründet.
6. Entwicklung und Optimierung der Experimente: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Optimierung der Experimente, die in der Unterrichtskonzeption verwendet werden. Es werden verschiedene Nachweisreaktionen und Untersuchungen zu den Eigenschaften der Zuckerersatzstoffe detailliert vorgestellt und deren didaktische Eignung diskutiert. Die einzelnen Unterkapitel (6.1-6.18) beschreiben die einzelnen Experimente mit ihren jeweiligen Zielen und methodischen Vorgehensweisen.
7. Optimierte Versuchsvorschriften: Die Kapitel 7 präsentiert die optimierten Versuchsanleitungen für die im Kapitel 6 beschriebenen Experimente. Es wird ein detaillierter Überblick über die Durchführung der Experimente gegeben und auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen. Die einzelnen Unterkapitel (7.1-7.14) liefern präzise Anweisungen für die praktische Durchführung.
8. Darstellung des Gesamtkonzepts: Dieser Abschnitt stellt das Gesamtkonzept der Unterrichtskonzeption vor. Es wird eine Einführung in die Unterscheidung von Zucker und Zuckerersatzstoffen gegeben, gefolgt von detaillierten Beschreibungen der einzelnen Stationen des Stationenlernens. Die Kapitel beschreiben die Lernziele und den Ablauf jeder Station (8.2.1-8.2.5). Das Kapitel 8.3 bietet eine Zusammenfassung des gesamten Konzepts.
Schlüsselwörter
Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, Chemieunterricht, Didaktik, Experimente, Acesulfam-K, Aspartam, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, Thaumatin, Neohesperidin-Dihydrochalkon, Steviolglycoside, Neotam, Aspartam-Acesulfam-Salz, Advantam, Nachweisreaktionen, physiologische Wirkung, Lehrplan Sachsen, Stationenlernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtskonzeption: Zuckerersatzstoffe
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit entwickelt eine umfassende Unterrichtskonzeption zum Thema Zuckerersatzstoffe für den Chemieunterricht. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Erläuterung der Wahrnehmung von Süße, detaillierte Informationen zu verschiedenen Süßstoffen (Acesulfam-K, Aspartam, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, Thaumatin, Neohesperidin-Dihydrochalkon, Steviolglycoside, Neotam, Aspartam-Acesulfam-Salz, Advantam) und Zuckeraustauschstoffen, didaktische Grundlagen (inkl. Bezug zum sächsischen Lehrplan und Stationenlernen), die Entwicklung und Optimierung von Experimenten zum Nachweis und zur Untersuchung der Eigenschaften von Zuckerersatzstoffen, optimierte Versuchsvorschriften und schließlich die Darstellung des Gesamtkonzepts mit verschiedenen Lernstationen. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Süßstoffe werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Süßstoffe ausführlich: Acesulfam-K (E950), Aspartam (E 951), Cyclamat (E 952), Saccharin (E 954), Sucralose (E955), Thaumatin (E 957), Neohesperidin-Dihydrochalkon (E 959), Steviolglycoside (E 960), Neotam (E 961), Aspartam-Acesulfam-Salz (E 962) und Advantam (E 969). Für jeden Süßstoff werden chemische Eigenschaften, Herstellungsverfahren und Anwendungsmöglichkeiten beschrieben.
Welche Experimente werden in der Unterrichtskonzeption vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt zahlreiche Experimente zur Untersuchung von Zuckerersatzstoffen, darunter: Rojahntest, DNPH-Test, BTB-Test, Cernitrattest, Fehling-Test auf Aldehyde, Nachweis von Stickstoff in Saccharin und Cyclamat, Nachweis von Aspartam mit Ninhydrin, Nachweis von Schwefel in Cyclamat und Saccharin, Untersuchung der hygroskopischen Eigenschaften, Backbeständigkeit, Lösungswärme von Xylitol und Erythritol, Nachweis der in Aspartam enthaltenen Aminosäuren, Erklärung der abführenden Wirkung von Zuckeralkoholen, Nachweis von Saccharin mit Resorcin, Oxidation der Zuckeralkohole und Nachweis der entstandenen Zucker mit dem Fehling-Test, Komplexbildung mit Kupfersulfat und ein Modellexperiment zur Zahnschonung zuckerfreier Kaugummis. Die Experimente sind detailliert beschrieben und didaktisch aufbereitet.
Wie ist die didaktische Konzeption aufgebaut?
Die didaktische Konzeption basiert auf dem Stationenlernen. Sie beinhaltet eine didaktische Analyse, einen Bezug zum Lehrplan in Sachsen für Gymnasien und detaillierte Beschreibungen der einzelnen Lernstationen, die sich mit dem Aufbau von Aspartam, den physiologischen Wirkungen der Zuckeralkohole, der Gefährlichkeit von Süßstoffen, Produktentwicklung und Saccharin als Schmuggelware befassen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Schülern ein vertieftes Verständnis der chemischen Eigenschaften und der physiologischen Wirkung verschiedener Zuckerersatzstoffe zu vermitteln. Dies soll durch eine praxisorientierte Unterrichtskonzeption mit experimentellen Untersuchungen erreicht werden. Die Schüler sollen die Unterschiede zwischen Zucker und Zuckerersatzstoffen verstehen lernen.
Wo finde ich die optimierten Versuchsanleitungen?
Die optimierten Versuchsanleitungen für die beschriebenen Experimente sind im Kapitel 7 der Arbeit detailliert aufgeführt. Die Anleitungen beinhalten präzise Durchführungshinweise und Hinweise auf mögliche Fehlerquellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, Chemieunterricht, Didaktik, Experimente, Acesulfam-K, Aspartam, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, Thaumatin, Neohesperidin-Dihydrochalkon, Steviolglycoside, Neotam, Aspartam-Acesulfam-Salz, Advantam, Nachweisreaktionen, physiologische Wirkung, Lehrplan Sachsen, Stationenlernen.
- Quote paper
- Sebastian Horn (Author), 2019, Zuckerersatzstoffe. Entwicklung einer Unterrichtskonzeption für den Chemieunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463748