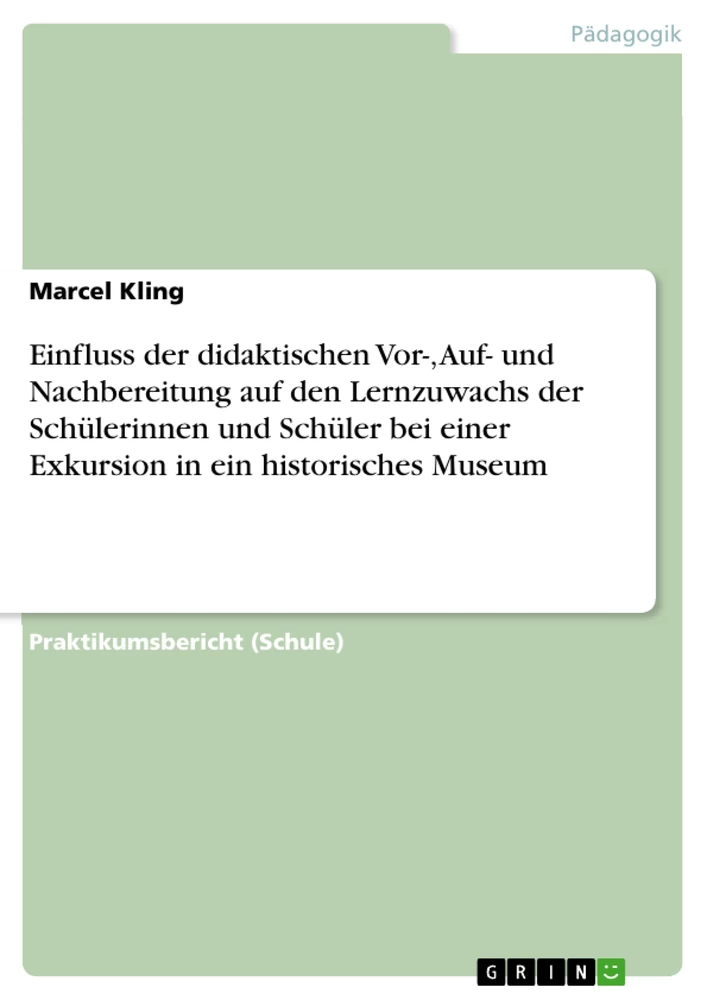In aller Regel werden Schüler im Verlauf ihrer Schullaufbahn mehrfach im Rahmen von Exkursionen ins Museum geführt. Das gilt nicht zuletzt für das Fach Geschichte, das für Schüler gerade dann interessant wird, wenn es gegenständliche Quellen in den Fokus rückt. Darin, dass sich das Museum als außerschulischer Lernort für das historische Lernen im Fach Geschichte grundsätzlich eignet, ist sich die Forschung weitestgehend einig. Pleitner definiert vier Gruppen, in die sich außerschulische Lernorte unterscheiden lassen und nennt dabei auch Stätten der Sammlung, Erforschung und Präsentation historischer Zeugnisse. Zu dieser Kategorie zählt er das Museum. Ebenso nennt Pleitner Historische Orte, die solche sind, an denen historische Ereignisse tatsächlich stattfanden und sich noch Überreste von Bauten finden lassen. Auch Kuchler grenzt das Museum vom historischen Ort ab, gesteht ihm aber dennoch zu, ein Ort des historischen Lernens zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pädagogische Situation
- Beschreibung des Unterrichtsvorhabens
- Sachanalyse
- Luftbrücke über Berlin
- Mauerbau in Berlin
- Didaktisch-Methodische Analyse
- Projektverlauf
- Stundenverlaufsplan
- Methode der Datenerhebung und Durchführung des Projekts
- Sachanalyse
- Auswertung
- Diskussion
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Studienprojekt untersucht den Einfluss der didaktischen Vor-, Auf- und Nachbereitung von Exkursionen in historische Museen auf den Lernzuwachs von Schülerinnen und Schülern. Es fokussiert auf die Frage, welche Lerneffekte sich durch eine strukturierte Herangehensweise erzielen lassen.
- Der Einfluss von didaktischer Vorbereitung auf das Verständnis historischer Inhalte.
- Die Rolle der methodischen Gestaltung des Museumsbesuchs für den Lernerfolg.
- Die Wirkung der Nachbereitung auf die Wissensverankerung und den nachhaltigen Lernzuwachs.
- Die Analyse der Schüleraktivität und -beteiligung im Kontext des Museumsbesuchs.
- Die Bewertung der Effektivität verschiedener didaktischer Ansätze im außerschulischen Lernkontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Museumsexkursionen im Geschichtsunterricht und die kontroverse Diskussion um deren didaktische Einbettung. Sie verweist auf die Notwendigkeit einer strukturierten Vor-, Während- und Nachbereitung des Museumsbesuchs, um einen effektiven Lernprozess zu gewährleisten und die Gefahr eines bloßen "Unterhaltungsausflugs" zu vermeiden. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss einer solchen didaktischen Rahmung auf den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt.
Pädagogische Situation: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext des Studienprojekts, das im Rahmen eines Praxissemesters an einem Gymnasium durchgeführt wurde. Es charakterisiert den Geschichtsgrundkurs der Q1, seine Lerngruppe (20 Schüler), deren Leistungsstand und Motivation. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der geringen Lernmotivation und der oberflächlichen Auseinandersetzung der Schüler mit den Unterrichtsinhalten ergeben. Die Beschreibung der pädagogischen Ausgangssituation dient als Grundlage für die Bewertung der Ergebnisse des Studienprojekts.
Beschreibung des Unterrichtsvorhabens: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das durchgeführte Unterrichtsprojekt, einschließlich der Sachanalyse (z.B. Luftbrücke und Mauerbau in Berlin), der didaktisch-methodischen Analyse und dem Projektverlauf. Es skizziert den Stundenverlaufsplan und die gewählte Methode der Datenerhebung. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der konkreten Maßnahmen zur didaktischen Vor-, Während- und Nachbereitung der Exkursion ins Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Der Einsatz von Gruppenarbeiten, expliziten Aufgabenstellungen und Portfolios zur Dokumentation der Lernergebnisse wird erläutert.
Schlüsselwörter
Museumsexkursion, Geschichtsunterricht, Didaktik, Lernzuwachs, Schüleraktivierung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, methodische Gestaltung, außerschulischer Lernort, Haus der Geschichte Bonn, historische Kompetenz, Lernmotivation.
Häufig gestellte Fragen zum Studienprojekt: Didaktische Rahmung von Museumsexkursionen
Was ist der Gegenstand des Studienprojekts?
Das Studienprojekt untersucht den Einfluss der didaktischen Vor-, Auf- und Nachbereitung von Exkursionen in historische Museen auf den Lernzuwachs von Schülerinnen und Schülern. Es konzentriert sich auf die Frage, welche Lerneffekte sich durch eine strukturierte Herangehensweise erzielen lassen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit fokussiert auf den Einfluss der didaktischen Vorbereitung auf das Verständnis historischer Inhalte, die Rolle der methodischen Gestaltung des Museumsbesuchs für den Lernerfolg, die Wirkung der Nachbereitung auf die Wissensverankerung und den nachhaltigen Lernzuwachs, die Analyse der Schüleraktivität und -beteiligung im Kontext des Museumsbesuchs sowie die Bewertung der Effektivität verschiedener didaktischer Ansätze im außerschulischen Lernkontext.
Wie ist das Studienprojekt aufgebaut?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, die die Bedeutung von Museumsexkursionen und die Notwendigkeit einer strukturierten didaktischen Rahmung beleuchtet. Es folgt ein Kapitel zur pädagogischen Situation (Kontext, Lerngruppe, Herausforderungen). Der Hauptteil beschreibt das Unterrichtsvorhaben detailliert, inklusive Sachanalyse (Luftbrücke, Mauerbau), didaktisch-methodischer Analyse, Projektverlauf (Stundenverlaufsplan, Datenerhebung), und Auswertung mit Diskussion. Schließlich enthält es ein Quellen- und Literaturverzeichnis und Schlüsselwörter.
Welche konkreten Maßnahmen zur didaktischen Vor-, Während- und Nachbereitung wurden eingesetzt?
Das Kapitel "Beschreibung des Unterrichtsvorhabens" beschreibt detailliert die konkreten Maßnahmen zur didaktischen Vor-, Während- und Nachbereitung der Exkursion ins Haus der Geschichte in Bonn. Genannt werden der Einsatz von Gruppenarbeiten, expliziten Aufgabenstellungen und Portfolios zur Dokumentation der Lernergebnisse.
Wo wurde das Studienprojekt durchgeführt?
Das Studienprojekt wurde im Rahmen eines Praxissemesters an einem Gymnasium durchgeführt, mit einem Geschichtsgrundkurs der Q1 (20 Schüler).
Welche konkreten historischen Themen wurden behandelt?
Die Sachanalyse des Projekts fokussiert auf die Luftbrücke und den Mauerbau in Berlin.
Welche Methoden zur Datenerhebung wurden verwendet?
Die Methode der Datenerhebung wird im Kapitel "Beschreibung des Unterrichtsvorhabens" erläutert (genaue Methode wird im Dokument spezifiziert).
Welche Ergebnisse werden diskutiert?
Die Ergebnisse des Studienprojekts und deren Diskussion werden im Kapitel "Auswertung" präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Studienprojekt am besten?
Schlüsselwörter sind: Museumsexkursion, Geschichtsunterricht, Didaktik, Lernzuwachs, Schüleraktivierung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, methodische Gestaltung, außerschulischer Lernort, Haus der Geschichte Bonn, historische Kompetenz, Lernmotivation.
- Quote paper
- Marcel Kling (Author), 2018, Einfluss der didaktischen Vor-, Auf- und Nachbereitung auf den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler bei einer Exkursion in ein historisches Museum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463750