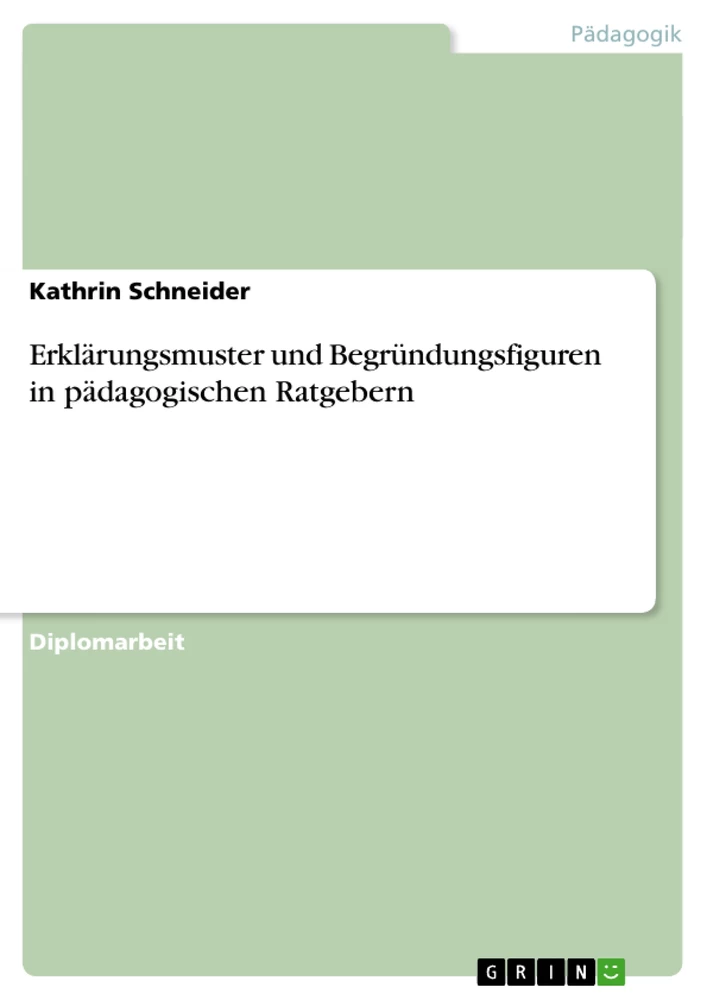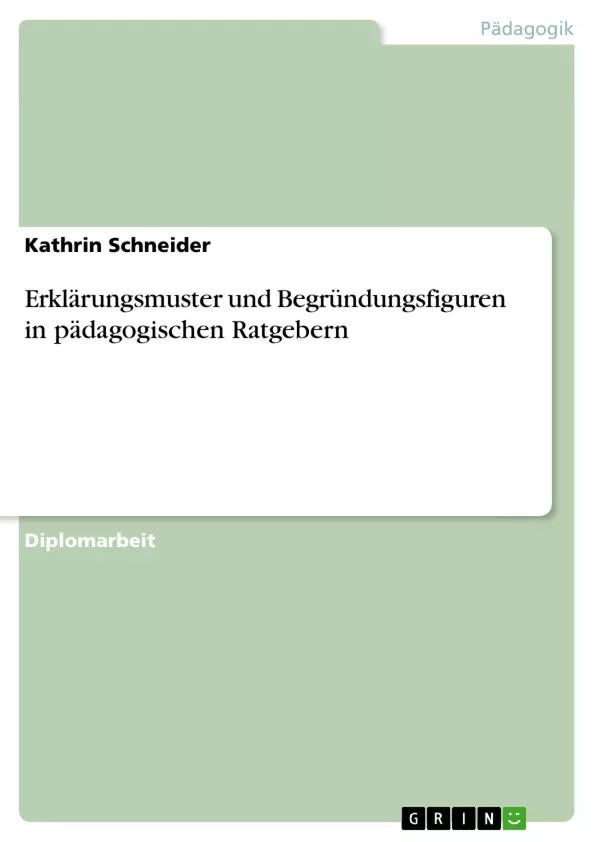Im Kapitel (B) ‚Ratgeber’ soll zu Beginn dieser Arbeit eine kurze literarische Einordnung der Erziehungsratgeber erfolgen, da sie aufgrund bestimmter Merkmale, wie z.B. verwendbares Wissen und Handlungsanleitungen, einem bestimmten Typus literarischer Gattungen zu geordnet werden können. Da Erziehungsratgeber den Leser in seinen Vorstellung von Kindheit und Erziehung sowie den zu vermittelnden Normen und Werte beeinflusst, jedoch selbst in Inhalt und Form dem gesellschaftlichen Wandel unterliegen, ist es notwendig die Geschichte des Ratgebergenres zu betrachten. Nur so kann deutlich werden, wie sich Ratgeber und deren Inhalte im Laufe der Geschichte veränderten: von dem Ratgeber, welcher nur für spezielle Zielgruppe gedacht war1, hin zu einem massemedialen Objekt. Die heutigen Erziehungsratgeber lassen sich mit Stichworten wie internationale Verbreitung, vereinzelt sehr hohe Auflagenzahlen, eine breite Zielgruppe und mit überwiegend psychologisch orientierten Ratschlägen charakterisieren. Wie es zu dieser Entwicklung kam, soll daher im geschichtlichen Abriss des Ratgebergenres ersichtlich werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zum Thema und Aufgabenstellung
- Aufbau der Arbeit
- Ratgeber
- Die literarische Einordnung der Erziehungsratgeber
- Die Geschichte der Ratgeber
- Die Ratgeberliteratur vor dem 20. Jahrhundert
- Ratgeberliteratur bis zur Aufklärung
- Ratgeberliteratur ab dem 18. Jahrhundert
- Ratgeberliteratur zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Die Entwicklung der Ratgeberliteratur während der Weimarer Republik
- Die Ratgeberliteratur während dem Nationalsozialismus
- Die Entwicklung der Ratgeberliteratur seit 1945
- Ratgeber in der DDR
- Ratgeber in der BRD
- Zusammenfassung
- Erziehungsratgeber
- Pädagogische Alltagstheorie vs. erziehungswissenschaftliche Theorie
- Merkmale der Erziehungsratgeber
- Merkmale des erziehungswissenschaftlichen Wissens in Ratgebern
- Kausalzwänge
- Breite und Verwendungsdichte
- Allzuständigkeit
- Patente Lösungen
- Unkorrigierbarkeit
- Umgang mit Aggressionen bei Kindern
- Beschreibung der Ratgeber
- Aggression und ihre Subtypen aus wissenschaftlicher Sicht
- Subtypen
- Die Entwicklung „normaler“ Aggressionen
- Aggressionsformen aus der Ratgeberperspektive
- Ursachen und Entstehungsmodelle von Aggressionen aus wissenschaftlicher Sicht
- Lern- und Verhaltenstheorien
- Die klassische Konditionierung
- Die Operante Konditionierung
- Lernen durch Beobachtung
- Triebtheorien
- Die Frustrations-Aggressions-Hypothese
- Die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung
- Risikofaktoren als Ursache / Verstärker aggressiven Verhaltens
- Welche Ursachen werden von den Ratgeber-Autoren genannt?
- Ursachen aufgrund der Entwicklung des Kindes
- Ursachen, die sich aus dem direkten Erziehungsgeschehen ergeben
- Ursachen, die sich aus der Interaktion mit dem sozialen Umfeld ergeben
- Interventionsmöglichkeiten
- Das Kontingenz-Management
- Der familienbezogene Ansatz (Parental Management Training)
- Der kognitiv-behaviorale Ansatz
- Das Training sozialer Kompetenzen
- Der psychodynamische Ansatz
- Grenzen der Ansätze
- Mit Aggressionen umgehen – die Ratgeberperspektive
- Kurzzeitstrategien
- Langzeitstrategien
- Zwischenfazit
- Grenzen setzen und Regeln lernen
- Die Notwendigkeit von Grenzen in der Erziehung
- Die Erziehungsunsicherheit bezüglich dem „Grenzen setzen“
- Grenzen als Orientierung
- Die Grenzen als Schutz
- Die Grenze als Chance zur Entwicklung
- Welche Grenzen und Regeln gibt es?
- Nicht-verhandelbare Grenzen und Regeln
- Verhandelbare Grenzen und Regeln
- Wie lernt ein Kind die Regeln und Grenzen?
- Was ist zu beachten?
- Welche Lerntheorien werden dargelegt?
- Dargestellte Erziehungsstile
- Zwischenfazit
- Die Entwicklung und Geschichte der Ratgeberliteratur
- Die spezifischen Merkmale von Erziehungsratgebern und deren Abgrenzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen
- Die Analyse von Erklärungsmustern und Begründungsfiguren im Kontext der Thematisierung von Aggressionen bei Kindern
- Die Darstellung von Grenzen und Regeln als zentrale Elemente der Erziehung
- Die kritische Auseinandersetzung mit den in Ratgebern dargestellten Interventionsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse von Erziehungsratgebern und deren Funktion in der heutigen Zeit. Ziel ist es, die in den Ratgebern verwendeten Erklärungsmuster und Begründungsfiguren zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf die erzieherische Praxis zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Erziehungsratgeber ein und beschreibt die aktuelle Relevanz des Themas im Kontext der Erziehungsunsicherheit. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Ratgeberliteratur, beginnend mit den Anfängen bis hin zur heutigen Zeit. Kapitel 3 widmet sich den spezifischen Merkmalen von Erziehungsratgebern und stellt deren Abgrenzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Vordergrund. Kapitel 4 analysiert exemplarisch den Umgang mit Aggressionen bei Kindern anhand ausgewählter Erziehungsratgeber. Es werden die in den Ratgebern dargestellten Ursachen, Subtypen und Interventionsmöglichkeiten beleuchtet und in Bezug zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gesetzt. Kapitel 5 widmet sich der Thematik von „Grenzen setzen und Regeln lernen“ in der Erziehung. Es werden die Notwendigkeit von Grenzen in der Erziehung, verschiedene Arten von Regeln und die Bedeutung von Lerntheorien in diesem Kontext erörtert.
Schlüsselwörter
Erziehungsratgeber, Erklärungsmuster, Begründungsfiguren, Aggression, Kindererziehung, Grenzen setzen, Regeln lernen, Erziehungsstile, wissenschaftliche Erkenntnisse, Pädagogische Alltagstheorie, Entwicklung der Ratgeberliteratur.
Häufig gestellte Fragen
Was untersuchen pädagogische Ratgeber in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die in Erziehungsratgebern verwendeten Erklärungsmuster und Begründungsfiguren sowie deren Auswirkungen auf die erzieherische Praxis.
Wie hat sich das Genre der Erziehungsratgeber historisch entwickelt?
Das Genre wandelte sich von Ratgebern für spezielle Zielgruppen hin zu einem massenmedialen Objekt mit internationaler Verbreitung und hohen Auflagenzahlen.
Was unterscheidet pädagogische Alltagstheorien von wissenschaftlichen Theorien?
Während wissenschaftliche Theorien auf empirischer Forschung basieren, zeichnen sich pädagogische Alltagstheorien in Ratgebern oft durch Allzuständigkeit, patente Lösungen und Unkorrigierbarkeit aus.
Wie thematisieren Ratgeber den Umgang mit Aggressionen bei Kindern?
Ratgeber bieten oft Kurzzeit- und Langzeitstrategien an, die sich von wissenschaftlichen Erklärungsmodellen wie der Lern- und Verhaltenstheorie oder Triebtheorien unterscheiden können.
Warum sind Grenzen und Regeln in der Erziehung laut Ratgebern wichtig?
Grenzen dienen Kindern als Orientierung und Schutz und werden als notwendige Chance zur gesunden Entwicklung innerhalb der Erziehung betrachtet.
Welche Rolle spielt der gesellschaftliche Wandel für Erziehungsratgeber?
Inhalt und Form von Ratgebern unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel, was die Vermittlung von Normen, Werten und das Bild von Kindheit über die Zeit hinweg beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Schneider (Autor:in), 2005, Erklärungsmuster und Begründungsfiguren in pädagogischen Ratgebern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46385