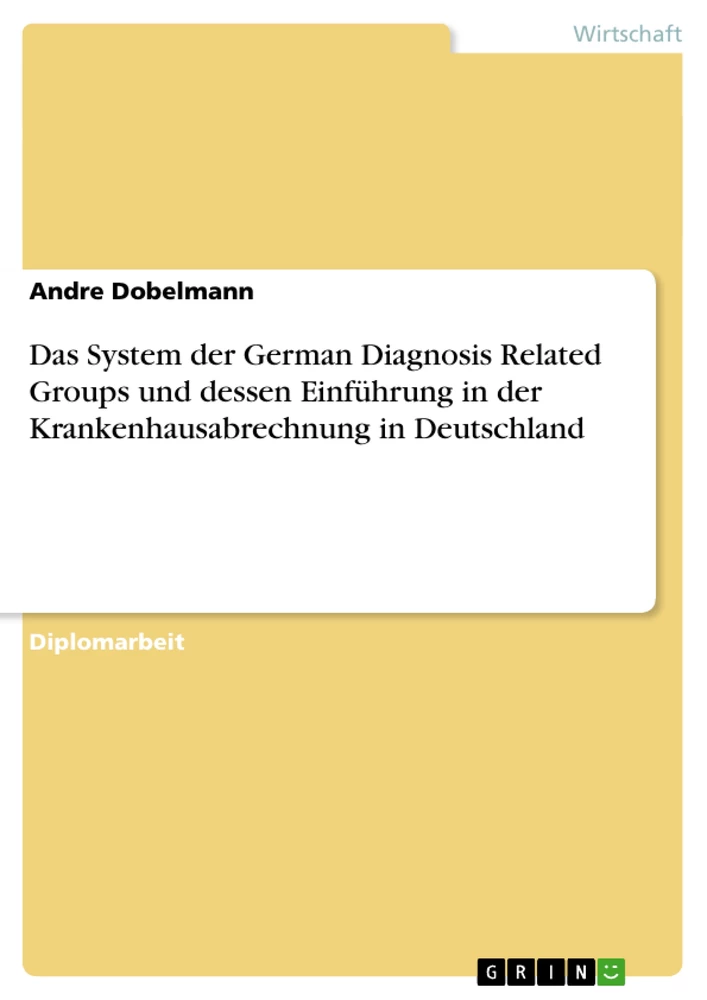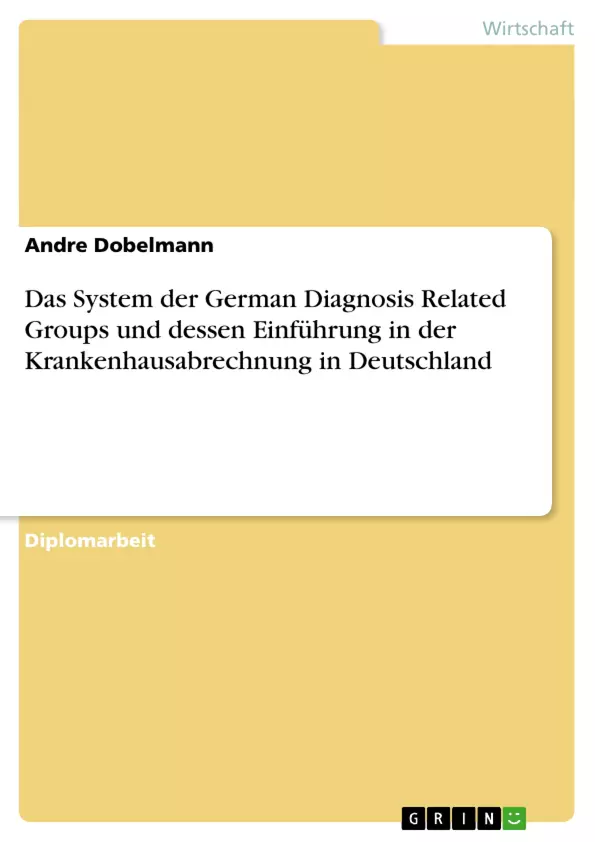Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Jahren zu derart kontroversen Diskussionen im deutschen Gesundheitswesen geführt wie die Einführung eines neuen Abrechnungs- und Kalkulationssystems in deutschen Krankenhäusern. Es handelt sich dabei um das System der G-DRG („German Diagnosis Related Groups“). Im Zuge des Gesundheitsreformgesetzes 2000 wurde mittels des am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen § 17 b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) die Einführung eines fallpauschalenorientierten Entgeltsystems beschlossen. Die Selbstverwaltungspartner im Gesundheitswesen - die deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die gesetzlichen Krankenkassen und der Verband der privaten Krankenversicherung, denen seitens des BMGS die Betreuung und Weiterentwicklung des Systems überlassen wurde, verständigten sich darauf, das in Australien verwendete AR-DRG-System mit erstmaliger Gültigkeit zum 1. Januar 2003 in Deutschland einzuführen. Zwecks Unterstützung der Selbstverwaltung bei der Einführung und Entwicklung des Systems wurde von den Partnern das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH (InEK) gegründet.
Ziel der Umstellung auf eine vollständig fallpauschalenbasierte Finanzierung der Krankenhäuser ist nach den Erwartungen des Gesetzgebers eine Intensivierung des Wettbewerbs, Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven sowie eine verbesserte Effizienz der benötigten Ressourcen.
Hiermit soll eine Minimierung der Kosten für Krankenhausbehandlungen und dadurch eine Stabilisierung des Beitragssatzes der Gesetzlichen Krankenversicherungen erreicht werden. Eine Intensivierung des Wettbewerbs bedeutet für viele Krankenhäuser häufig erstmalig, eine bessere Effizienz und Qualität liefern zu müssen als es andere erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Glossar
- Darstellungsverzeichnis
- 1 Fragestellung und Konzeption
- 2 Grundzüge von Diagnosis Related Groups
- 3 Historische Entwicklung
- 3.1 Entstehung von DRG-Systemen
- 3.2 DRG-System der Health Care Financing Administration (USA)
- 3.3 Refined Diagnosis Related Groups (USA)
- 3.4 All Patient Diagnosis Related Groups (USA)
- 3.5 All Patient Refined Diagnosis Related Groups (USA)
- 3.6 Australian National Diagnosis Related Groups
- 3.7 Australian Refined Diagnosis Related Groups
- 4 Systematik und Gruppierung der AR-DRGS
- 4.1 Grundlagen des AR-DRG-Systems
- 4.2 Gruppierungsprozess im AR-DRG-System
- 4.2.1 Zusammensetzung einer AR-DRG-Fallgruppe
- 4.2.2 Plausibilitätsprüfung der Patientendaten
- 4.2.3 Zuordnung der Hauptdiagnose
- 4.2.4 Zuordnung der Hauptdiagnosekennziffer
- 4.2.5 Zuweisung in die Partition
- 4.2.6 Schweregrad eines Behandlungsfalles
- 4.2.7 Bewertung des Ressourcenverbrauches einer Fallgruppe
- 4.2.8 Bewertung der Fallschwere eines Krankenhauses
- 5 Vom Optionsmodell zum einheitlichen G-DRG-System
- 5.1 Leistungsvergütung vor Einführung der DRGs
- 5.2 Einführung der DRGs in Deutschland
- 5.3 Anpassung: Optionsmodell 2003
- 5.4 Weiterentwicklung: 2004 und 2005
- 5.5 Auswirkungen auf das Krankenhausbudget
- 6 Anforderungen an die Kostenrechnung
- 6.1 Bisherige Gegebenheiten
- 6.2 Gegebenheiten nach der DRG-Einführung
- 6.3 Klinische Behandlungspfade
- 7 Perspektiven und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem System der German Diagnosis Related Groups (G-DRGs) und dessen Einführung in der Krankenhausabrechnung in Deutschland. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung des DRG-Systems, untersucht die Systematik und Gruppierung der G-DRGs sowie die Auswirkungen der G-DRG-Einführung auf die Krankenhausfinanzierung und die Kostenrechnung.
- Historische Entwicklung des DRG-Systems
- Systematik und Gruppierung der G-DRGs
- Auswirkungen der G-DRG-Einführung auf die Krankenhausfinanzierung
- Anforderungen an die Kostenrechnung im Zusammenhang mit der G-DRG-Einführung
- Perspektiven und Ausblick auf die Weiterentwicklung des G-DRG-Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die Fragestellung und Konzeption der Arbeit dar. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die Grundzüge von Diagnosis Related Groups (DRGs). Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung des DRG-Systems, beginnend mit der Entstehung und den verschiedenen DRG-Systemen in den USA und Australien. Kapitel 4 analysiert die Systematik und Gruppierung der AR-DRGs. Es werden die Grundlagen des Systems, der Gruppierungsprozess und die Bewertung des Ressourcenverbrauchs erläutert. Kapitel 5 behandelt das G-DRG-System in Deutschland, beginnend mit der Leistungsvergütung vor der Einführung der DRGs, der Einführung selbst und den Weiterentwicklungen. Die Auswirkungen der G-DRG-Einführung auf das Krankenhausbudget werden ebenfalls beleuchtet. Kapitel 6 befasst sich mit den Anforderungen an die Kostenrechnung vor und nach der DRG-Einführung. Die Bedeutung klinischer Behandlungspfade wird hier ebenfalls behandelt. Abschließend werden im siebten Kapitel Perspektiven und Ausblicke auf die Weiterentwicklung des G-DRG-Systems gegeben.
Schlüsselwörter
German Diagnosis Related Groups (G-DRGs), Krankenhausabrechnung, Krankenhausfinanzierung, Kostenrechnung, DRG-System, Health Care Financing Administration (HCFA), Refined Diagnosis Related Groups (USA), Australian National Diagnosis Related Groups (AN-DRGs), Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs), Fallpauschale, Fallpauschalensystem, Optionsmodell, Leistungsvergütung, Behandlungspfad, Casemix, Casemix-Index, Schweregrad, Ressourcenverbrauch.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet G-DRG in der Krankenhausabrechnung?
G-DRG steht für „German Diagnosis Related Groups“. Es ist ein System, bei dem Behandlungen nicht nach Tagen, sondern über pauschale Entgelte pro Krankheitsfall abgerechnet werden.
Warum wurde das DRG-System in Deutschland eingeführt?
Ziel war es, den Wettbewerb zu intensivieren, Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen und die Kosten im Gesundheitswesen zu stabilisieren.
Was ist das InEK?
Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) wurde gegründet, um das DRG-System zu entwickeln, zu pflegen und jährlich an neue medizinische Standards anzupassen.
Wie wird ein Patient einer DRG-Fallgruppe zugeordnet?
Die Zuordnung erfolgt über einen Gruppierungsprozess (Grouper), der Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, Prozeduren, Alter und Schweregrad berücksichtigt.
Welche Rolle spielen klinische Behandlungspfade?
Behandlungspfade helfen Krankenhäusern, Abläufe zu standardisieren, um innerhalb der vorgegebenen Fallpauschalen effizient und qualitativ hochwertig zu arbeiten.
Was ist der Casemix-Index?
Der Casemix-Index beschreibt den durchschnittlichen Schweregrad der behandelten Fälle eines Krankenhauses und ist entscheidend für die Budgetberechnung.
- Arbeit zitieren
- Andre Dobelmann (Autor:in), 2005, Das System der German Diagnosis Related Groups und dessen Einführung in der Krankenhausabrechnung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46394