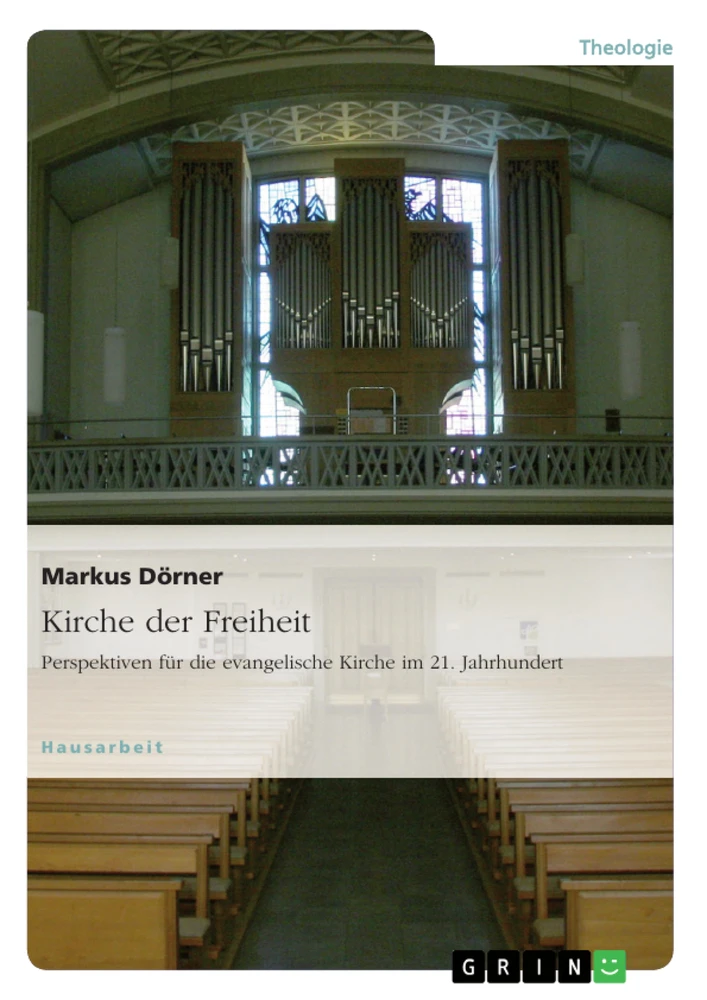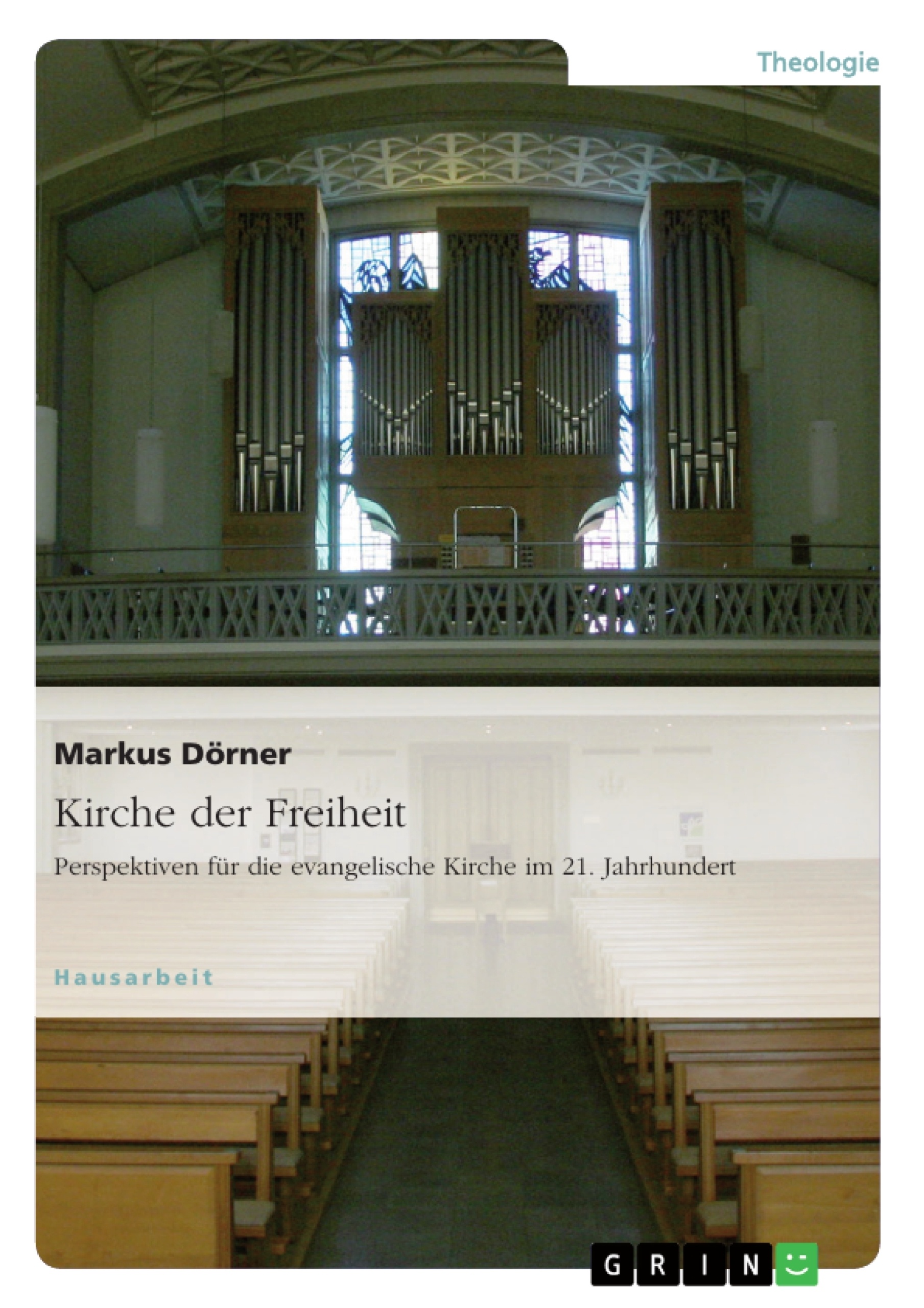In der Hausarbeit geht es um eine soziologische Beschreibung der evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Struktur und der jeweiligen Arten evangelischer Kirchen, ihren Aufbau und ihre Geschichte. Im Zuge des Reformationsjubiläums, welches für 2017 anstand, orientiert sie sich an einzelnen Aspekten des Thesenpapiers "Kirche der Freiheit", welches in Vorbereitung und Erwartung von 2017 anno 2007 durch den Oberkirchenrat Thies Gundlach u. a. publiziert wurde.
Neben vielfältigen Debatten aus Philosophie, Soziologie und Theologie von katholischer Seite beschäftigt sie sich ebenso mit dem wahrscheinlichen Fortbestand der lutherischen Tradition in deren Mutterland, der heutigen Bundesrepublik. Es wagt einen umfassenden Blick aus der Perspektive gerade auch neutral-unvoreingenommener Denker, welche ohne Zweifel bereichernd und erstaunenswert sind. Ihnen gebührt höchste Aufmerksamkeit und in vielen Fällen auch Dankbarkeit für ihre Erkenntnisse. Sie helfen der evangelischen Kirche in Deutschland, im sinnvollen Rahmen vor zu denken und sich auf kommende Generationen, Zahlen, Wünsche einzustellen.
Es liegt an der Kirche, welches Bild, welche Resonanz sie nach außen hin verbreitet: lässt sie sich von den Zahlen, welche vielleicht in manchen Punkten ernüchternd sind, diktieren, einengen, insoweit, dass sie die Bevölkerung nur noch als in Gruppen eingeteiltes, in keiner Weise homogenes Konglomerat ansieht, innerhalb dessen einige Klientel für den kirchlichen "Markt" in Frage kommen, angesprochen werden dürfen, andere wieder nicht? Welcher Teil der lutherischen Christen wird in welchem Kontext welche Impulse setzen, zumal es DIE evangelische Kirche als solche nicht gibt, sondern das Bild der Gemeinde vor Ort nach wie vor sehr stark in den Köpfen und Pastoralkonzepten verankert ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Geschichtlicher Aufriss - wie sich das lutherische Bekenntnis in Deutschland etablierte
- III. „Kirche der Freiheit“- eine Vision?
- IV. Nota bene, vorsichtiger Vorausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar befasst sich mit der Zukunft der lutherischen Kirche im 21. Jahrhundert in Deutschland. Es analysiert die historische Entwicklung des lutherischen Bekenntnisses und untersucht die Vision einer „Kirche der Freiheit“. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, vor denen die evangelische Kirche in Deutschland steht.
- Die historische Entwicklung des lutherischen Bekenntnisses in Deutschland
- Die Vision einer „Kirche der Freiheit“
- Die Herausforderungen und Chancen der evangelischen Kirche in Deutschland
- Die Rolle der Kirche in der Gesellschaft
- Die Bedeutung der lutherischen Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Seminars ein und beleuchtet die aktuelle Situation der lutherischen Kirche in Deutschland. Sie stellt die Frage nach der Zukunft des Luthertums im 21. Jahrhundert.
II. Geschichtlicher Aufriss - wie sich das lutherische Bekenntnis in Deutschland etablierte
Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des lutherischen Bekenntnisses in Deutschland. Es analysiert die Werke von Martin Luther und die Herausforderungen, die er während der Reformation bewältigen musste.
III. „Kirche der Freiheit“- eine Vision?
Das Kapitel diskutiert die Vision einer „Kirche der Freiheit“ und untersucht, ob diese Vision realisierbar ist. Es werden die Herausforderungen und Chancen für eine solche Kirche im 21. Jahrhundert beleuchtet.
Schlüsselwörter
Luthertum, Reformation, „Kirche der Freiheit“, evangelische Kirche, Deutschland, Geschichte, Theologie, Gesellschaft, Zukunft, Tradition, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thesenpapier "Kirche der Freiheit"?
"Kirche der Freiheit" ist ein 2006/2007 veröffentlichtes Impulspapier der EKD, das Reformen anstieß, um die evangelische Kirche auf die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.
Vor welchen Herausforderungen steht die evangelische Kirche heute?
Die Kirche kämpft mit sinkenden Mitgliederzahlen, finanziellen Einschränkungen und der Frage, wie sie in einer pluralistischen Gesellschaft relevant bleiben kann, ohne ihre lutherische Tradition zu verlieren.
Welche Rolle spielt die lutherische Tradition in Deutschland?
Die Arbeit untersucht den Fortbestand der lutherischen Identität im "Mutterland der Reformation" und wie diese Tradition heute gelebt und für kommende Generationen interpretiert wird.
Gibt es "DIE" evangelische Kirche als Einheit?
Nein, die evangelische Kirche in Deutschland ist stark föderal und durch die lokale Gemeinde vor Ort geprägt. Pastoralkonzepte variieren stark je nach regionalem Kontext.
Wie reagiert die Kirche auf den demografischen Wandel?
Die Kirche nutzt soziologische Erkenntnisse, um sich auf neue Zahlen und Wünsche einzustellen. Dabei wird diskutiert, ob man sich nur auf bestimmte "Marktklientel" konzentrieren oder ein Angebot für alle bleiben soll.
Was war das Ziel des Reformationsjubiläums 2017?
Es sollte nicht nur ein historischer Rückblick sein, sondern ein Anlass zur Erneuerung und zur Schärfung des Bildes der evangelischen Kirche in der modernen Welt.
- Quote paper
- Markus Dörner (Author), 2009, Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463955