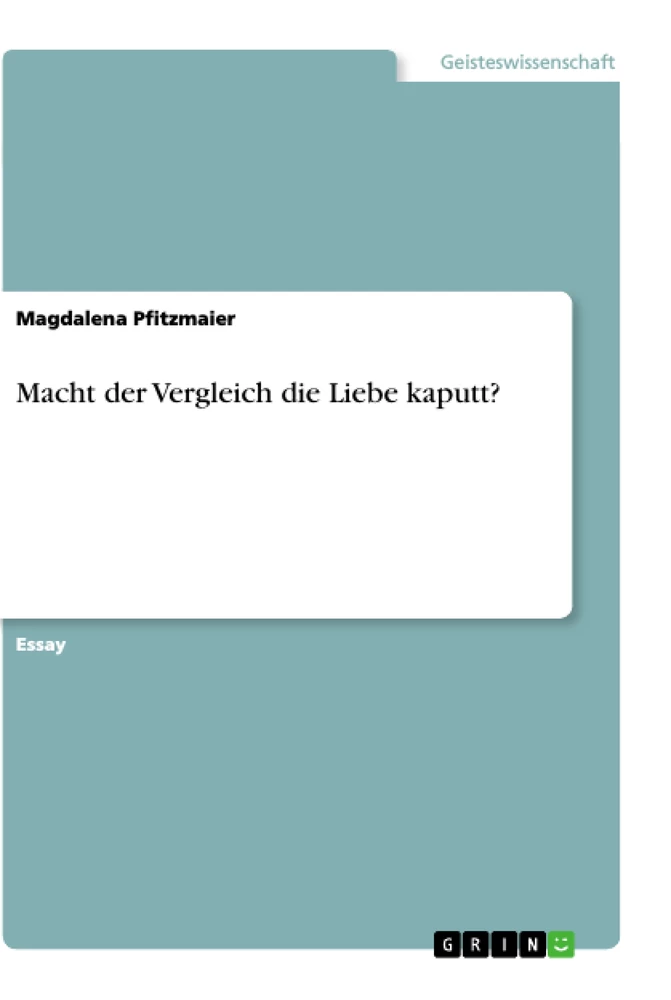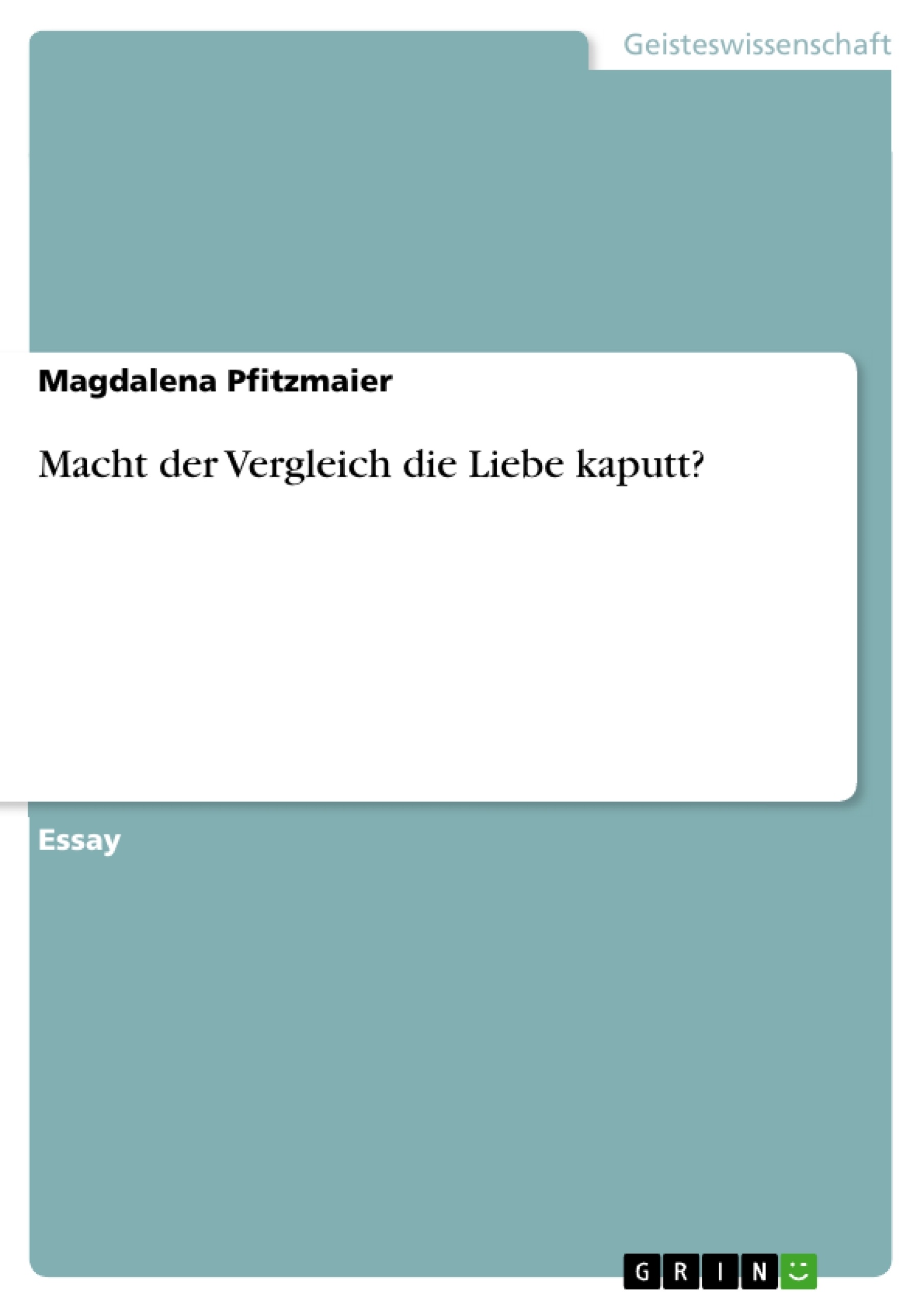Sind die Anforderungen, die wir an eine Beziehung stellen, gestiegen und deshalb auch die Bereitschaft, sie zu beenden, wenn es mal nicht so gut läuft? Der Ursprung dieser Entwicklung könnte auch im ständigen Vergleichen liegen. Etwa dass wir unseren Partner ständig mit anderen Männern oder Frauen vergleichen oder daran, dass wir unsere Bezie- hung mit dem Idealtyp einer Partnerschaft, der uns in Hollywood-Filmen als Nonplusultra der Liebe verkauft wird, in Relation setzen? Dem soll in diesem Essay nachgegangen werden mit dem Ziel, der Antwort auf die Frage, ob der Vergleich die Liebe kaputt macht, ein Stück näher zu kommen..
Jeder träumt vom einzig richtigen Partner, mit dem man sein ganzes Leben teilen will. Wenn man junge Leute nach ihren Lebenszielen fragt, dann kommen erfahrungsgemäß Antworten wie „meine Traumfrau finden“, „Kinder kriegen“ und „uns ein schönes Haus kaufen“. Die Lebensziele sind nur allzu häufig geprägt von der Idealvorstellung einer Partnerschaft mit allem, was dazu gehört. Realistisch betrachtet tritt dieser Fall jedoch immer seltener ein. Seit der Jahrtausendwende liegt die Scheidungsquote in Deutschland jährlich bei mehr als 40 Prozent, das heißt auf 100 Eheschließungen kommen mindestens 40 Ehescheidungen. Dazu kommt, dass gleichzeitig auch die Anzahl an verschiedenen Partnerschaften zugenommen hat, wie eine Studie der Universität Hamburg zeigt. Demnach hatten heutzutage die 30-Jährigen schon deutlich mehr Beziehungen als 60- Jährige, obwohl sie nur halb so alt sind. Eher ernüchternde Zahlen für die doch noch so präsente Idealvorstellung der Liebesbeziehung. Aber woran liegt das?
Der Ursprung der Liebesbeziehung in ihrer romantisierten Form, wie wir sie heute kennen, liegt vermutlich in der Epoche der Romantik. Schlegel, Brentano oder von Eichendorff prägten durch ihre Lyrik das Bild des Idealtyps „Liebe“. Emotionen und der Ewigkeitsgedanke ersetzten Tradition und wirtschaftliche Notwendigkeit. Hier kommt der Vergleich ins Spiel. Vor der „Romantisierung“ war es womöglich schlicht irrelevant, die eigene Beziehung mit anderen zu vergleichen. Zwar konnte man auch damals mit Sicherheit Unterschiede feststellen, jedoch könnte eine Einordnung in „besser“ oder
„schlechter“ aufgrund eines fehlenden Ideals schwierig gewesen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Der Ursprung der Liebesbeziehung
- Die Romantisierung der Liebe
- Kino und Fernsehen
- Soziale Medien
- Partnerbörsen
- Vergleichen in der Realität
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob der Vergleich die Liebe kaputt macht. Es wird untersucht, wie die romantisierte Vorstellung von Liebe durch verschiedene Medien wie Kino, Fernsehen und soziale Medien geprägt wird und wie diese idealisierten Bilder den Vergleich mit der eigenen Beziehung beeinflussen. Der Text analysiert auch, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die vollständige Wahlfreiheit und die Vorläufigkeit von Beziehungen fördern, den Vergleich in der Liebe begünstigen.
- Die romantisierte Vorstellung von Liebe
- Der Einfluss von Medien auf die Idealvorstellung der Liebe
- Der Vergleich mit fiktiven Partnerschaften und medienvermittelten Idealen
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Vorläufigkeit von Beziehungen
- Die Auswirkungen des Vergleichs auf die Bindungsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Ursprung der Liebesbeziehung: Der Text beleuchtet die Entwicklung der romantisierten Vorstellung von Liebe, die im 19. Jahrhundert mit der Romantik begann. Es wird gezeigt, wie die Darstellung von Liebe in der Literatur, im Kino und im Fernsehen maßgeblich zur Veränderung der Ehevorstellungen beigetragen hat.
- Partnerbörsen: Die Partnerbörsen werden als ein Beispiel für den Vergleich in der Liebe vorgestellt, der durch Algorithmen und Ranking-Systeme noch verstärkt wird. Der Text verdeutlicht, wie die medienvermittelte Idealvorstellung von Liebe die Erwartungen an potentielle Partner beeinflusst.
- Vergleichen in der Realität: Der Text zeigt, dass auch in realen Beziehungen der Vergleich eine wichtige Rolle spielt. Er geht auf eine Umfrage ein, die zeigt, dass viele Menschen ihre Beziehung mit anderen Partnern oder Beziehungen vergleichen und sich Gedanken darüber machen, ob es nicht doch einen "Besseren" gibt.
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Der Text untersucht, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die vollständige Wahlfreiheit und die Vorläufigkeit von Beziehungen fördern, den Vergleich in der Liebe begünstigen. Das Beispiel des Arbeitsplatzes wird herangezogen, um diese Vorläufigkeit zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Der Text beschäftigt sich mit den Themen Liebesbeziehung, Vergleich, Romantik, Medien, soziale Medien, Partnerbörsen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Wahlfreiheit und Vorläufigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Macht der ständige Vergleich moderne Liebesbeziehungen kaputt?
Die Arbeit untersucht, ob die gestiegenen Anforderungen und die ständige Verfügbarkeit von Vergleichen (durch Medien und Apps) die Bereitschaft erhöhen, Beziehungen bei Problemen schneller zu beenden.
Wie beeinflussen Hollywood-Filme unser Bild von der Liebe?
Filme vermitteln oft ein romantisiertes Idealbild („Traumfrau/Traummann“), das als Nonplusultra verkauft wird und dazu führt, dass reale Partnerschaften an diesem fiktiven Maßstab gemessen werden.
Welchen Einfluss haben soziale Medien und Partnerbörsen?
Durch Algorithmen und Ranking-Systeme wird der Vergleich potenzieller Partner verstärkt, was das Gefühl begünstigt, es könnte immer noch jemanden „Besseren“ geben.
Warum sind die Scheidungsquoten in Deutschland so hoch?
Seit der Jahrtausendwende liegt die Quote bei über 40 %. Neben dem Vergleich spielen gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie vollständige Wahlfreiheit und die zunehmende Vorläufigkeit von Lebensentwürfen eine Rolle.
Woher stammt unsere heutige Vorstellung von der „romantischen Liebe“?
Die Wurzeln liegen in der Epoche der Romantik (Schlegel, Brentano), in der Emotionen und der Ewigkeitsgedanke die wirtschaftlichen Notwendigkeiten früherer Zeiten ersetzten.
- Quote paper
- Magdalena Pfitzmaier (Author), 2017, Macht der Vergleich die Liebe kaputt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464112