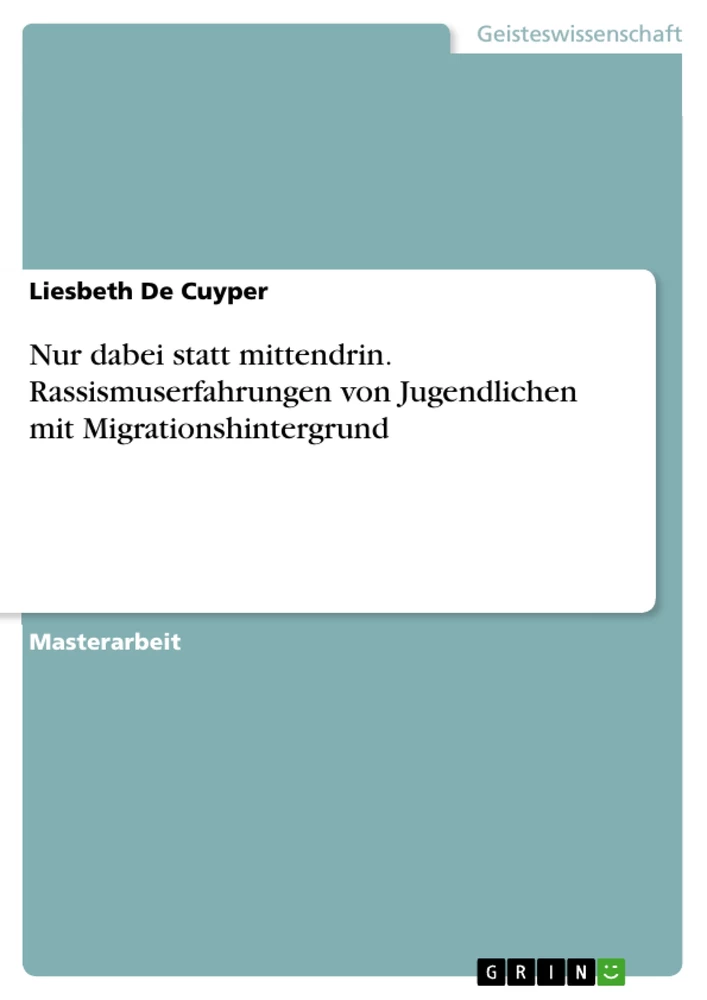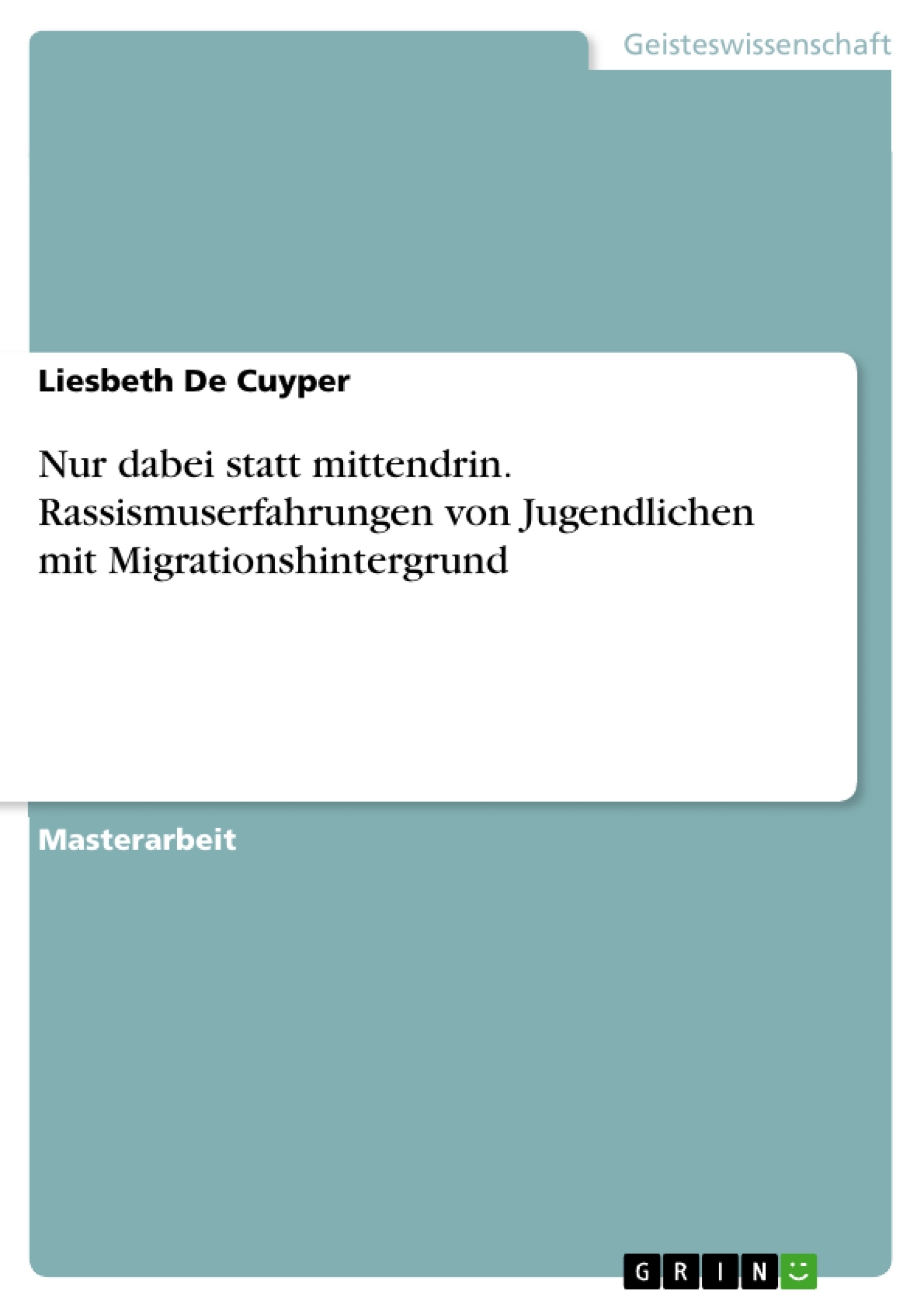Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den Rassismuserfahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihren Reaktionen und Handlungsstrategien darauf. Im Rahmen der Forschungsarbeit wird untersucht, ob und wie Jugendliche mit Migrationshintergrund aus Innsbruck in ihrem Alltag mit Rassismuserfahrungen konfrontiert werden, wie sich dies auf ihr Leben auswirkt und wie sie darauf reagieren.
In einem ersten Schritt wird eine historische Perspektive aufgezeigt, die den Werdegang des "Ausländers" schildert und aufzeigt, dass es sich dabei um eine gesellschaftliche Konstruktion der westlichen Welt handelt. Im zweiten Kapitel wird die Rassismusforschung näher betrachtet. Zum einen wird die problematische Beziehung von Rassismus und Wissenschaft dargelegt, zum anderen werden die wesentlichen Untersuchungen zu den von Rassismus benachteiligten Personen zusammengefasst und reflektiert. In dem darauf folgenden Kapitel wird versucht, sich der Komplexität des Rassismus zu nähern. Aus verschiedenen Perspektiven wird dessen Bedeutung, Funktion, Ziele und Erscheinungsformen dargelegt und eine begriffliche Definition zu erfassen versucht. Das vierte Kapitel arbeitet die Thematik Rassismuserfahrungen auf. In einem fünften Kapitel wird nun ausführlich auf die Effekte und Auswirkungen von Rassismuserfahrungen eingegangen. Dabei werden zunächst mögliche Effekte erläutert, dann werden mögliche Prozesse der Subjektbildung, wie Othering- und Salienzerfahrungen ausführlich beschrieben, sowie deren Wirkungen auf die eigene Person. Im letzten und sechsten Kapitel des theoretischen Teils geht es um die Frage der Zugehörigkeit. In einem ersten Schritt wird beschrieben, wie gesellschaftliche Imaginationen entstehen, die schlussendlich zu Ordnungen führen.
Im empirischen Forschungsteil wird in einem ersten Schritt zunächst die Perspektive der Forschungsarbeit geschildert. Danach wird die zur Datenerhebung angewandte Methodik erläutert und näher beleuchtet. Im neunten Kapitel geht es um die Datenerhebung, die Beschreibung der Institution und die Vorstellung aller Interviews. Anschließend werden die Erfahrungen der befragten Jugendlichen im Hauptteil des empirischen Forschungsteils ausführlich beschrieben und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil
- 1. Die historische Produktion der,Ausländer'
- 1.1 Rassismus als Konstrukt
- 1.2 Arbeitsmarkt
- 1.3 Bildungsinstitution Schule
- 1.4 Staatsangehörigkeit
- 1.5 Kulturelle Hegemonie
- 2. Rassismusforschung
- 2.1. Die problematische Beziehung von Rassismus und Wissenschaft
- 2.2. Untersuchungen zu den von Rassismus benachteiligten Personen
- 3. Theoretische Perspektiven
- 3.1. Rassismus als Ideologie
- 3.2. Kultureller Rassismus
- 3.3. Alltagsrassismus
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Studien zu Rassismuserfahrungen
- 4.1. Der Begriff, Andere Deutsche'
- 4.2. Versuch einer Definition
- 4.3. Dimensionen von Rassismuserfahrungen (Mecheril)
- 4.4. Vorgänge einer rassistischen Situation (Terkessidis)
- 4.5. In Bezug auf die Forschungsarbeit
- 5. Effekte und Auswirkungen von Rassismuserfahrungen
- 5.1. Effekte von Rassismuserfahrungen
- 5.2. Prozesse der Subjektbildung
- 5.3. Handlungsfähigkeiten & -strategien
- 6. Die Frage der Zugehörigkeit
- 6.1. Imagination als Ordnung
- 6.2. Vom mononationalen Blick und seinen Restriktionen...
- 6.3. ...hin zu Mehrfach-Identitäten und Vielfalt
- Empirischer Forschungsteil
- 7. Perspektive der Forschungsarbeit
- 7.1. Genese des Themas & Problemstellung
- 7.2. Formulierung der Forschungsfrage
- 7.3. Verortung des Themas
- 7.4. Forschungsziel
- 8. Methodik
- 8.1. Qualitative Sozialforschung
- 8.2. Das qualitative Interview
- 8.3. Die Gruppendiskussion
- 8.4. Das Einzelinterview
- 8.5. Auswertungsverfahren nach Bohnsack
- 9. Datenerhebung
- 9.1. Beschreibung der Institution
- 9.2. Die Interviews
- 10. Jugendliche und ihre Erfahrungen
- 10.1.Bedeutung von Diskriminierung und Rassismus
- 10.2.Rassistische Artikulationen
- 10.3.Rassismus - Erklärungsversuche
- 10.4.Rassistische Diskriminierungen: Differenzen
- 10.5.Rassistische Diskriminierung im Alltag
- 10.6.Rassistische Diskriminierung im Unterrichtskontext
- 10.7.Rassistische Diskriminierung im Arbeitskontext
- 10.8.Handlungsstrategien
- 10.9.Selbst- und Fremdpositionierung
- 10.10.Der Begriff, Ausländer'
- 10.11.Der dritte Raum als sicherer Raum
- 10.12.Im Land der Träume
- 11. Conclusio und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit den Rassismuserfahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Innsbruck. Die Studie zielt darauf ab, die alltäglichen Diskriminierungserfahrungen dieser Jugendlichen zu verstehen und zu analysieren, wie sie diese Erfahrungen verarbeiten und mit ihnen umgehen.
- Alltagsrassismus und Diskriminierungserfahrungen
- Die Konstruktion von „Ausländer*innen“ und ihre Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen
- Strategien und Handlungsmöglichkeiten von Jugendlichen im Umgang mit Rassismus
- Die Rolle von Bildung und Schule im Kontext von Rassismus
- Die Frage der Zugehörigkeit und Identität im Kontext von Migration und Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Masterarbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Der Theorieteil bietet einen umfassenden Einblick in die historische Produktion von „Ausländer*innen“ und die Entwicklung der Rassismusforschung. Es werden verschiedene theoretische Perspektiven auf Rassismus vorgestellt und Studien zu Rassismuserfahrungen beleuchtet. Der empirische Teil konzentriert sich auf die Datenerhebung und -analyse, wobei qualitative Interviews mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse der Studie zeigen die vielfältigen Formen von Rassismus, die im Alltag dieser Jugendlichen auftreten, sowie ihre individuellen Strategien und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Diskriminierung. Die Conclusio fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Rassismus, Migrationshintergrund, Diskriminierung, Jugendliche, Alltag, Schule, Bildung, Identität, Zugehörigkeit, qualitative Forschung, Innsbruck.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rassismuserfahrungen machen Jugendliche in Innsbruck?
Jugendliche mit Migrationshintergrund erleben Rassismus in vielfältigen Formen, insbesondere im Alltag, in der Schule und bei der Arbeitssuche.
Was bedeutet der Begriff "Alltagsrassismus"?
Er beschreibt subtile oder offensichtliche Diskriminierungen im täglichen Leben, die oft unbewusst geschehen, aber die Betroffenen massiv in ihrem Zugehörigkeitsgefühl einschränken.
Wie reagieren Jugendliche auf Diskriminierung?
Die Studie untersucht verschiedene Handlungsstrategien, von Rückzug und Anpassung bis hin zu offensivem Umgang oder der Schaffung eigener "sicherer Räume".
Was ist mit der "historischen Produktion der Ausländer" gemeint?
Es beschreibt die gesellschaftliche Konstruktion des "Fremden" durch Gesetze, Arbeitsmarktstrukturen und kulturelle Hegemonie in der westlichen Welt.
Welche Rolle spielt die Schule beim Thema Rassismus?
Die Schule wird oft als Ort erlebt, an dem rassistische Artikulationen und Benachteiligungen durch Lehrkräfte oder Mitschüler stattfinden können.
Was versteht man unter "Othering"?
Othering ist der Prozess, bei dem Menschen als "anders" oder "fremd" markiert werden, um die eigene Gruppe abzugrenzen und aufzuwerten.
- Quote paper
- Liesbeth De Cuyper (Author), 2016, Nur dabei statt mittendrin. Rassismuserfahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464197