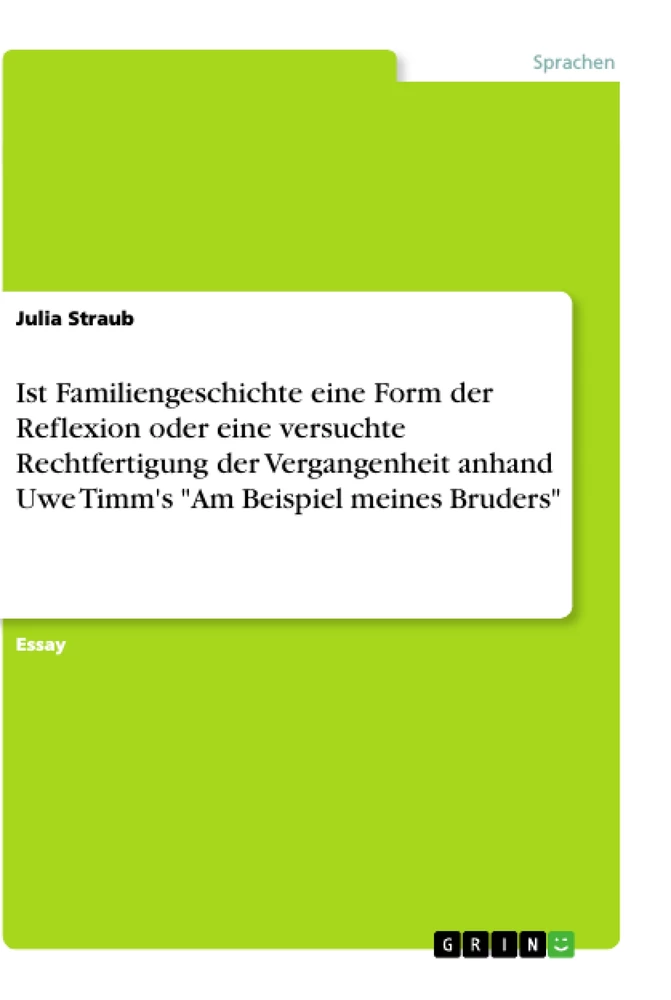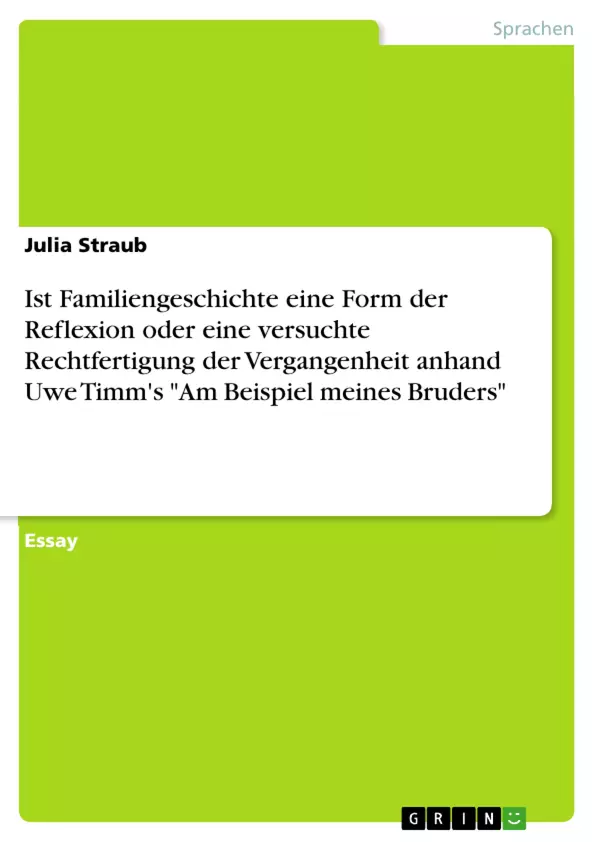Der Reiz an Familiengeschichten, die sich auf den zweiten Weltkrieg beziehen, besteht in der „konsequenten Zusammenbindung von Geschichte, Gesellschaft und Familie“ (Assmann 2005). Seit den 90er Jahren gehören Familiengeschichten aus dem Nachkriegsdeutschland, wie Am Beispiel meines Bruders von Uwe Timm zur gängigen Literatur. Die Generationen nach dem zweiten Weltkrieg, dessen Geschwister oder Eltern im Krieg lebten und aufwuchsen, sind immer mehr daran interessiert, mehr über die Hintergründe und Motive ihrer Familienmitglieder herauszufinden, welche sich dem Nationalsozialismus angeschlossen oder dagegen gekämpft haben.
Familiengeschichten fokussieren sich „auf ein fiktives oder autobiographisches Ich, das sich seiner/ihrer Identität gegenüber der eigenen Familie und der deutschen Geschichte vergewissert“ (Assmann 2005). So auch Autor Uwe Timm. Er erzählt die Geschichte seines älteren Bruders, der sich freiwillig zur Waffen-SS des Nationalsozialismus meldet und schließlich 1943 in Russland dem Krieg zum Opfer fällt. Dabei setzt er sich mit seiner Vergangenheit auseinander, was ihm nicht immer ganz leichtfällt. Er stößt dabei unter anderem auf die Frage, in wie weit sein Bruder dem Nationalsozialismus zugetan war. Aber auch mit seinem Vater setzt er sich beim Schreiben auseinander. Uwe Timm ist nicht der einzige, der solch ein Interesse an der historischen und familiären Vergangenheit zeigt. Die Frage ist, wieso interessiert sich die zweite Generation für die vergangenen Taten ihrer Familienmitglieder? Ist Familiengeschichte eine Form der Reflektion oder eine versuchte Rechtfertigung der Vergangenheit? Dies wird am Beispiel Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders in diesem Essay analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Ist Familiengeschichte eine Form der Reflektion oder eine versuchte Rechtfertigung der Vergangenheit? Am Beispiel Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders.
- Uwe Timm ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, die Vergangenheit seiner Familie wieder aufzuwühlen.
- Uwe Timm beschäftigt sich in seiner Familiengeschichte nicht ausschließlich mit seinem Bruder, sondern auch mit seinem Vater, mit dem er sozusagen abrechnet, da er den Bruder immer als besseren Sohn sah und Uwe stets mit ihm verglich.
- Ein anderer Grund für das Schreiben ist vielleicht auch, dass Uwe Timm die Lücken in Karl-Heinz' Geschichte füllen will, die durch das Tagebuch und die Briefe nicht gedeckt werden können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Frage, ob Familiengeschichten, insbesondere im Kontext des Zweiten Weltkriegs, als Reflexion der Vergangenheit dienen oder eher eine Rechtfertigung derselben darstellen. Anhand des Romans „Am Beispiel meines Bruders“ von Uwe Timm wird analysiert, wie der Autor mit seiner Familiengeschichte umgeht und welche Beweggründe ihn zum Schreiben antreiben.
- Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs im Kontext von Familiengeschichten
- Die Motivationen und Hintergründe von Familienmitgliedern, die sich dem Nationalsozialismus anschlossen oder dagegen kämpften
- Identitätssuche und -findung in Bezug auf die eigene Familiengeschichte und den historischen Kontext
- Die Rolle von Trauma und Erinnerung in der Familiengeschichte
- Die Suche nach Verstehen und Vergebung
Zusammenfassung der Kapitel
- Im ersten Kapitel wird der Kontext von Familiengeschichten im Nachkriegsdeutschland beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg. Es wird deutlich, dass Familiengeschichten eine Suche nach Identität und Verstehen der eigenen Vergangenheit darstellen.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Figur des Uwe Timm und seiner Auseinandersetzung mit der Geschichte seines Bruders Karl-Heinz, der sich freiwillig zur Waffen-SS meldete. Timms Recherchen und das Schreiben des Romans dienen ihm als Mittel der Reflexion und Aufarbeitung der Vergangenheit.
- Das dritte Kapitel behandelt die Beziehung zwischen Uwe Timm und seinem Vater und die Rolle, die sein Bruder Karl-Heinz in dieser Beziehung einnahm. Timm thematisiert die Idealierung seines Bruders durch den Vater und die damit verbundenen Spannungen und Konflikte.
- Das vierte Kapitel beleuchtet die Motivationen Uwe Timms für das Schreiben seines Romans. Es geht um die Suche nach Verständnis für die Entscheidungen seines Bruders, um die Lücken in seiner Geschichte zu schließen und um die Reflexion seiner eigenen Identität.
Schlüsselwörter
Familiengeschichte, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Identitätssuche, Reflexion, Rechtfertigung, Trauma, Erinnerung, Verstehen, Vergebung, Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders, Waffen-SS, Vater-Sohn-Beziehung, Literatur
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders"?
Der Autor setzt sich mit der Geschichte seines älteren Bruders Karl-Heinz auseinander, der freiwillig in der Waffen-SS kämpfte und 1943 fiel.
Dient das Buch der Reflexion oder der Rechtfertigung?
Die Arbeit analysiert, ob solche Familiengeschichten eine ehrliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit sind oder den Versuch darstellen, die Taten der Angehörigen zu rechtfertigen.
Welche Rolle spielt der Vater in Uwe Timms Erzählung?
Timm rechnet mit seinem Vater ab, der den gefallenen Bruder stets als "besseren Sohn" idealisierte und Uwe mit ihm verglich.
Warum interessiert sich die zweite Generation so stark für den Krieg?
Es besteht der Wunsch, die Motive der Familienmitglieder zu verstehen und die eigene Identität im Kontext der deutschen Geschichte zu klären.
Was sind die wichtigsten Quellen für Timms Recherche?
Uwe Timm nutzt das Tagebuch und die Briefe seines Bruders, um Lücken in dessen Lebensgeschichte und Ideologie zu füllen.
- Quote paper
- Julia Straub (Author), 2018, Ist Familiengeschichte eine Form der Reflexion oder eine versuchte Rechtfertigung der Vergangenheit anhand Uwe Timm's "Am Beispiel meines Bruders", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464330