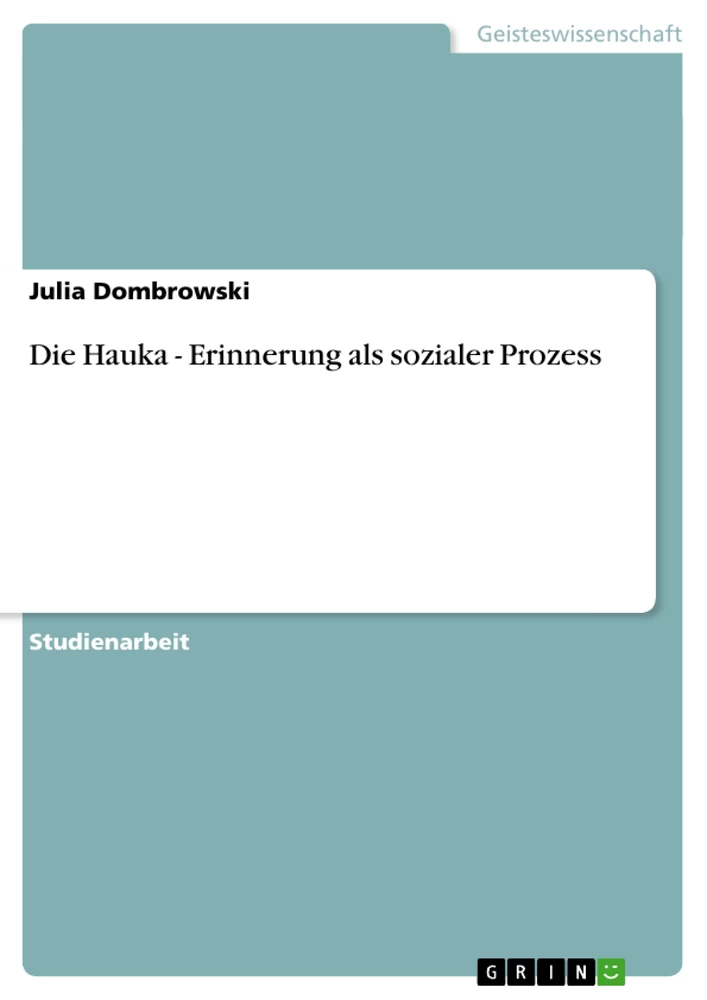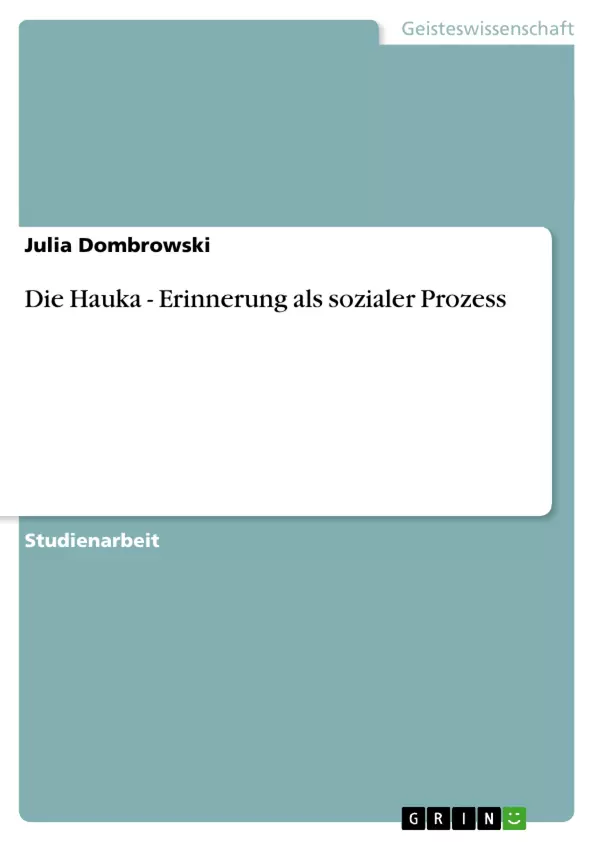Die hier vorliegende Arbeit stellt eine Auseinandersetzung mit dem sozialen Phänomen Erinnerung in einer kolonialen und postkolonialen Gesellschaft dar. Die Hauka dienen als Beispiel, um den Vorgang des kollektiven Erinnerns unter ethnologischen Aspekten zu untersuchen. Der analytische Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang von Körper und Erinnerung.
Die Hauka sind eine der Götter-Familien der westafrikanischen Songhai. Sie kamen in den 1920ern während des Kolonialismus zu Angehörigen der Ethnie. Die Zeit, in der die Hauka erstmalig erschienen, war eine Phase, die für die Songhai einen harten aufgezwungenen sozio-kulturellen Wandel bedeutete. Dieser Einschnitt prägte die Erinnerung und die Identität der Betroffenen. Die Erfahrungen der Kolonialzeit gingen bei den Songhai in das sogenannte soziale Gedächtnis ein. Die Hauka erscheinen, indem sie von Medien Besitz ergreifen. Während sie sich im Körper der Medien befinden, imitieren sie die ehemaligen Kolonialherren. Dementsprechend sind die einzelnen Hauka Europäer und meist militärische Personen wie Generäle. In den Besessenheitsritualen und -situationen leben die Erinnerungen an die Vergangenheit in körperlicher Form (embodied memories) wieder auf und werden in gegenwärtige Zusammenhänge gebracht. Die Auswirkungen und Ästhetik ihrer Handlungen, so der Anthropologe Stoller, gehen soweit, dass sie sogar das politische Geschehen unter dem Regierungschef Kountché im postkolonialen Niger beeinflussten (Stoller 1995).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Republik Niger
- Die Kolonisierung Nigers
- Kolonialkultur, Steuern und Zwangsarbeit
- Der postkoloniale Niger...
- Die Hauka - Götter der Songhai..
- Das kollektive Gedächtnis – Gegenwart und Performanz des Vergangenen...
- Geschichte, Gedächtnis und Identität...
- Erinnerungsriten
- Körper und soziales Gedächtnis
- „Incorporating practice“
- „Embodied memories“ und die Macht der Imitation
- Die Hauka als Erinnerungsfiguren.……………...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das soziale Phänomen Erinnerung in einer kolonialen und postkolonialen Gesellschaft. Die Hauka dienen als Beispiel, um den Vorgang des kollektiven Erinnerns unter ethnologischen Aspekten zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang von Körper und Erinnerung.
- Die Rolle der Hauka im kollektiven Gedächtnis der Songhai
- Der Einfluss der Kolonialzeit auf die Identität und Erinnerung der Songhai
- Die Bedeutung von Körper und Erinnerung im Kontext der Hauka-Rituale
- Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart im Rahmen der Hauka-Performanz
- Die Auswirkungen der Hauka auf das politische Geschehen im postkolonialen Niger
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Hauka als Beispiel für die Untersuchung von Erinnerung in einer kolonialen und postkolonialen Gesellschaft vor. Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die Republik Niger und die Geschichte ihrer Kolonisierung. Der Fokus liegt auf der Kolonialkultur, den Steuern und der Zwangsarbeit während der Kolonialzeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Hauka als Götter-Familie der Songhai und ihrer Entstehung im Kontext des Kolonialismus. Kapitel drei untersucht das kollektive Gedächtnis der Songhai und die Performanz des Vergangenen im Rahmen der Hauka-Rituale. Kapitel vier erörtert die Beziehung zwischen Geschichte, Gedächtnis und Identität. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit Erinnerungsriten und ihre Rolle im Prozess des gemeinsamen Gedenkens. Kapitel sechs analysiert die Verbindung von Körper und sozialem Gedächtnis, insbesondere die Bedeutung von „embodied memories“ und die Macht der Imitation in den Hauka-Ritualen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Erinnerung, kollektives Gedächtnis, soziales Gedächtnis, Kolonialismus, Postkolonialismus, Identität, Hauka, Songhai, Körper, Performanz, Rituale, „embodied memories“, Niger. Die Untersuchung beinhaltet sowohl theoretische Überlegungen als auch ethnografische Beobachtungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Hauka?
Die Hauka sind eine Götter-Familie der westafrikanischen Songhai, die in den 1920er Jahren während der Kolonialzeit entstanden und ehemalige Kolonialherren imitieren.
Was bedeutet "kollektives Gedächtnis" im Kontext der Songhai?
Es beschreibt, wie die Erfahrungen der Kolonialzeit (Zwangsarbeit, Steuern) im sozialen Gedächtnis der Gruppe gespeichert und durch Rituale lebendig gehalten werden.
Wie hängen Körper und Erinnerung zusammen?
In Besessenheitsritualen werden Erinnerungen körperlich ("embodied memories"). Die Medien imitieren Bewegungen und Befehle der Kolonialherren, wodurch die Vergangenheit performativ präsent wird.
Welchen Einfluss hatten die Hauka auf die Politik in Niger?
Laut dem Anthropologen Stoller beeinflussten die Hauka sogar das politische Geschehen unter Regierungschef Kountché, indem sie als Symbole des Widerstands oder der Macht dienten.
Warum imitieren die Hauka ausgerechnet Militärpersonen?
Die Imitation von Generälen und Offizieren ist eine Form der Auseinandersetzung mit der Macht der ehemaligen Kolonialherren und dient der Verarbeitung traumatischer Machtverhältnisse.
Was versteht man unter "Incorporating Practice"?
Es bezeichnet die Einverleibung von Wissen und Erinnerung durch körperliche Handlungen und Riten, die über Generationen hinweg ohne schriftliche Fixierung weitergegeben werden.
- Citar trabajo
- Julia Dombrowski (Autor), 2000, Die Hauka - Erinnerung als sozialer Prozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46465