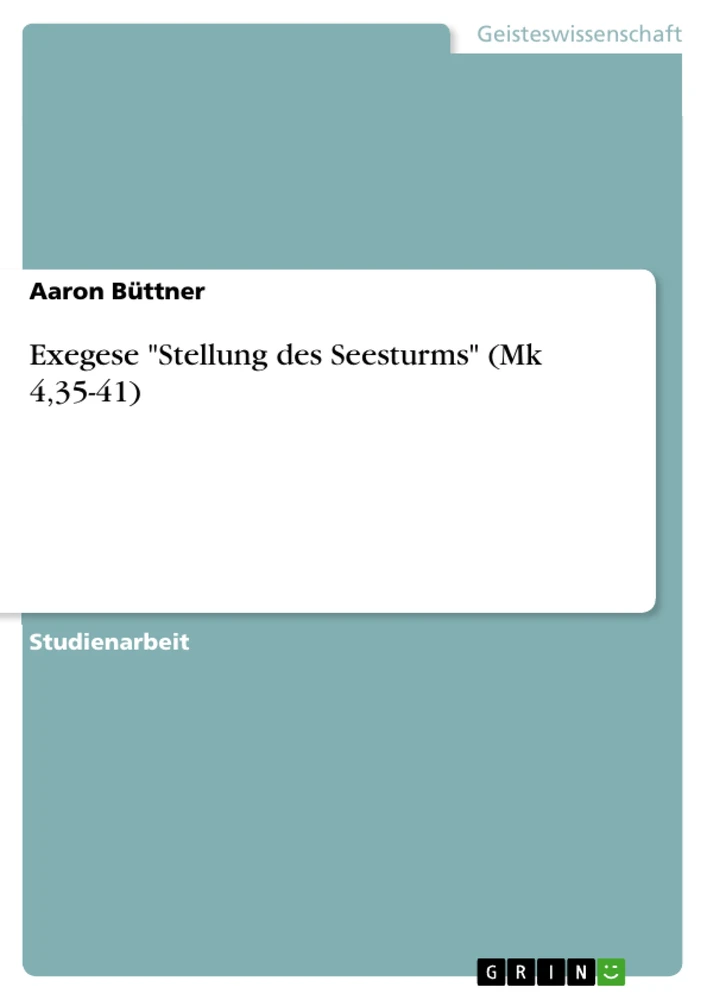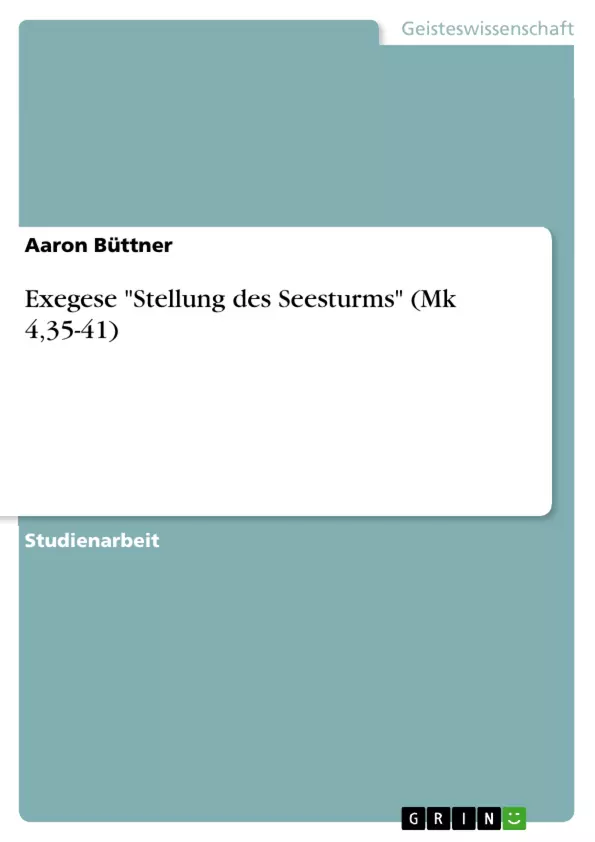Dies ist meine Exegese zur Markuserzählung "Die Stillung des Seesturms" (Mk 4,35-41).
Bezüglich dieser exegetischen Hausarbeit habe ich mich für die Geschichte „Die Stillung des Seesturms“ oder auch „Der Sturm auf dem See“ entschieden, welche in Markus 4,35-41 zu finden ist. Diese ist mir in meinem Leben bereits einige Male begegnet, angefangen im Grundschulunterricht. Erneut aufgefallen ist sie mir vor einiger Zeit, als wir uns in meinem wöchentlichen Hauskreis darüber ausgetauscht haben. Mir fiel auf, dass sich in diesen wenigen Versen mehr verbergen könnte, als ich bisher dachte, denn obwohl mir die Geschichte so bekannt ist, habe ich mich nie intensiv mit ihr beschäftigt. Dies ist eine der Motivationen für die vorliegende Hausarbeit geworden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textsicherung
- 2.1. Wirkungsgeschichtliche Reflexion
- 2.2. Abgrenzung der Perikope
- 2.3. Übersetzungsvergleich
- 3. Sprachlich-sachliche Analyse des Textes
- 3.1. Sozialgeschichtliche und historische Fragen, Realien
- 3.2. Textlinguistische Fragestellungen
- 4. Die Aussageabsicht des Autors
- 4.1. Form- und Gattungsanalyse
- 4.2. Textpragmatische Analyse
- 5. Kontextuelle Analyse
- 5.1. Traditionsgeschichte
- 5.2. Religionsgeschichtlicher Vergleich
- 5.3. Synoptischer Vergleich im engeren Sinn
- 6. Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts
- 6.1. Kompositionskritik
- 6.2. Redaktionskritik
- 7. Ergebnis, Fazit
- 8. Religionspädagogischer/Bibeldidaktischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope Markus 4,35-41, die Geschichte der Stillung des Seesturms. Ziel ist es, die Geschichte exegetisch zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext der biblischen Theologie und ihrer Wirkungsgeschichte zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Textes, von der sprachlichen Analyse bis hin zu religionsgeschichtlichen Vergleichen.
- Die Wirkungsgeschichte des Motivs des Sturms und seiner Stillung
- Sprachliche und textlinguistische Besonderheiten des Textes in Markus
- Der Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen und ihre unterschiedlichen Schwerpunkte
- Die Einordnung der Perikope in den theologischen Kontext des Markus-Evangeliums
- Die Aussageabsicht des Autors
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation der Autorin für die Wahl dieser Perikope, die bereits in der Grundschulzeit und im Hauskreis thematisiert wurde. Es wird die Bedeutung der Bibelstelle für das eigene Verständnis von Gottes Macht und dem Vertrauen in Gott hervorgehoben. Die Autorin betont die Notwendigkeit eines kritischen und gleichzeitig glaubenden Lesens der Bibel und formuliert zentrale Forschungsfragen bezüglich Jesu Wissen um den Sturm, die Gefährdung der Jünger und deren angemessene Reaktion.
2. Textsicherung: Dieses Kapitel analysiert die Perikope aus verschiedenen Perspektiven. In der wirkungsgeschichtlichen Reflexion wird das weitverbreitete Motiv des Sturms und seiner Stillung beleuchtet, mit Beispielen aus der ekklesiologischen Interpretation (Gemeinde als Boot) und Vergleichen mit der griechischen Mythologie (Castor und Pollux). Die Abgrenzung der Perikope wird anhand der Einleitung und des Übergangs zum nächsten Kapitel in Markus 5,1 präzisiert. Schließlich folgt ein Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen (Zürcher Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Einheitsübersetzung), der unterschiedliche Akzentuierungen in der Darstellung des Geschehens hervorhebt.
Schlüsselwörter
Markus-Evangelium, Stillung des Seesturms, Exegese, Bibelinterpretation, Wirkungsgeschichte, Ekklesiologie, Sprachvergleich, Textlinguistik, Theologischer Kontext, Gottesmacht, Glaube, Zweifel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur exegetischen Analyse der Perikope Markus 4,35-41
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert exegetisch die Perikope Markus 4,35-41, die Geschichte der Stillung des Seesturms. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Geschichte im Kontext der biblischen Theologie und ihrer Wirkungsgeschichte zu beleuchten.
Welche Aspekte des Textes werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, darunter die sprachliche Analyse, textlinguistische Fragestellungen, religionsgeschichtliche Vergleiche, die Einordnung in den theologischen Kontext des Markus-Evangeliums, die Aussageabsicht des Autors und die Wirkungsgeschichte des Motivs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung mit persönlicher Motivation der Autorin, Textsicherung (wirkungsgeschichtliche Reflexion, Abgrenzung der Perikope, Übersetzungsvergleich), sprachlich-sachliche Analyse (sozialgeschichtliche und historische Fragen, textlinguistische Fragestellungen), Aussageabsicht des Autors (Form- und Gattungsanalyse, textpragmatische Analyse), kontextuelle Analyse (Traditionsgeschichte, religionsgeschichtlicher Vergleich, synoptischer Vergleich), den Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts (Kompositionskritik, Redaktionskritik), Ergebnis/Fazit und einen religionspädagogischen/bibeldidaktischen Ausblick.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Wirkungsgeschichte des Motivs des Sturms und seiner Stillung, sprachliche und textlinguistische Besonderheiten des Markustextes, den Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen, die Einordnung der Perikope in den theologischen Kontext des Markus-Evangeliums und die Aussageabsicht des Autors.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Methoden der Exegese, darunter wirkungsgeschichtliche Reflexion, Übersetzungsvergleich, sprachlich-sachliche Analyse, textlinguistische Analyse, textpragmatische Analyse, religionsgeschichtlicher Vergleich, synoptischer Vergleich, Kompositionskritik und Redaktionskritik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Markus-Evangelium, Stillung des Seesturms, Exegese, Bibelinterpretation, Wirkungsgeschichte, Ekklesiologie, Sprachvergleich, Textlinguistik, Theologischer Kontext, Gottesmacht, Glaube, Zweifel.
Welche Bibelübersetzungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Bibelübersetzungen, darunter die Zürcher Bibel, die Neue Genfer Übersetzung und die Einheitsübersetzung.
Was ist die persönliche Motivation der Autorin?
Die Autorin beschreibt ihre persönliche Motivation für die Wahl dieser Perikope, die bereits in ihrer Grundschulzeit und im Hauskreis thematisiert wurde, und hebt die Bedeutung der Bibelstelle für ihr eigenes Verständnis von Gottes Macht und dem Vertrauen in Gott hervor.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Zentrale Forschungsfragen betreffen Jesu Wissen um den Sturm, die Gefährdung der Jünger und deren angemessene Reaktion.
- Quote paper
- Aaron Büttner (Author), 2019, Exegese "Stellung des Seesturms" (Mk 4,35-41), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464767