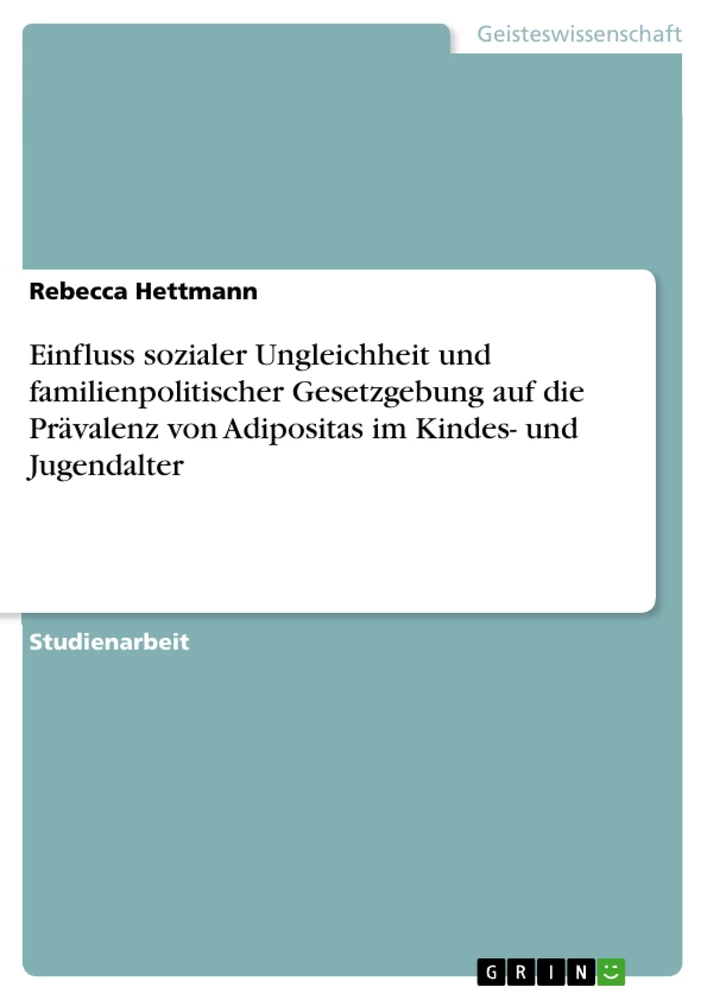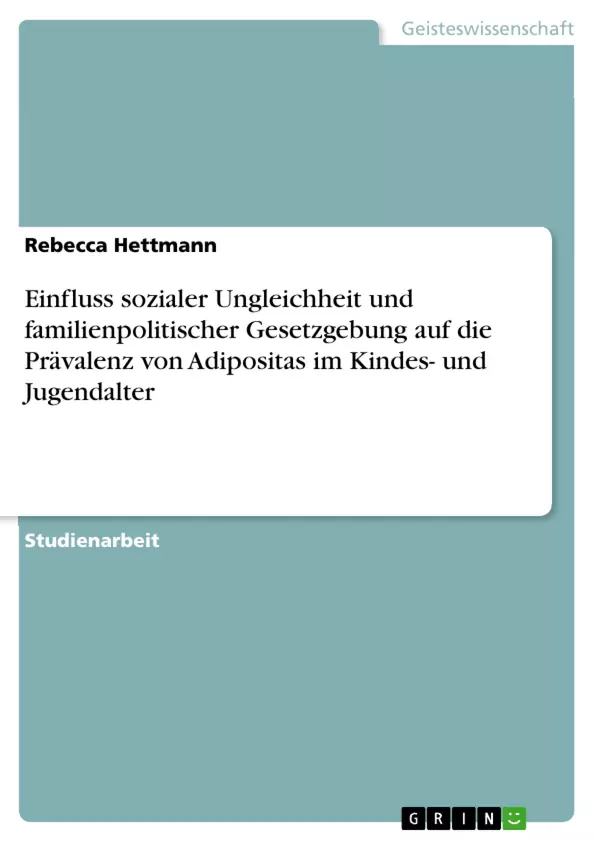Kinder haben ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit - so besagt es die UN-Kinderrechtskonvention. Eine große Gefahr für die Gesundheit stellen heutzutage Adipositas und Übergewicht dar, oft entstanden durch fehlerhaftes Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Um dem entgegenzuwirken braucht es Verhaltensprävention, beispielsweise in Form von Steuern auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. Doch es häufen sich die Befunde, dass auch soziale Ungleichheit - also die Verhältnisse - einen beachtlichen Teil zur Entstehung von Adipositas im Kindes- und Jugendalter beitragen. Ein internationaler Vergleich soll zeigen, welche Methode - die Verhaltens- oder Verhältnisprävention - dem Problem der Adipositas im Kindes- und Jugendalter entgegenwirkt. Daraus werden Schlüsse für den deutschen Fall gezogen und Implikationen für die deutsche Familienpolitik gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Kindeswohl als Bestandteil der Familienpolitik
- 1.2 Relevanz des Themas
- 2 Messung
- 2.1 BMI & Perzentilkurven
- 2.2 Datenquellen
- 3 Adipositas als Folge gesellschaftlicher Ungleichheit
- 3.1 Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke
- 3.2 Ernährungs- und Bewegungsverhalten
- 3.3 Ursachen sozialer Unterschiede
- 3.4 Exkurs: Prävention und Intervention
- 4 Adipositas und Ungleichheit im internationalen Vergleich
- 4.1 USA
- 4.2 Entwicklungsländer
- 5 Steuerreformen
- 5.1 Mexiko
- 5.2 Großbritannien
- 6 Schlussfolgerungen für Deutschland
- 7 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Ungleichheit und familienpolitischer Gesetzgebung auf die Prävalenz von Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Sie analysiert die Ursachen für die steigenden Zahlen von Übergewicht und Adipositas im Kontext gesellschaftlicher Ungleichheit und beleuchtet die Rolle von familienpolitischen Maßnahmen.
- Kindeswohl als zentraler Bestandteil der Familienpolitik
- Adipositas als Folge gesellschaftlicher Ungleichheit
- Analyse von Ernährungs- und Bewegungsverhalten
- Internationaler Vergleich von Adipositasprävalenzen
- Bewertung familienpolitischer Maßnahmen zur Prävention von Adipositas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Bedeutung des Kindeswohls im Kontext von Familienpolitik dar. Sie erläutert die Verbindung zwischen Adipositas und gesellschaftlicher Ungleichheit und zeigt die Notwendigkeit, familienpolitische Ansätze zur Bekämpfung von Ungleichheit zu entwickeln.
Kapitel 2 beleuchtet die Methoden der Messung von Adipositas anhand von BMI-Werten und Perzentilkurven. Es werden verschiedene Datenquellen und deren Relevanz für die Forschung vorgestellt.
Kapitel 3 untersucht die Ursachen für Adipositas im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Ungleichheit. Es analysiert den Konsum zuckerhaltiger Getränke, Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie die Rolle sozialer Unterschiede. Außerdem wird auf Präventions- und Interventionsmaßnahmen eingegangen.
Kapitel 4 vergleicht die Situation von Adipositas und Ungleichheit in den USA und Entwicklungsländern. Es werden verschiedene Faktoren und Trends im internationalen Kontext beleuchtet.
Kapitel 5 analysiert Steuerreformen in Mexiko und Großbritannien, die darauf abzielen, die Prävalenz von Adipositas zu reduzieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Adipositas, Kindeswohl, Familienpolitik, soziale Ungleichheit, Ernährungsverhalten, Bewegung, Prävention, Intervention, Steuerreformen und internationale Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat soziale Ungleichheit auf Adipositas bei Kindern?
Soziale Ungleichheit trägt maßgeblich zur Entstehung von Adipositas bei, da die Lebensverhältnisse das Ernährungs- und Bewegungsverhalten stark beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention?
Verhaltensprävention setzt am individuellen Verhalten an (z. B. Ernährungsberatung), während Verhältnisprävention die Lebensumstände verändert (z. B. Steuern auf zuckerhaltige Getränke).
Wie wird Adipositas bei Kindern und Jugendlichen gemessen?
Die Messung erfolgt primär über den Body-Mass-Index (BMI) in Kombination mit Perzentilkurven, um das Alter und Geschlecht zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die Familienpolitik beim Kindeswohl?
Die Familienpolitik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit gemäß der UN-Kinderrechtskonvention sichern.
Warum werden Steuerreformen in Mexiko und Großbritannien untersucht?
Diese Länder dienen als Fallbeispiele für die Wirksamkeit von Lenkungssteuern auf zuckerhaltige Getränke zur Senkung der Adipositasprävalenz.
Welche Faktoren begünstigen Adipositas im internationalen Vergleich?
Neben individuellen Faktoren spielen gesellschaftliche Trends in Industrienationen wie den USA und in Schwellenländern eine entscheidende Rolle.
- Quote paper
- Rebecca Hettmann (Author), 2018, Einfluss sozialer Ungleichheit und familienpolitischer Gesetzgebung auf die Prävalenz von Adipositas im Kindes- und Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464932