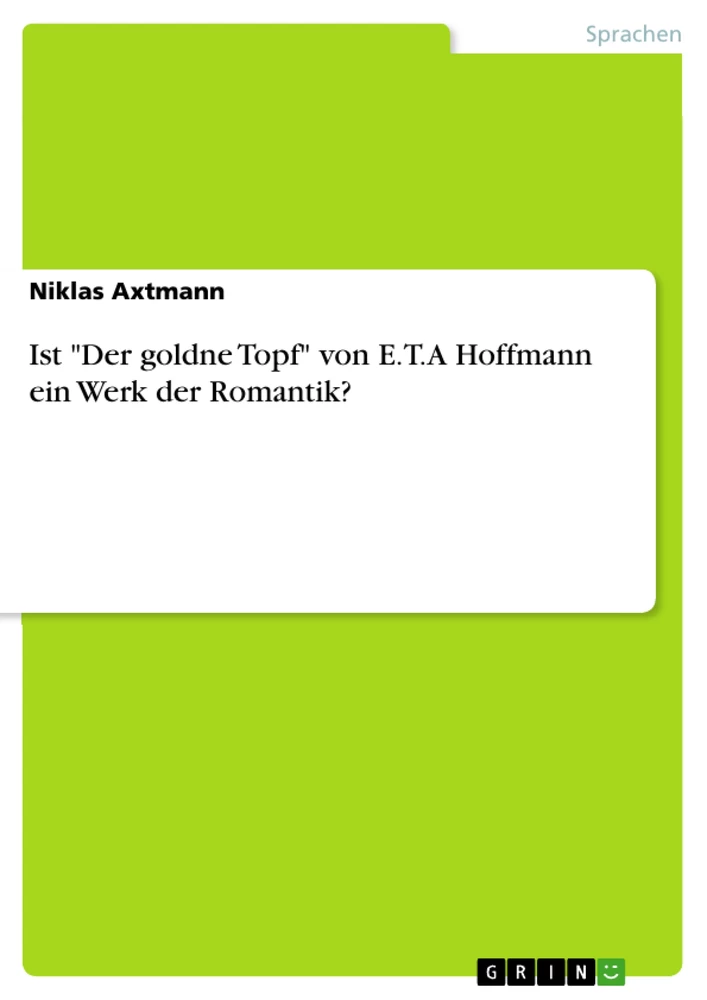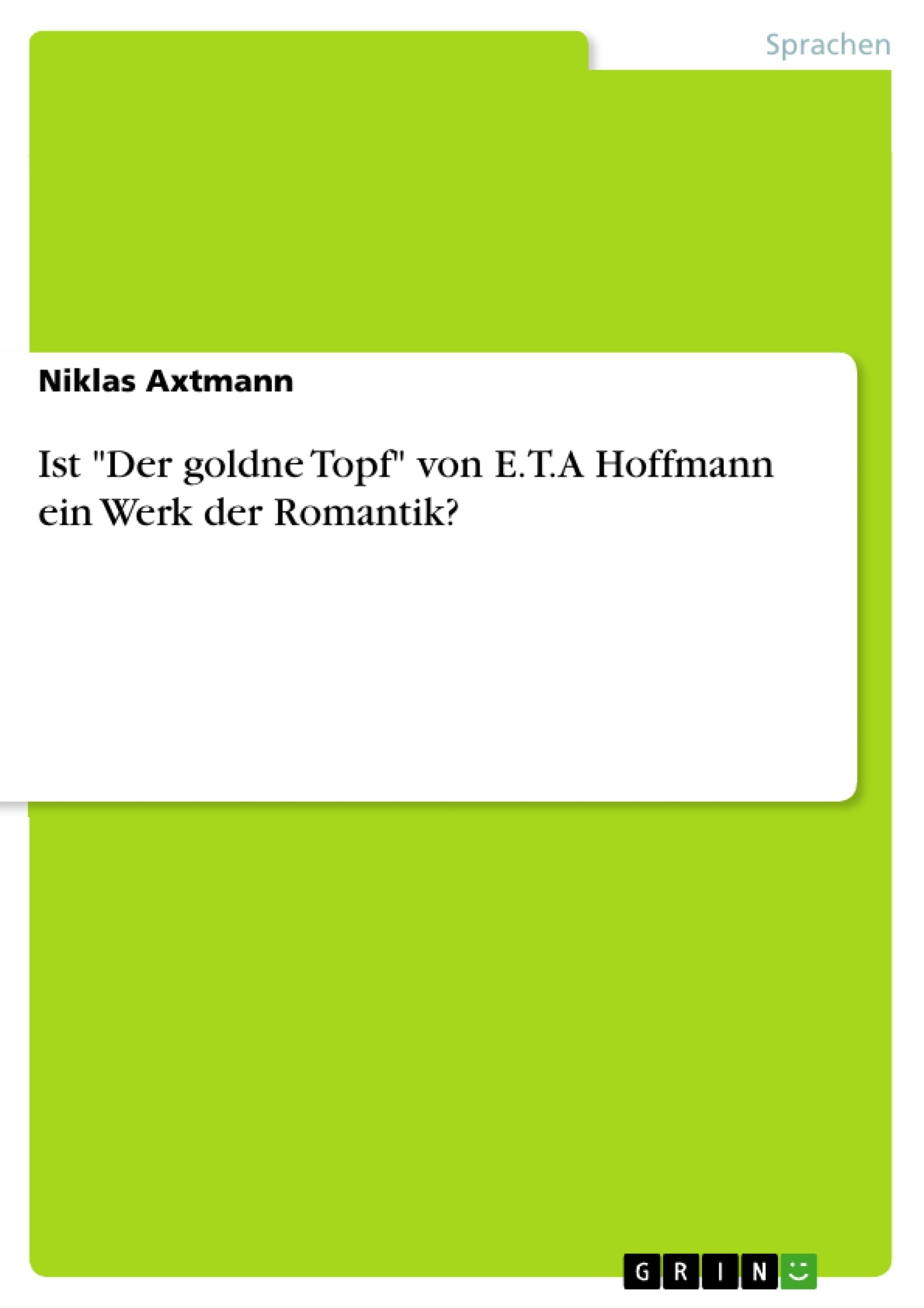Das Werk: "Der goldne Topf" gehört seit 2018 zu den Pflichtlektüren im Fach Deutsch. Diese Ausarbeitung konzentriert sich auf Merkmale und Auffälligkeiten des Werkes und überträgt diese auf die Epoche der Romantik. Berühmte Werke in der Kunst oder Literatur werden mit den Kennzeichen der Romantik verknüpft und ausführlich erläutert. Zum Schluss wird die Leitfrage, ob "Der goldne Topf" ein Werk der Romantik sei beantwortet. Die wesentlichen Merkmale werden abiturrelevant und komprimiert dargestellt.
Für Schüler und Schülerinnen der Oberstufe bietet diese Ausarbeitung einen Leitfaden für das Werk: "Der goldne Topf" und liefert Hintergrundinformationen über die gesellschaftshistorischen Zustände.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Romantik als Epoche
- Historischer Hintergrund
- Kennzeichen der Romantik
- Kunst in der Romantik
- Literatur in der Romantik
- E.T.A. Hoffmann
- „Der goldne Topf“
- Merkmale und Motive der Romantik in „Der goldne Topf“
- Anselmus als Figur der Romantik
- Ist „Der goldne Topf“ ein Werk der Romantik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Epoche der Romantik, indem sie den historischen Kontext, die wesentlichen Kennzeichen und die literarischen Ausdrucksformen beleuchtet. Insbesondere wird untersucht, ob E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“ als klassisches Werk der Romantik betrachtet werden kann.
- Die Entstehung und die historischen Hintergründe der Romantik
- Die zentralen Merkmale und Motive der Romantik
- Die Darstellung der Romantik in E.T.A. Hoffmanns Werk „Der goldne Topf“
- Die Analyse der Figur Anselmus im Kontext der Romantik
- Die Einordnung von „Der goldne Topf“ in die Epoche der Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Romantik als Epoche ein, die als Gegenbewegung zur Aufklärung und Kritik an der Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts entstand. Die Romantik fand in der Kunst, Literatur und Kultur breite Resonanz und brachte Künstler wie E.T.A. Hoffmann hervor, der durch sein multikulturelles Schaffen die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Kunstformen verdeutlichte.
Das Kapitel „Die Romantik als Epoche“ beleuchtet den historischen Kontext, die Kennzeichen und die Ausdrucksformen der Romantik. Es werden die drei Phasen der Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik mit ihren jeweiligen Zentren (Jena, Heidelberg und Berlin) vorgestellt.
Das Kapitel „E.T.A. Hoffmann“ widmet sich dem Leben und Werk des bedeutenden Romantikers E.T.A. Hoffmann und analysiert sein Werk „Der goldne Topf“ im Hinblick auf die Merkmale und Motive der Romantik.
Schlüsselwörter
Romantik, E.T.A. Hoffmann, „Der goldne Topf“, Aufklärung, Gegenbewegung, Kunst, Literatur, Kultur, Historischer Kontext, Merkmale, Motive, Anselmus, Idealtypische Figur, Epochenübergreifend, Klassisches Werk.
- Arbeit zitieren
- Niklas Axtmann (Autor:in), 2018, Ist "Der goldne Topf" von E.T.A Hoffmann ein Werk der Romantik?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465036