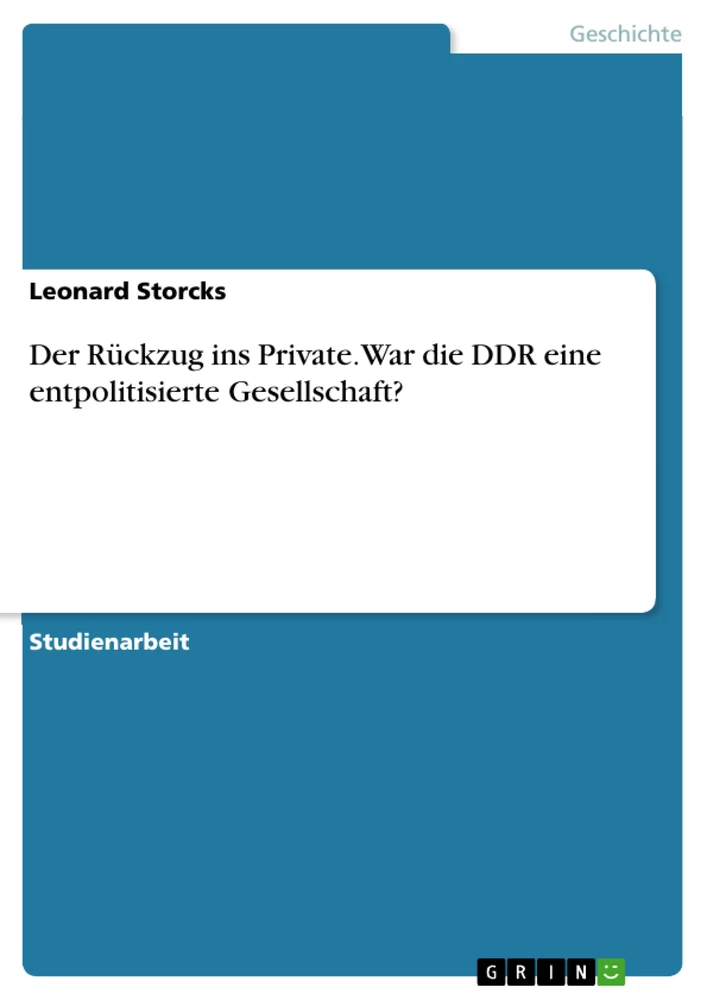"Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt", so heißt es im zweiten Artikel der Verfassung der DDR. Dies klingt nach einem progressiv sozialistisch-demokratischen Staat, geprägt von politischer Partizipation. Entsprachen die tatsächlichen Umstände diesem Bild oder war die Realität doch eher von einer in das Private zurückgedrängten, entpolitisierten Gesellschaft gezeichnet?
Als wichtigstes Einflussmittel in Demokratien können Wahlen angesehen werden, da sie über die gewählten Vertreter und Parteien die politische Agenda festlegen. In der DDR wählte der wahlberechtigte Anteil der Bürger die Volkskammer, welche als Parlament wiederum die Zusammensetzung der Regierung bestimmte. Gewählt wurde über Einheitslisten, auf welchen sich Kandidaten der Sozialistischen Einheitspartei (SED), der weiteren Blockparteien und der Massenorganisationen befanden.
Allerdings trügt der Schein eines demokratischen Systems. Die Listen konnte der Wähler nur annehmen oder ablehnen, sodass die Zusammensetzung der Volkskammer und aller anderen Organe wie der Bezirkstage bereits vor den Wahlen eindeutig war. Auch waren die Wahlen nicht geheim. Wer bei der Wahl der Liste zustimmen wollte, musste den Zettel lediglich falten, sodass das Wählen im Volksmund "Zettelfalten" genannt wurde. Nur ablehnende Personen mussten folglich in eine Wahlkammer gehen, um die Namen der Kandidaten durchzustreichen und mussten dieser Handlung folgend mit Konsequenzen wie Bespitzelung durch den Staatssicherheitsdienst rechnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Möglichkeiten der politischen Einflussnahme in der DDR
- Der „Rückzug ins Private“ im Kontext der DDR
- War die DDR eine entpolitisierte Gesellschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Frage, ob die DDR eine entpolitisierte Gesellschaft war. Er analysiert die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme in der DDR und beleuchtet den „Rückzug ins Private“ als Reaktion auf die herrschende politische Ordnung.
- Politische Partizipation in der DDR
- Kontrolle und Überwachung durch den Staat
- Der Rückzug ins Private als Coping-Mechanismus
- Individuelle Freiheit und gesellschaftliche Normen
- Opposition und Widerstand in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der zweite Artikel der Verfassung der DDR spricht von politischer Partizipation der Werktätigen. Die Einleitung stellt die Frage, ob die Realität dieser Aussage entsprach oder ob die Gesellschaft eher entpolitisiert war.
Möglichkeiten der politischen Einflussnahme in der DDR
Dieses Kapitel untersucht die formalen Möglichkeiten der politischen Einflussnahme in der DDR, wie z.B. Wahlen und die Partizipation in Massenorganisationen. Es zeigt jedoch auch die Grenzen dieser Möglichkeiten auf und verdeutlicht die Kontrolle durch die SED.
Der „Rückzug ins Private“ im Kontext der DDR
Dieses Kapitel analysiert die Gründe für den Rückzug der Bürger in den privaten Bereich. Es wird die Bedeutung von Kontrolle, sozialer Sicherheit und dem Wunsch nach individueller Entfaltung im privaten Raum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die politische Partizipation, die Kontrolle durch den Staat, die Entpolitisierung der Gesellschaft, der „Rückzug ins Private“, die Opposition in der DDR und die Frage nach individueller Freiheit unter autoritären Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen
War die DDR-Gesellschaft tatsächlich entpolitisiert?
Die Arbeit untersucht, ob der proklamierte sozialistisch-demokratische Staat in der Realität eher von einem Rückzug der Bürger in das Private geprägt war, um staatlicher Kontrolle zu entgehen.
Was versteht man unter dem Begriff „Zettelfalten“?
„Zettelfalten“ war der Volksmund-Begriff für die Wahlen in der DDR. Da die Wahlen nicht geheim waren, galt das einfache Falten und Abgeben der Einheitsliste ohne Nutzung der Wahlkabine als Zustimmung.
Welche Konsequenzen hatte eine Ablehnung der Wahlliste?
Wer in die Wahlkabine ging, um Namen durchzustreichen, musste mit Bespitzelung durch das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) und anderen beruflichen oder sozialen Repressalien rechnen.
Warum zogen sich viele DDR-Bürger ins Private zurück?
Der Rückzug diente als Coping-Mechanismus gegen die allgegenwärtige staatliche Überwachung. Im privaten Raum suchten die Menschen individuelle Freiheit, die im öffentlichen, politisierten Raum nicht möglich war.
Gab es echte politische Partizipation in der DDR?
Formal sah die Verfassung Macht für die Werktätigen vor. In der Praxis waren Beteiligungsformen wie Massenorganisationen jedoch fest unter der Kontrolle der SED, was echte Mitbestimmung verhinderte.
- Quote paper
- Leonard Storcks (Author), 2019, Der Rückzug ins Private. War die DDR eine entpolitisierte Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465416