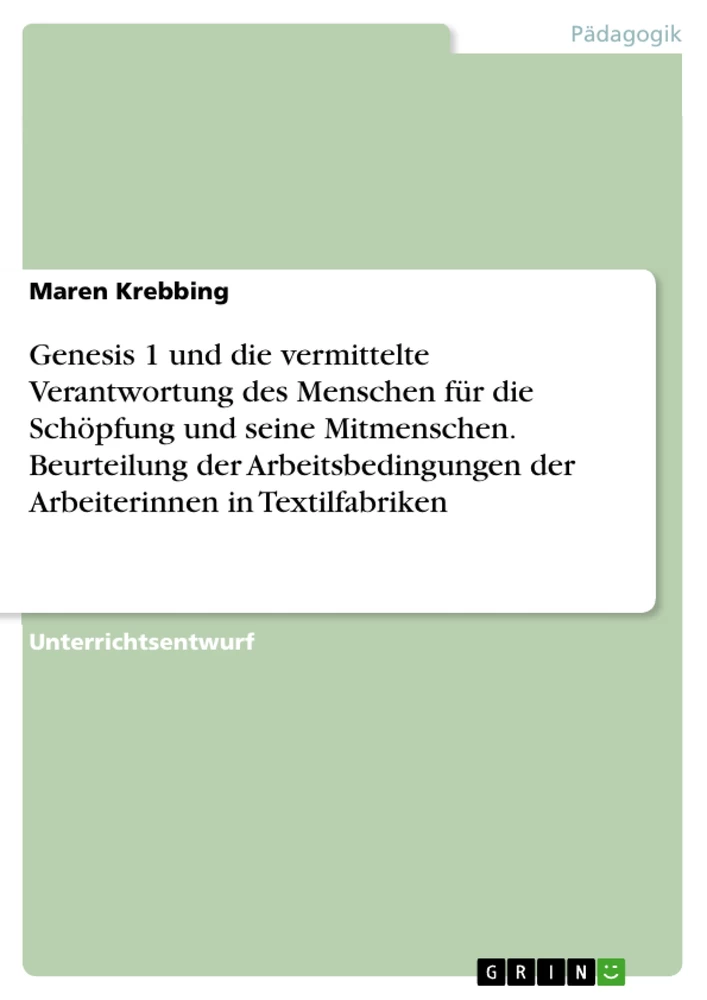Thema der Unterrichtsreihe: „Gottes Schöpfung ist so wunderbar!“ – Ganzheitlich-kreative Zugänge zur christlichen Vorstellung der Welt als Schöpfung Gottes und der daraus erwachsenden Verantwortung des Menschen.
Thema der Unterrichtsstunde: „Wer schreibt uns hier und warum?“ - Erschließung und Beurteilung der Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen in Textilfabriken im Hinblick auf der in Genesis 1 vermittelten Verantwortung des Menschen für die Schöpfung und seine Mitmenschen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
- Thema des Unterrichtsvorhabens
- Grundlegende Intention für die Auswahl des Inhalts
- Leitgedanken zum geplanten Unterrichtsvorhaben
- Anbindung des Unterrichtsvorhabens an Vorgaben
- Einordnung der Stunde in das Unterrichtsvorhaben
- Förderung der Nachhaltigkeit des Lernprozesses
- Darstellung der Besuchsstunde
- Thema der Unterrichtsstunde
- Mehrdimensionale Lernziele
- Didaktischer Schwerpunkt
- Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
- Begründung didaktischer und methodischer Entscheidungen
- Die Sache klären
- Begründung des methodischen Vorgehens
- Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Wandzeitung
- Erster Teil des Briefes, der vorgelesen wird
- PowerPoint-Präsentation und Material der Erarbeitungsphase
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Unterrichtsreihe „Gottes Schöpfung ist so wunderbar!“ zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern die christliche Vorstellung von der Welt als Schöpfung Gottes näherzubringen. Durch verschiedene kreative Zugänge sollen sie die Schönheit der Schöpfung bewusst wahrnehmen und die daraus resultierende Verantwortung des Menschen für die Welt erkennen. Die Reihe behandelt zudem den Schöpfungsauftrag und die Wichtigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Schöpfung.
- Wahrnehmung der Schöpfung
- Reflexion der Entstehung der Welt
- Verantwortung des Menschen für die Schöpfung
- Schöpfungsauftrag als Grundlage für verantwortliches Handeln
- Menschliche Mitgestaltung der Schöpfung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel behandelt die langfristigen Unterrichtszusammenhänge und erläutert das Thema der Unterrichtsreihe „Gottes Schöpfung ist so wunderbar!“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Intentionen hinter der Auswahl des Themas, den Leitgedanken der Reihe, der Anbindung an den Lehrplan und der Einordnung der Stunde in den Gesamtkontext. Das Kapitel beleuchtet auch, wie die Nachhaltigkeit des Lernprozesses gefördert werden soll.
Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung der Besuchsstunde. Es wird das Thema der Stunde, die Lernziele und der didaktische Schwerpunkt erläutert. Anschließend werden die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beschrieben, gefolgt von einer Begründung der didaktischen und methodischen Entscheidungen. Schließlich findet sich eine detaillierte Verlaufsplanung der Stunde.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Begriffe der Unterrichtsreihe sind Schöpfung, Schöpfungsverantwortung, Schöpfungsauftrag, Mensch als Mitgestalter, verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung, Fairer Handel, Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, nachhaltiges Leben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Unterrichtsreihe "Gottes Schöpfung ist so wunderbar!"?
Schüler sollen die Welt als Schöpfung Gottes wahrnehmen und die daraus resultierende Verantwortung des Menschen für Natur und Mitmenschen erkennen.
Wie wird das Thema Textilfabriken in den Religionsunterricht integriert?
Die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken dienen als Fallbeispiel, um die in Genesis 1 vermittelte Verantwortung des Menschen für seine Mitmenschen ethisch zu beurteilen.
Welche Rolle spielt der Schöpfungsauftrag in dieser Stunde?
Der Schöpfungsauftrag wird als Grundlage für verantwortliches Handeln und als Auftrag zur Mitgestaltung einer gerechten Welt verstanden.
Was sind die Lernziele der Besuchsstunde?
Die Schüler sollen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie erschließen, diese kritisch hinterfragen und einen Bezug zu christlichen Werten und fairem Handel herstellen.
Welche methodischen Entscheidungen wurden für die Stunde getroffen?
Es werden ganzheitlich-kreative Zugänge genutzt, wie das Vorlesen eines Briefes und die Arbeit mit Wandzeitungen, um das Thema emotional und sachlich zu erschließen.
- Quote paper
- Maren Krebbing (Author), 2019, Genesis 1 und die vermittelte Verantwortung des Menschen für die Schöpfung und seine Mitmenschen. Beurteilung der Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen in Textilfabriken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465440