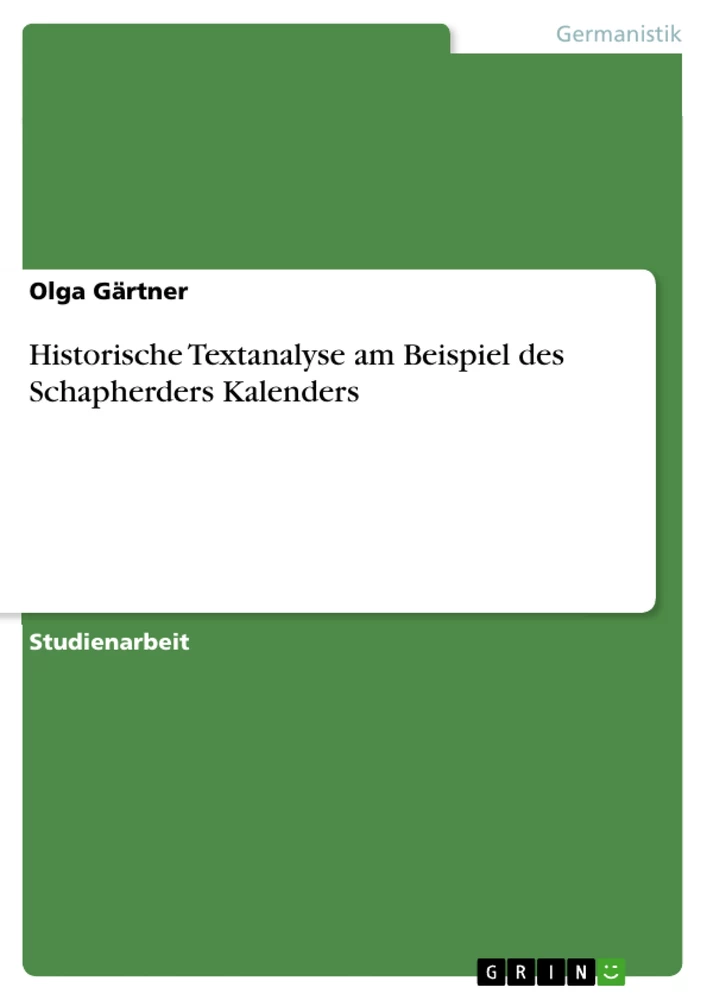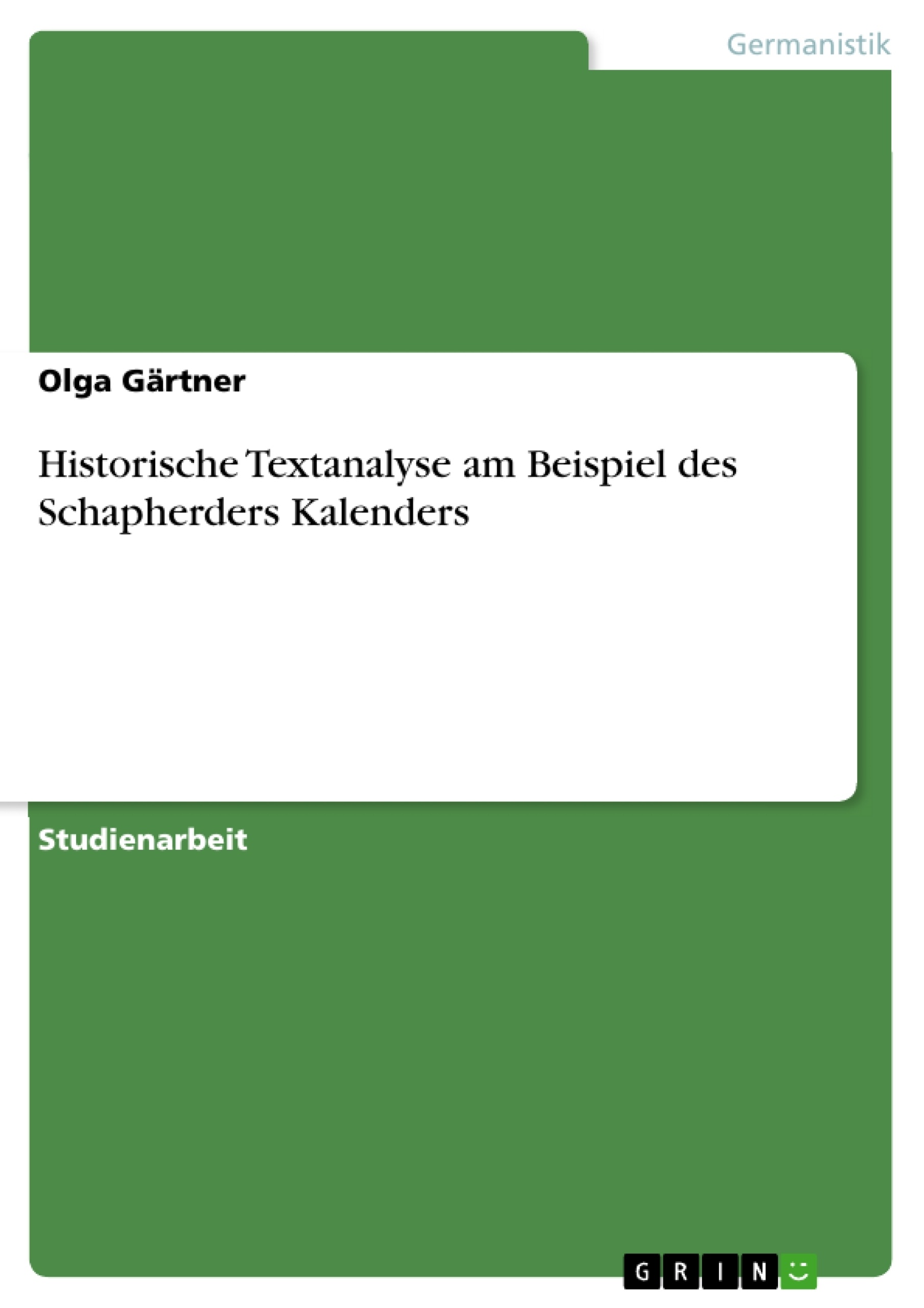Die Untersuchung dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Texten des Schapherders Kalenders, dabei wird an einigen Textbeispielen historische Analyse durchgeführt. Mit dem Druckjahr 1523 ist der Text des Schapherders Kalenders als ein Dokument der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Fachprosa einzuordnen.
Der Verfasser eines Fachprosatextes dieser Zeit verfolgte mit einem in der Volkssprache verfassten Text ein Ziel, nämlich die Darstellung der Inhalte aus einer bestimmten Perspektive. Der Adressat des Fachtextes bleibt dabei weitgehend anonym, welche Rolle ihm zugesprochen wird, lässt sich aber aus der Intention des Autors erschließen. Dem Leser werden bestimmte Interessen und das Vorwissen zugeschrieben, auf die der Autor im Vorwort seines Werkes einzugehen verspricht. Die historischen Fachtexte sind in einer Vielzahl von Textsorten überliefert, die noch nicht systematisch beschrieben sind. Die Textorganisation der historischen Fachprosa wird durch eine appellative Ausrichtung geprägt, die zwischen der informativen und appellativen Textfunktion rangiert.
So geht die zentrale Fragestellung dieser Arbeit davon aus, dass diese zwei Textfunktionen auch im Text des Schapherders Kalenders vorhanden sind. Es wird angenommen, dass es sich um einen Instruktionstext handelt, deren Erscheinung in der Volkssprache darauf schließen lässt, dass der Kalender als ein Gebrauchstext für Laien gedacht war. Unter Berücksichtigung der Problematik der historischen Textanalyse wird die Erforschung dieser Frage am Beispiel der Textstellen erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kalender als Forschungsgegenstand
- Geschichte des Kalenders
- Das Weltbild im Mittelalter
- Das humorale Viererschema
- Astronomie und Astrologie
- Vermittlung des Wissens zwischen Religion und Magie
- Aderlass und Schröpfen
- Forschungsstand
- Fazit
- Theoretische und methodische Grundlegung
- Einige Begriffe: Textsorten und Texte
- Die Textsorten
- Die Differenzierung der medizinischen Texte
- Die Textklasse Instruktionstext
- Die Problematik der historischen Textanalyse
- Erläuterung der Analysemethode
- Einige Begriffe: Textsorten und Texte
- Historische Textanalyse
- Makroanalyse
- Äußere Struktur und Aufbau des Kalenders
- Beschreibung der interaktiven Einbettung und der Textfunktion
- Das Titelblatt
- Annäherung an die Intention des Verfassers
- Exemplarische Analyse
- Der Textabschnitt und die Übersetzung
- Annäherung an die Intention des Verfassers und die Textfunktion
- Informationsgliederung, thematische Entfaltung und Formulierungsmuster
- Ermittlung der Akzeptanz und verständnissicheren Verfahren
- Überprüfung der Hypothesen und das Zwischenergebnis
- Makroanalyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Schapherders Kalender (1523) mittels historischer Textanalyse. Ziel ist es, die Textfunktionen und die Intention des Verfassers zu ergründen und den Kalender als Instruktionstext für ein Laienpublikum zu charakterisieren. Die Analyse berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen der historischen Textanalyse und nutzt eine Methode, die die interaktive Einbettung, Textfunktion und Formulierungsmuster untersucht.
- Die Geschichte und Entwicklung des Kalenders als Zeitmesssystem
- Das mittelalterliche Weltbild mit Fokus auf Astrologie und Medizin
- Die Textfunktionen und Intention des Verfassers des Schapherders Kalenders
- Methodische Herausforderungen der historischen Textanalyse
- Charakterisierung des Schapherders Kalenders als Instruktionstext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kalender als ein gedankliches Schema zur Zeitmessung mit verschiedenen Motivationen. Sie positioniert die Arbeit im Kontext der historischen Textanalyse und nennt den Schapherders Kalender (1523) als Untersuchungsgegenstand, wobei die dualen Textfunktionen (informativ und appellativ) im Fokus stehen. Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der Charakterisierung des Kalenders als Instruktionstext für Laien.
Der Kalender als Forschungsgegenstand: Dieses Kapitel präsentiert den Kalender als Forschungsgegenstand. Es behandelt die Geschichte des Kalenders, beginnend mit den frühen Hochkulturen bis zum mittelalterlichen Kalender "Cisiojanus". Es skizziert das mittelalterliche Weltbild, insbesondere die Rolle von Astrologie und Medizin, und bietet einen Überblick über den Forschungsstand zu Kalendern im deutschsprachigen Raum. Das Kapitel legt den Grundstein für die detaillierte Analyse des Schapherders Kalenders durch die Einordnung in einen geschichtlichen und wissenschaftlichen Kontext.
Theoretische und methodische Grundlegung: Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit. Es erläutert relevante Begriffe der Textsortenlehre, geht auf die spezifischen Herausforderungen der historischen Textanalyse ein und beschreibt die gewählte Analysemethode nach Britt-Marie Schuster. Diese Methode konzentriert sich auf die Beschreibung der interaktiven Einbettung, der Textfunktion, der Intention des Verfassers und der Formulierungsmuster, um die Hypothese des Instruktionstextes zu überprüfen. Das Kapitel bildet die methodologische Basis der folgenden Analyse.
Schlüsselwörter
Schapherders Kalender, Historische Textanalyse, Mittelalter, Instruktionstext, Zeitmessung, Astrologie, Medizin, Volkskunde, Textfunktion, Intention des Verfassers, mittelalterliche Fachprosa.
Häufig gestellte Fragen zum Schapherders Kalender (1523)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Schapherders Kalender von 1523 mittels historischer Textanalyse. Der Fokus liegt auf der Ergründung der Textfunktionen, der Intention des Verfassers und der Charakterisierung des Kalenders als Instruktionstext für ein Laienpublikum.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Textfunktionen und die Intention des Verfassers des Schapherders Kalenders zu ermitteln und den Kalender als Instruktionstext für ein Laienpublikum zu charakterisieren. Die Analyse berücksichtigt dabei die spezifischen Herausforderungen der historischen Textanalyse.
Welche Methoden werden angewendet?
Es wird eine Methode der historischen Textanalyse nach Britt-Marie Schuster angewendet. Diese Methode konzentriert sich auf die Beschreibung der interaktiven Einbettung, der Textfunktion, der Intention des Verfassers und der Formulierungsmuster. Die Analyse umfasst eine Makroanalyse (äußere Struktur, Aufbau, Titelblatt, Intention des Verfassers) und eine exemplarische Analyse (Textabschnitt, Übersetzung, Intention des Verfassers, Textfunktion, Informationsgliederung, thematische Entfaltung, Formulierungsmuster, Akzeptanz und verständnissichere Verfahren).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Entwicklung des Kalenders, das mittelalterliche Weltbild mit Fokus auf Astrologie und Medizin, die Textfunktionen und Intention des Verfassers des Schapherders Kalenders, methodische Herausforderungen der historischen Textanalyse und die Charakterisierung des Schapherders Kalenders als Instruktionstext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Kalender als Forschungsgegenstand (inklusive Geschichte des Kalenders, mittelalterlichem Weltbild und Forschungsstand), ein Kapitel zur theoretischen und methodischen Grundlegung (einschließlich Textsortenlehre und Beschreibung der Analysemethode), ein Kapitel zur historischen Textanalyse (Makro- und exemplarische Analyse) und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schapherders Kalender, Historische Textanalyse, Mittelalter, Instruktionstext, Zeitmessung, Astrologie, Medizin, Volkskunde, Textfunktion, Intention des Verfassers, mittelalterliche Fachprosa.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Das Ergebnis der Analyse ist die Charakterisierung des Schapherders Kalenders als Instruktionstext für Laien, basierend auf der Untersuchung der Textfunktionen und der Intention des Verfassers unter Berücksichtigung des historischen Kontextes und der spezifischen Herausforderungen der historischen Textanalyse.
Welche Bedeutung hat der Schapherders Kalender im Kontext dieser Arbeit?
Der Schapherders Kalender dient als primäre Quelle für die historische Textanalyse und ermöglicht die Untersuchung von Textfunktionen, der Intention des Verfassers und der Charakterisierung des Kalenders als Instruktionstext im Kontext des mittelalterlichen Weltbildes.
- Arbeit zitieren
- Olga Gärtner (Autor:in), 2016, Historische Textanalyse am Beispiel des Schapherders Kalenders, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465544