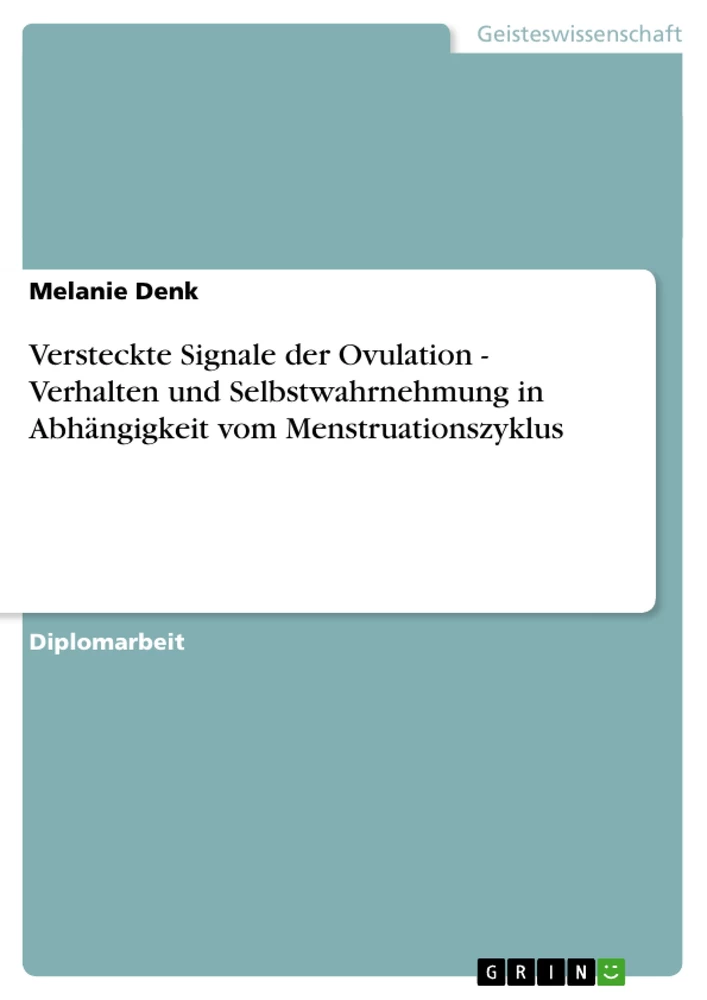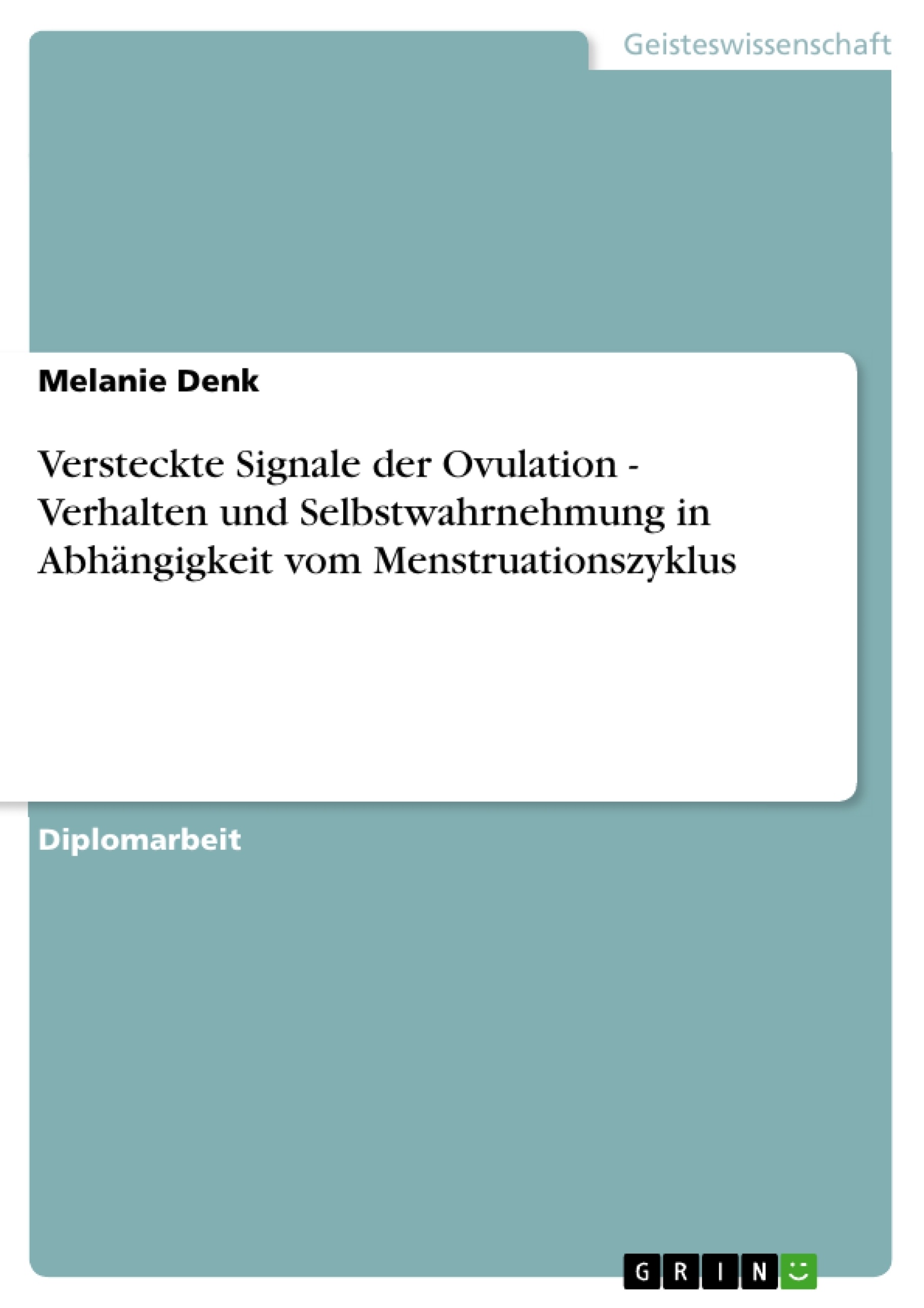Die vorliegende Arbeit untersucht unter Einbezug evolutionspsychologischer Erklärungsansätze gemäß der ‚parental investment’ Theorie und der ‚good genes’ Theorie, ob die weibliche Fertilität als auch der Beziehungsstatus im Sinne von evolvierten sexuellen Strategien einen systematischen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und das Verhalten von Frauen ausüben. Um diese möglichen Veränderungen in Kognition und Verhalten zu untersuchen, wurde eine Studie an 40 Frauen durchgeführt, die keine hormonellen Kontrazeptiva einnahmen und täglich über die Länge ihres Menstruationszyklus einen Fragebogen ausfüllten, der die zu untersuchenden Merkmale beinhaltete. Diese longitudinale Vorgehensweise ermöglichte den kontrollierten Vergleich von hoch fertiler und niedrig fertiler Phase und deren Einfluss auf die weibliche Wahrnehmung der eigenen Attraktivität sowie auf das Schmink- Kleidungsverhalten der Frauen. Aus explorativer Sicht wurde zusätzlich die weibliche Unternehmungslust bzw. die tatsächlichen Unternehmungen der Frauen in Abhängigkeit ihrer Konzeptionswahrscheinlichkeit und ihres Beziehungsstatus untersucht.
Die Ergebnisse der vorliegenden Längsschnittstudie belegen hypothesenkonform den systematischen Einfluss des Fertilitätsstatus als auch des Beziehungsstatus auf die weibliche Selbstwahrnehmung der eigenen Attraktivität. Zudem kann ein signifikanter Einfluss des Ovulationszyklus auf das weibliche Schmink- und Kleidungsverhalten von Frauen nachgewiesen werden. Eine Interaktion von Konzeptionswahrscheinlichkeit und Beziehungsstatus wird nur in Bezug auf die Verwendung von Kosmetika zum Schminken der Augen und einen ‚sexy’ Kleidungsstil tendenziell signifikant. Jedoch deuten die Mittelwerte darauf hin, dass mittels einer größeren Stichprobe eine durchgängige Signifikanz der Interaktion von Fertilitäts- und Beziehungsstatus erreicht werden könnte. Obgleich die Hypothesen bezüglich der systematischen Einfluss des Fertilitätsstatus auf die weibliche Unternehmungslust und das Unternehmungsverhalten von Frauen nicht aufrechterhalten werden konnten, stützen die Befunde unter Einbezug des Beziehungsstatus den systematischen Einfluss der weiblichen Fertilität auf die Unternehmungslust von Frauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Evolutionspsychologische Grundlagen
- 2.1 Die Evolutionstheorie von Charles Darwin
- 2.2 Sexuelle Selektion
- 2.3 Grundannahmen der Evolutionspsychologie
- 2.4 Evolutionspsychologische Sexualstrategien des Menschen
- 2.4.1 Das Konzept des parentalen Investments
- 2.5 Partnerwahlpräferenzen
- 2.5.1 Partnerwert und Partnerpräferenzen von Frauen
- 2.5.2 Physische Attraktivität als Partnerkriterium
- 2.6 Weibliche sexuelle Strategien der Partnerwahl und des intrasexuellen Wettbewerbes
- 2.6.1 Gründe für die Wahl eines Kurzzeitpartners seitens der Frau
- 2.7 Die versteckte Ovulation
- 2.8 Der Einfluss des Fertilitätsstatus auf weibliche Sexualstrategien
- 3 Gegenwärtiger Forschungsstand
- 4 Hypothesenableitung
- 4.1 Ableitung der zentralen Hypothesen
- 4.1.1 Systematische Unterschiede in der weiblichen Selbstwahrnehmung in Abhängigkeit des Fertilitätsstatus
- 4.1.2 Systematische Unterschiede des weiblichen Verhaltens in Abhängigkeit des Ovulationszyklus
- 4.2 Explorative Fragestellung
- 4.3 Nebenfragestellung: Der Beziehungsstatus als systematische Einflussgröße auf weibliche sexuelle Strategien
- 4.4 Zusammenfassung der Hypothesenableitung
- 4.5 Hypothesen
- 5 Empirische Vorgehensweise
- 5.1 Durchführung der Datenerhebung
- 5.2 Messinstrumente
- 5.3 Operationalisierung der unabhängigen Variablen
- 5.4 Operationalisierung der abhängigen Variablen
- 5.4.1 Indexkonstruktion
- 6 Ergebnisteil
- 6.1 Darstellung des statistischen Analyseverfahrens
- 6.2 Beschreibung der Stichprobe
- 6.3 Ergebnisdarstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss des Menstruationszyklus auf das Verhalten und die Selbstwahrnehmung von Frauen. Ziel ist es, evolutionspsychologische Theorien zur sexuellen Selektion und Partnerwahl im Kontext der „versteckten Ovulation“ empirisch zu überprüfen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Fertilität, sexuellen Strategien und der subjektiven Wahrnehmung dieser Strategien.
- Evolutionspsychologische Grundlagen der sexuellen Selektion
- Der Einfluss des Fertilitätsstatus auf weibliches Verhalten
- Weibliche Selbstwahrnehmung im Menstruationszyklus
- Empirische Überprüfung von Hypothesen zu Verhalten und Selbstwahrnehmung
- Die Rolle des Beziehungsstatus als Einflussfaktor
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der versteckten Ovulation und deren Auswirkungen auf weibliches Verhalten und Selbstwahrnehmung ein. Es skizziert die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas im Kontext der Evolutionspsychologie. Die Einleitung benennt die zentralen Hypothesen und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2 Evolutionspsychologische Grundlagen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die relevanten evolutionspsychologischen Theorien. Es erläutert Darwins Evolutionstheorie, die sexuelle Selektion und die Grundannahmen der Evolutionspsychologie im Detail. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Konzept des parentalen Investments und den daraus abgeleiteten Partnerwahlpräferenzen von Frauen. Die Kapitel diskutiert ausführlich weibliche sexuelle Strategien, die Wahl von Kurzzeitpartnern und den Einfluss der versteckten Ovulation auf diese Strategien.
3 Gegenwärtiger Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Stand der Forschung zu den Themen Ovulation, Verhalten und Selbstwahrnehmung von Frauen. Es analysiert bereits existierende Studien und deren Ergebnisse, um den Forschungslücke aufzuzeigen, die diese Arbeit zu schließen versucht. Es liefert den notwendigen Kontext für die eigenen Hypothesen und die gewählte Methodik.
4 Hypothesenableitung: Hier werden die zentralen Hypothesen der Arbeit detailliert hergeleitet und begründet. Ausgehend von den evolutionspsychologischen Grundlagen und dem aktuellen Forschungsstand werden spezifische, überprüfbare Hypothesen formuliert, die systematische Unterschiede in der weiblichen Selbstwahrnehmung und im Verhalten in Abhängigkeit vom Fertilitätsstatus postulieren. Der Einfluss des Beziehungsstatus wird ebenfalls als relevante Einflussgröße diskutiert.
5 Empirische Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Schritte der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Durchführung der Datenerhebung, die verwendeten Messinstrumente und die Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen Variablen. Die Konstruktion des verwendeten Index wird ausführlich dargestellt, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Evolutionspsychologie, sexuelle Selektion, versteckte Ovulation, Fertilität, Partnerwahl, weibliches Verhalten, Selbstwahrnehmung, Menstruationszyklus, Partnerpräferenzen, parentales Investment, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Einfluss des Menstruationszyklus auf Verhalten und Selbstwahrnehmung von Frauen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss des Menstruationszyklus auf das Verhalten und die Selbstwahrnehmung von Frauen. Der Fokus liegt auf der empirischen Überprüfung evolutionspsychologischer Theorien zur sexuellen Selektion und Partnerwahl im Kontext der „versteckten Ovulation“.
Welche evolutionspsychologischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Evolutionstheorie Darwins, sexuelle Selektion, Grundannahmen der Evolutionspsychologie, evolutionspsychologische Sexualstrategien des Menschen (inkl. parentales Investment), Partnerwahlpräferenzen (mit Fokus auf physische Attraktivität), weibliche sexuelle Strategien und intrasexuellen Wettbewerb, die versteckte Ovulation und den Einfluss des Fertilitätsstatus auf weibliche Sexualstrategien.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die zentralen Hypothesen postulieren systematische Unterschiede in der weiblichen Selbstwahrnehmung und im Verhalten in Abhängigkeit vom Fertilitätsstatus (Ovulationszyklus). Es wird auch der Beziehungsstatus als systematische Einflussgröße auf weibliche sexuelle Strategien untersucht. Konkret wird geprüft, ob sich die Selbstwahrnehmung und das Verhalten von Frauen im Laufe ihres Menstruationszyklus systematisch verändern.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die empirische Vorgehensweise, einschließlich der Datenerhebung, der verwendeten Messinstrumente, der Operationalisierung der unabhängigen (Fertilitätsstatus, Beziehungsstatus) und abhängigen Variablen (Verhalten, Selbstwahrnehmung). Es wird eine detaillierte Indexkonstruktion vorgestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Der Ergebnisteil beschreibt das statistische Analyseverfahren, die Stichprobenbeschreibung und die Ergebnisdarstellung der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse beleuchten die Zusammenhänge zwischen Fertilität, sexuellen Strategien und der subjektiven Wahrnehmung dieser Strategien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Evolutionspsychologie, sexuelle Selektion, versteckte Ovulation, Fertilität, Partnerwahl, weibliches Verhalten, Selbstwahrnehmung, Menstruationszyklus, Partnerpräferenzen, parentales Investment, empirische Forschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zu den evolutionspsychologischen Grundlagen, eine Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstandes, die Hypothesenableitung, die Beschreibung der empirischen Vorgehensweise und den Ergebnisteil. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Forschungslücke zu schließen, indem sie existierende Studien analysiert und eigene empirische Daten zur Überprüfung der Hypothesen liefert. Die Kombination aus theoretischem Hintergrund und empirischen Ergebnissen soll zu einem tieferen Verständnis des Zusammenhangs zwischen Menstruationszyklus, Verhalten und Selbstwahrnehmung beitragen.
- Quote paper
- Melanie Denk (Author), 2004, Versteckte Signale der Ovulation - Verhalten und Selbstwahrnehmung in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46566