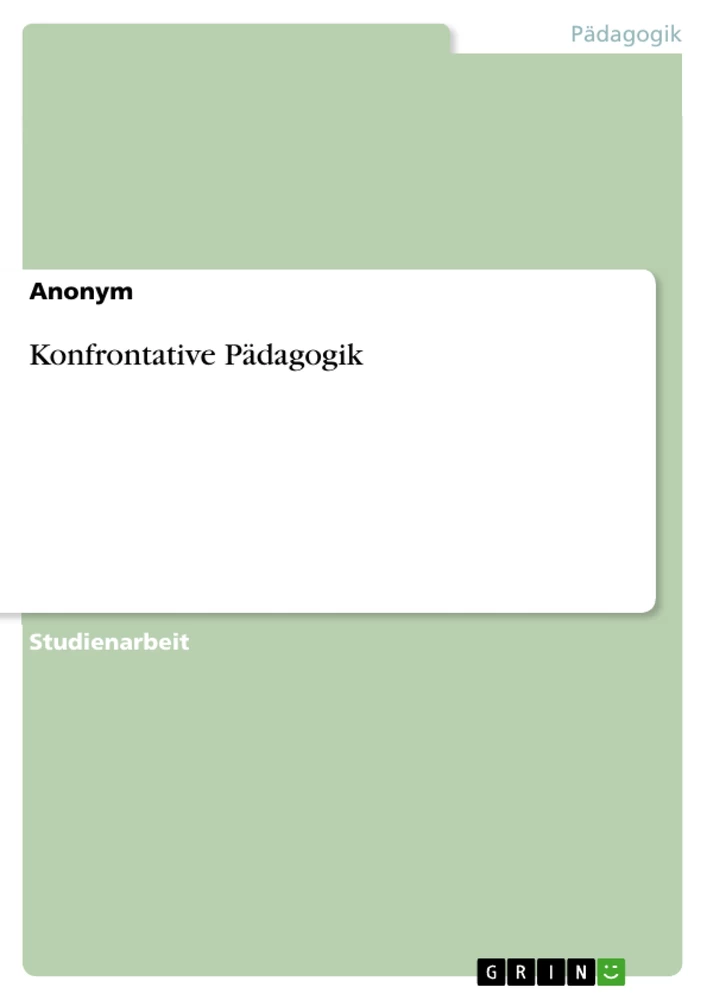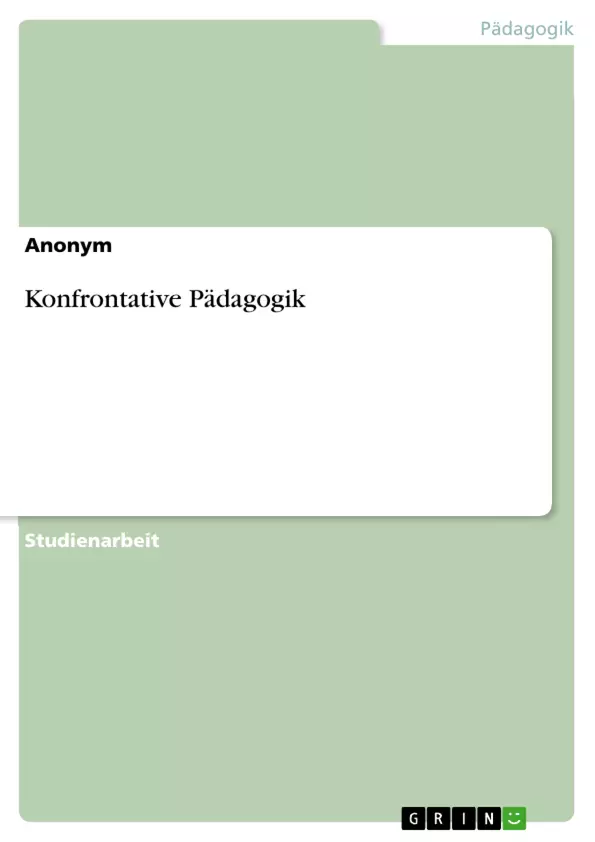Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen die wesentlichen Inhalte der Konfrontativen Pädagogik erläutert werden. Wie handelt der Pädagoge? Welche Besonderheiten bringt die Zielgruppe mit sich? Was sind die Ziele dieser Methode? Diese theoretischen Grundlagen sollen im ersten Teil dieser Arbeit geklärt werden.
Der zweite Teil bezieht sich auf die konkrete praktische Umsetzung der drei Grundversionen der Konfrontativen Pädagogik. Es soll geschildert werden, wie diese Methode der sozialen Einzelfallhilfe im Rahmen der Gesprächsführung, im Anti-Aggressions-Training und im Coolness-Training Anwendung findet.
Zum Abschluss werden Stellungnahmen präsentiert, die diskutieren inwieweit die Konfrontative Pädagogik der sogenannten Schwarzen Pädagogik gleicht.
Inhalt
1. Einführende Worte
2. Konzeptionelle Grundlagen der Konfrontativen Pädagogik
2.1. Begriffserklärung
2.2. Pädagogischer Hintergrund
2.2.1. Leitideen des pädagogischen Handelns
2.2.2. Grundlegende Haltung und methodische Ansätze
2.3. Die Zielgruppe
2.3.1. Der Personenkreis
2.3.2. Bedeutung der Gewalt
2.3.3. Ziele der Konfrontativen Pädagogik
2.4. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen
3. Konfrontation in der Praxis
3.1. Gesprächsführung
3.2. Anti-Aggressions-Training
3.2.1. Die Phasen des Trainings
3.2.2. Konfrontationsebenen
3.2.3. der heiße Stuhl als Beispiel einer Methode im Training
3.3. Coolness-Training
3.4. Forschungsergebnisse der beiden Trainings
4. Stellungnahmen zur Konfrontativen Pädagogik
4.1. Die Kritiker
4.2. Die Befürworter
4.3. Eigene Stellungnahme
5. Quellenangabe
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Konfrontativen Pädagogik?
Ziel ist es, gewaltbereiten Jugendlichen ihre Grenzen aufzuzeigen, Empathie für Opfer zu wecken und eine Verhaltensänderung durch direkte Konfrontation mit ihrem Handeln zu erreichen.
Was versteht man unter dem „heißen Stuhl“?
Es ist eine Methode im Anti-Aggressions-Training, bei der ein Teilnehmer direkt und massiv mit seinen Taten und deren Folgen konfrontiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Anti-Aggressions- und Coolness-Training?
Das Anti-Aggressions-Training (AAT) richtet sich oft an Mehrfachtäter, während das Coolness-Training (CT) präventiver und breiter in Gruppen oder Schulen eingesetzt wird.
Gleicht Konfrontative Pädagogik der „Schwarzen Pädagogik“?
Die Arbeit diskutiert kritische Stimmen, die dies behaupten, stellt aber auch die Positionen der Befürworter dar, die die Methode als notwendige Intervention bei Gewalt sehen.
Welche Rolle spielt die Opferperspektive?
Die Konfrontative Pädagogik legt großen Wert darauf, dass Täter die Schmerzen und Folgen für ihre Opfer verstehen lernen, um deren Neutralisierungstechniken zu durchbrechen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Konfrontative Pädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465726