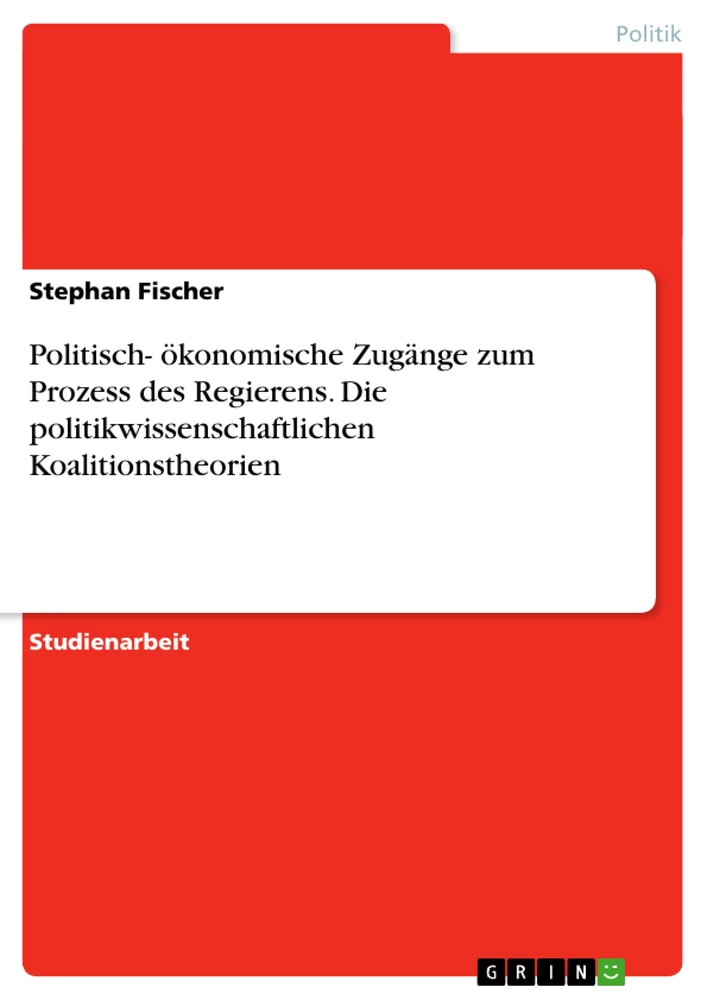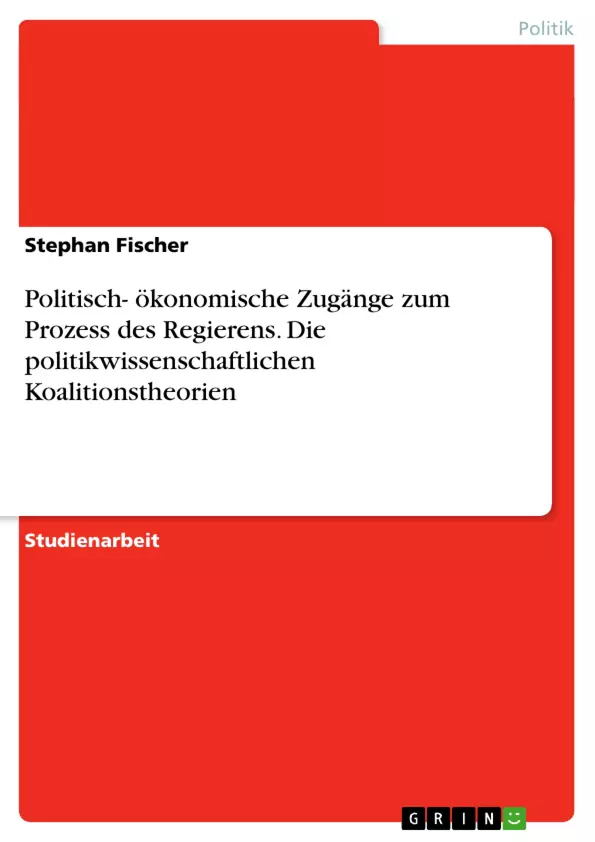Die politische Ökonomie bietet einen interessanten Ansatz, um politische Prozesse erklärbar und somit nachvollziehbar zu machen. In dieser Arbeit werden die politisch- ökonomischen Erklärungsansätze auf einen essentiell wichtigen Teil im Prozess des Regierens angewendet: Die Koalitionsbildung. Zunächst werden die unterschiedlichen Ansätze der politischen Ökonomie leicht verständlich erklärt, um sie sodann an einem konkreten Fallbeispiel – dem Koalitionsbildungsprozess nach der Landtagswahl in Sachsen 2004 – an der sozialen Wirklichkeit zu testen. Durch diesen empirischen Test wird deutlich, welcher Teil der sozialen Wirklichkeit unter Anwendung der politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien plausibel erklärt werden kann und wo diese Theorien ihre blinden Flecken haben bzw. die soziale Wirklichkeit nur sehr unvollkommen abbilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeispiel Sachsen
- Hauptteil
- Grundbegriffe und Grundannahmen der ökonomischen Theorie der Politik
- Die politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien
- Minimal winning und minimum size coalitions
- Fallbeispiel Sachsen
- Bewertung
- Minimal range und minimal connected winning coalitions
- Fallbeispiel Sachsen
- Bewertung
- Weiterentwickelte Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die voraussichtliche Koalitionsbildung im sächsischen Landtag nach der Wahl im September 2004 mithilfe politisch-ökonomischer Ansätze. Insbesondere die politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien stehen im Fokus der Untersuchung, um zu prognostizieren, welche Partei die sächsische CDU als Koalitionspartner wählen wird.
- Analyse der ökonomischen Theorie der Politik als Grundlage für Koalitionstheorien
- Anwendung verschiedener Koalitionstheorien (Minimal winning, Minimal range) auf das Fallbeispiel Sachsen
- Bewertung der Erklärungskraft der Koalitionstheorien anhand des sächsischen Fallbeispiels
- Beurteilung der Grenzen der Koalitionstheorien in Bezug auf die soziale Wirklichkeit
- Prognose der wahrscheinlichsten Koalitionskonstellation im sächsischen Landtag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Fallbeispiel Sachsen und die Forschungsfrage dar, welche Regierungskonstellation sich nach der Landtagswahl 2004 prognostizieren lässt. Sie erläutert zudem die Relevanz der Koalitionstheorien für die Erklärung des politischen Prozesses. Der Hauptteil beginnt mit einer Einführung in die ökonomische Theorie der Politik als theoretischer Rahmen für die Analyse von Koalitionsbildungsprozessen. Anschließend werden verschiedene politikwissenschaftliche Koalitionstheorien vorgestellt und anhand des Fallbeispiels Sachsen angewendet. Die Kapitel analysieren die Modelle Minimal winning und minimum size coalitions sowie Minimal range und minimal connected winning coalitions und bewerten ihre Aussagekraft in Bezug auf die sächsische Situation. Abschließend werden weitere, weiterentwickelte Ansätze in der Koalitionsforschung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Politisch-ökonomische Analyseansätze, Ökonomische Theorie der Politik, Koalitionstheorien, Minimal winning, Minimum size coalitions, Minimal range, Minimal connected winning coalitions, Fallbeispiel Sachsen, Sächsische Landtagswahl 2004, Koalitionsbildungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die ökonomische Theorie der Politik?
Ein Ansatz, der davon ausgeht, dass politische Akteure (Parteien, Politiker) rational handeln und versuchen, ihren eigenen Nutzen (z.B. Stimmen oder Macht) zu maximieren.
Welche Koalitionstheorien werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Modelle der "Minimal winning coalition" (kleinstmögliche Mehrheit) und der "Minimal range coalition" (geringste programmatische Distanz).
Warum wurde die Landtagswahl in Sachsen 2004 als Fallbeispiel gewählt?
Die Wahl bot eine komplexe Ausgangslage für die Koalitionsbildung, an der die Vorhersagekraft theoretischer Modelle empirisch getestet werden konnte.
Was sind "blinde Flecken" der Koalitionstheorien?
Theorien bilden die soziale Wirklichkeit oft nur unvollkommen ab, da sie Faktoren wie persönliche Abneigungen, historische Bindungen oder innerparteiliche Dynamiken vernachlässigen.
Was bedeutet "Minimal connected winning coalition"?
Welche Prognose wurde für Sachsen 2004 erstellt?
Die Arbeit untersucht mithilfe der Theorien, welche Partei am wahrscheinlichsten als Partner für die CDU infrage kam.
- Arbeit zitieren
- Stephan Fischer (Autor:in), 2004, Politisch- ökonomische Zugänge zum Prozess des Regierens. Die politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46573