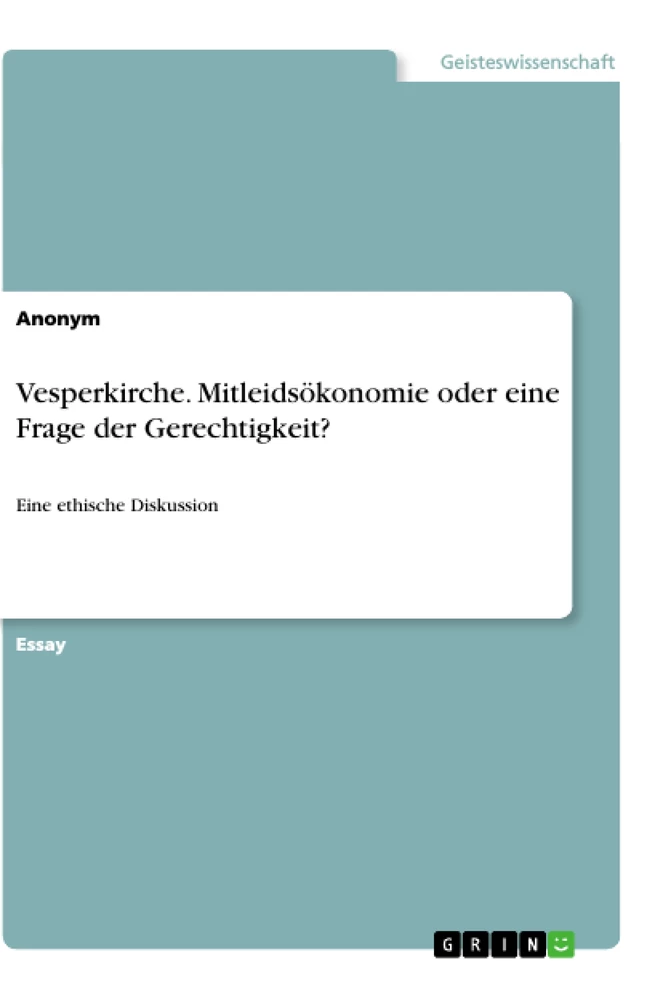Die Tafel feierte im Jahr 2018 ihr bereits 25-jähriges Bestehen. Nächstes Jahr wird die erste baden-württembergische Vesperkirche in Stuttgart genauso alt. Das gibt Anlass zu feiern, aber auch über diese sozialen Einrichtungen nachzudenken. Denn die Kritik an beiden Unterstützungsangeboten lautet: Sie stützen das unzureichende Sozialsystem und bekämpfen Armut damit nicht sondern verfestigen sie sogar. Sie schaffen keine wirkliche Teilhabe.
Armut wird in der vorliegenden Diskussion in einer multidimensionalen Perspektive verstanden. Die Armutserfahrung kann in sechs Dimensionen unterschieden werden: „materielle Armut, körperliche Schwäche, Isolation, psychische und physische Verletzlichkeit, Machtlosigkeit und spirituelle Armut“.
Am Beispiel der Vesperkirche im Schussental sollen in diesem Essay kontroverse Meinungen über die Notwendigkeit und das Bestehen dieser Unterstützungsangebote, insbesondere der Vesperkirchen, gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Inhalt
- Kritikpunkte an der Vesperkirche
- Darstellung der Vesperkirche im Schussental
- Ethische Diskussion
- Beteiligungs- und Teilhabegerechtigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Vesperkirche als soziale Einrichtung und setzt sie in den Kontext der Debatte um Armut und soziale Gerechtigkeit.
- Die Kritik an der Vesperkirche als „Mitleidsökonomie“
- Die Rolle der Vesperkirche in der Bewältigung von Armut und Ausgrenzung
- Die Prinzipien von Gleichheit und Teilhabe in der Vesperkirche
- Die ethische Dimension von Armut und soziale Gerechtigkeit
- Die Relevanz von Beteiligungs-, Verteilungs- und Befähigungsgerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung und Inhalt
Die Vesperkirche wird als soziale Einrichtung im Kontext des 25-jährigen Bestehens der Tafel und der Debatte um Armut und soziale Gerechtigkeit vorgestellt. Die Kritik an solchen Einrichtungen wird dargestellt und Armut in einer multidimensionalen Perspektive verstanden. Die Vesperkirche im Schussental wird als Beispiel für die kontroverse Diskussion um die Notwendigkeit und das Bestehen von Unterstützungsangeboten verwendet.
Kritikpunkte an der Vesperkirche
Kritiker sehen die Vesperkirche als ein Beispiel für „Mitleidsökonomie“, die Armut lindert, aber nicht bekämpft. Es wird argumentiert, dass die Vesperkirche keine nachhaltige Veränderung bewirkt und lediglich eine Lücke im Versorgungssystem schließt.
Darstellung der Vesperkirche im Schussental
Die Vesperkirche im Schussental wird als eine der größten Vesperkirchen in Baden-Württemberg vorgestellt. Das Projekt bietet drei Wochen im Winter einen Ort für günstiges Mittagessen, Begegnung und Kultur. Es setzt sich für die Bewältigung von Armut und Ausgrenzung ein und verfolgt die Prinzipien von Gleichheit und Teilhabe.
Ethische Diskussion
Die Kategorisierung von arm und reich wird als ein Instrument der Ausgrenzung betrachtet. Aus theologischer Sicht besteht der einzige Unterschied zwischen Gott und Mensch. Daher sollten Menschen trotz ihrer individuellen Differenzen gleiche Würde und Gerechtigkeit erfahren. Es werden drei Gerechtigkeitsansätze beleuchtet: Beteiligungs- und Teilhabegerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Befähigungsgerechtigkeit.
Beteiligungs- und Teilhabegerechtigkeit
Die „Option für die Armen“ wird als eine verpflichtende Sozialethik des Christentums beschrieben. Diese Option betont die vorrangige Liebe für die Armen und die Notwendigkeit ihrer Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Es wird kritisiert, dass die Vesperkirche die Beteiligungs- und Teilhabegerechtigkeit nicht ausreichend berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Vesperkirche, Mitleidsökonomie, Armut, soziale Gerechtigkeit, Beteiligungs- und Teilhabegerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Befähigungsgerechtigkeit, Gleichheit, Teilhabe, Ausgrenzung, Würde, Option für die Armen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Vesperkirche?
Eine Vesperkirche ist ein zeitlich begrenztes soziales Projekt in Kirchenräumen, das armen und einsamen Menschen günstiges Essen, Beratung und Gemeinschaft bietet.
Warum wird die Vesperkirche als „Mitleidsökonomie“ kritisiert?
Kritiker argumentieren, dass solche Angebote die Symptome von Armut lindern, aber das unzureichende Sozialsystem stützen und Armut dadurch eher verfestigen als bekämpfen.
Was sind die sechs Dimensionen der Armutserfahrung?
Dazu gehören materielle Armut, körperliche Schwäche, Isolation, psychische/physische Verletzlichkeit, Machtlosigkeit und spirituelle Armut.
Was bedeutet „Option für die Armen“ in der Sozialethik?
Es ist ein christliches Prinzip, das die vorrangige Zuwendung zu benachteiligten Menschen fordert und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ins Zentrum stellt.
Was ist der Unterschied zwischen Verteilungs- und Teilhabegerechtigkeit?
Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf materielle Güter, während Teilhabegerechtigkeit die Möglichkeit meint, aktiv und gleichberechtigt am sozialen Leben teilzunehmen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Vesperkirche. Mitleidsökonomie oder eine Frage der Gerechtigkeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465730