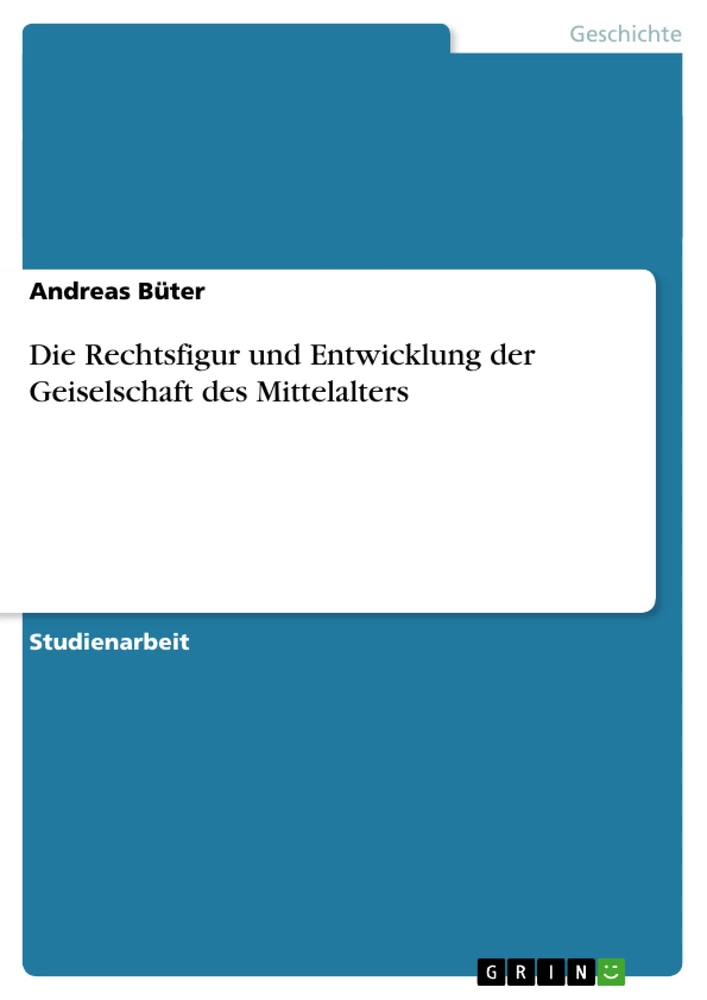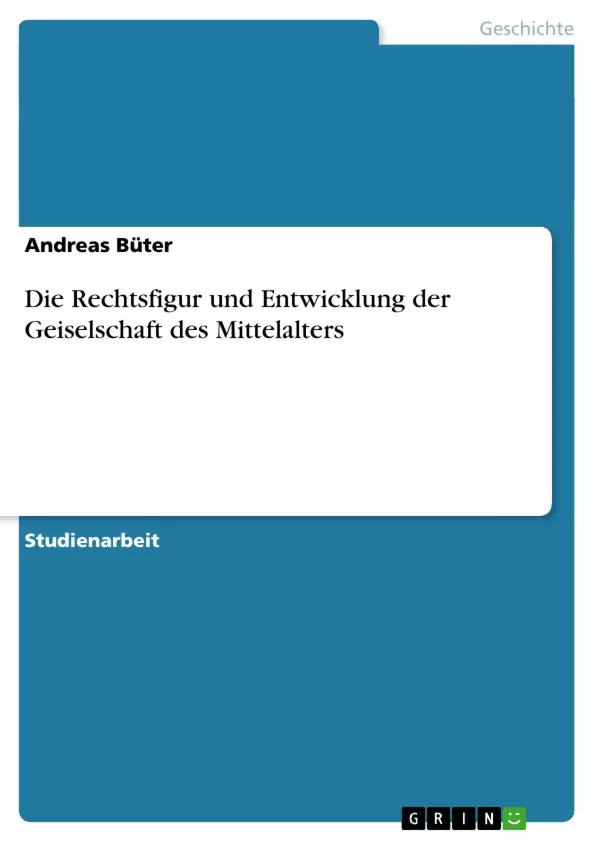Geisel, Geiselnahme, Geiselschaft, Vergeiselung, Personalpfand, Pfandknechtschaft, Einlager, Kriegsgeisel, Geiselvertrag, Beuterecht. -
Im Gesamtkontext der frühen Völkerrechtsausprägungen nimmt das Rechtsinstitut der Geiselschaft als Bestandteil der persönlichen Haftungsformen des Mittelalters eine herausragende Stellung ein. Dies liegt zum einen an der maximalen Offenbarung der Geisel gegenüber ihrem Herren, unter Umständen mit dem äußersten zu haften, was ein Mensch zu geben vermag, nämlich seinem Leben und seiner körperlichen Unversehrtheit. Eine andere Besonderheit besteht in der rechtsgeschichtlichen Entwicklung dieser Sicherungsform. Ihre Ursprünge reichen erwiesener Maßen bis weit in die Zeit vor der Antike zurück und sind als eine Urform der Absicherung vor Verlust, im frühen Rechtsverkehr vieler Kulturkreise festzustellen. An den verschiedenen Ausprägungen im Umgang mit Geiseln sind spätestens seit dem Mittelalter Entwicklungen zu den modernen Formen der Haftung und des Schuldrechts nachvollziehbar. Hierbei wird die immer weiter fortschreitende rechtliche Abstraktion der ursprünglich unmittelbaren persönlichen Verantwortung des einzelnen deutlich.
Dem methodischen Vorgehen dieser Arbeit liegt ein begriffsgeschichtlicher Ansatz zugrunde. Die zeitliche Eingrenzung des bearbeiteten Bereiches ist nicht ausschließlich auf das Mittelalter beschränkt, sondern erstreckt aus klärendem Anlass bis in die Neuzeit und vereinzelt sogar bis in Bereiche der aktuellen internationalen Völkerrechtssituation. Die themenbezogen umfangreichsten Quellen von de Victoria, Grotius und Vattel, welche innerhalb ihrer völkerrechtlichen Ausführungen auch intensiv das Thema der Geiselschaft behandeln, stammen ihrerseits aus der (frühen) Neuzeit. Diese Theoretiker und insbesondere Grotius bauen ihr thesenartiges Diskussionskonzept fast ausschließlich auf beispielhaften Ereignissen der Vergangenheit auf. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass diese Erörterungen trotz der mittelalterlichen und häufig antiken Heranziehungen, zwangsläufig eine bereits neuzeitliche Sichtweise widerspiegeln. Die jüngsten Untersuchungen zum Thema der Entwicklung von persönlichen Sicherheiten, welche die Geiselschaft als einen Teilbereich mitbehandeln, stammen größtenteils aus dem Spektrum der Rechtswissenschaft. An den in diesem Zusammenhang geführten rechtstheoretischen Kontroversen, insbesondere über den Ursprung der Bürgschaft, soll sich die vorliegende Arbeit jedoch nicht beteiligen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Herkunft und Bedeutung des Begriffs „Geisel“
- Sprachlicher Ursprung
- Historischer Bedeutungsbegriff
- 2. Die Rechtsnatur der Geiselschaft
- Das Personalpfand
- Stellung des Gläubigers
- Stellung des Schuldners / Geiselverfall
- 3. Der Geiselvertrag
- Rechtsproblematik des Realvertrags
- Zusicherungspflicht
- 4. Die Geisel im Privatrecht
- Formalien der Vergeiselung
- Schuld- und Pfandknechtschaft / Schulddienstbarkeit
- 5. Das Einlager
- Rechtliche Verlagerung auf die wirtschaftliche Seite
- Konsequenzpotential
- Nachteile/Missbräuche
- 6. Die Geisel im Völkerrecht
- 6.1. Die einseitige Geiselnahme / Androlepsie
- Bei zugrunde liegendem Anspruch / obligatorisch
- Ohne entsprechenden Anspruch / Repressalie
- Rechtfertigungsumstände
- Moderne Ausprägungen
- 6.2. Die Geiselschaft im Krieg
- Zurückbehaltungsrecht
- Geiselnahme von Unschuldigen
- Moralische Verhaltensmaßregeln
- ,,Weiterverkauf“ von Geiseln
- Problematik des Beuterechts
- Letzte Geiselverträge
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Rechtsinstituts der Geiselschaft im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Sie beleuchtet die Bedeutung der Geiselschaft im Kontext der persönlichen Haftungsformen des Mittelalters und verfolgt die evolutionäre Entwicklung dieser Sicherungsform, die ihre Wurzeln bis in die Zeit vor der Antike zurückverfolgt werden kann.
- Der sprachliche Ursprung und die historische Bedeutung des Begriffs „Geisel“
- Die Rechtsnatur der Geiselschaft als Personalpfand und die rechtliche Stellung des Gläubigers und des Schuldners
- Der Geiselvertrag als Realvertrag und seine rechtlichen Besonderheiten
- Die Anwendung der Geiselschaft im Privatrecht und ihre Rolle in der Schuld- und Pfandknechtschaft
- Die Entwicklung der Geiselschaft im Völkerrecht, einschließlich der einseitigen Geiselnahme (Androlepsie) und ihrer Anwendung im Kriegsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Geiselschaft als ein zentrales Element der persönlichen Haftungsformen im Mittelalter vor. Im Anschluss wird die sprachliche und historische Entwicklung des Begriffs „Geisel“ beleuchtet, wobei die vielfältigen Bedeutungsnuancen des Wortes im Laufe der Geschichte aufgezeigt werden. Das zweite Kapitel widmet sich der Rechtsnatur der Geiselschaft als Personalpfand und analysiert die rechtliche Stellung sowohl des Gläubigers als auch des Schuldners, einschließlich des Geiselverfalls. Kapitel 3 befasst sich mit dem Geiselvertrag als Realvertrag und erläutert dessen rechtliche Besonderheiten, insbesondere die Zusicherungspflicht. Im vierten Kapitel wird die Anwendung der Geiselschaft im Privatrecht untersucht, wobei die Formalien der Vergeiselung und die Rolle der Geiselschaft in der Schuld- und Pfandknechtschaft im Vordergrund stehen. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Einlager, einer besonderen Form der Geiselschaft, die sich auf die wirtschaftliche Seite verlagert. Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen dieser Entwicklung, sowie die potentiellen Nachteile und Missbräuche. Schließlich wird in Kapitel 6 die Geiselschaft im Völkerrecht analysiert, wobei die einseitige Geiselnahme (Androlepsie) sowie die Anwendung der Geiselschaft im Kriegsrecht im Detail beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Geiselschaft, Personalpfand, Gläubiger, Schuldner, Geiselverfall, Geiselvertrag, Realvertrag, Zusicherungspflicht, Schuld- und Pfandknechtschaft, Einlager, Androlepsie, Kriegsrecht, Völkerrecht, Mittelalter, Frühe Neuzeit.
- Arbeit zitieren
- Andreas Büter (Autor:in), 2004, Die Rechtsfigur und Entwicklung der Geiselschaft des Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46609