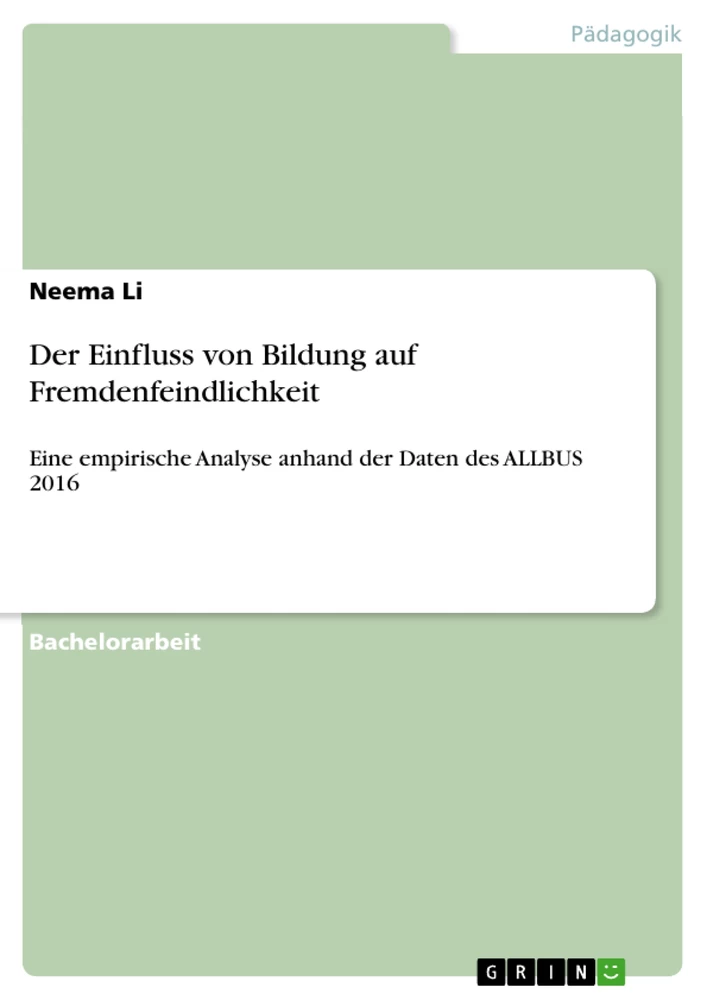Im Rahmen der zu verfassenden Bachelorarbeit mit dem Titel Der Einfluss von Bildung auf Fremdenfeindlichkeit: Eine empirische Analyse anhand der Daten des ALLBUS 2016 und der Forschungsfrage Inwiefern wirkt sich Bildung auf die Ausbildung fremdenfeindlicher Einstellungen aus? soll deshalb dieser Zusammenhang neu untersucht und vermittelnde Mechanismen des Zusammenhangs aufgedeckt sowie deren Erklärungskraft ermittelt werden.
Die Arbeit gliedert sich dabei wie folgt: Zunächst wird der theoretische Hintergrund dargelegt (Kapitel 2). Dabei wird zu Anfang der präventive Einfluss von Bildung auf die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen erläutert. Außerdem werden die grundlegenden Konzepte der untersuchten Mechanismen der relativen Deprivation, der Anomia, des Autoritarismus und der Bedrohung beschrieben. In Kapitel 3 werden daraus vierzehn Hypothesen abgeleitet, sowie ein Pfadmodell aufgestellt, bevor in Kapitel 4 der aktuelle Forschungsstand skizziert wird. Die methodische Beschreibung des Forschungsvorhabens wird in Kapitel 5 ausgeführt, wobei auf die Datenbasis des ALLBUS 2016, die Definition der Untersuchungspopulation, die Stichprobenziehung und Gewichtung sowie das statistische Vorgehen eingegangen wird. Zu Beginn des 6. Kapitels wird die Operationalisierung der verwendeten Variablen beschrieben, sowie deskriptive Maßzahlen angegeben. Daran schließt ein ausführlicher Bericht über die Ergebnisse der bi- und multivariaten Analysen an. Nachfolgend werden die Ergebnisse separat nochmals kurz zusammengefasst. Die Arbeit schließt mit der Zusammenfassung und Diskussion der empirischen Befunde sowie einem Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsvorhaben (Kapitel 7).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Bildung und fremdenfeindliche Einstellungen
- Deprivationstheoretischer Ansatz: Relative Deprivation
- Modernisierungstheoretischer Ansatz: Anomia und Desintegration
- Sozialisationstheoretischer Ansatz: Autoritarismus
- Bedrohungstheoretischer Ansatz: Realistische und symbolische Bedrohung
- Zusammenfassung der Hypothesen
- Empirische Ausgangslage
- Bildung und fremdenfeindliche Einstellungen
- Deprivation, Anomia und Autoritarismus
- Realistische und symbolische Bedrohung
- Methode
- Datenbasis
- Definition der Untersuchungspopulation
- Stichprobenziehung und Gewichtung
- Statistisches Vorgehen
- Empirische Ergebnisse
- Operationalisierung der Variablen und deskriptive Maßzahlen
- Bivariate Ergebnisse
- Multivariate Ergebnisse
- Zusammenfassung und Diskussion
- Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Bildung auf fremdenfeindliche Einstellungen. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und der Ausbildung fremdenfeindlicher Einstellungen, indem sie vermittelnde Mechanismen identifiziert und deren Erklärungskraft ermittelt. Die Arbeit analysiert dabei die Daten des ALLBUS 2016.
- Der präventive Einfluss von Bildung auf die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen
- Der Zusammenhang zwischen Bildung und fremdenfeindlichen Einstellungen
- Die Rolle von Deprivation, Anomia und Autoritarismus
- Der Einfluss realistischer und symbolischer Bedrohungen
- Empirische Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Bildung und fremdenfeindlichen Einstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Themas Fremdenfeindlichkeit im aktuellen gesellschaftlichen Kontext und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund des Forschungsprojekts. Es werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, die den Einfluss von Bildung auf die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen beleuchten. In Kapitel 3 werden die aus den theoretischen Überlegungen abgeleiteten Hypothesen und ein Pfadmodell zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Bildung und fremdenfeindlichen Einstellungen präsentiert. Kapitel 4 bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Kapitel 5 widmet sich der methodischen Beschreibung der Arbeit, erläutert die Datenbasis des ALLBUS 2016 und beschreibt die Stichprobenziehung, Gewichtung und das statistische Vorgehen. In Kapitel 6 werden die Operationalisierung der verwendeten Variablen sowie deskriptive Maßzahlen vorgestellt. Die Ergebnisse der bivariaten und multivariaten Analysen werden ausführlich präsentiert. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und diskutiert, sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bildung, Fremdenfeindlichkeit, relative Deprivation, Anomia, Autoritarismus, realistische und symbolische Bedrohung sowie empirische Sozialforschung. Sie analysiert die Daten des ALLBUS 2016 mit dem Ziel, den Einfluss von Bildung auf die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen zu erforschen und vermittelnde Mechanismen zu identifizieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Bildung auf fremdenfeindliche Einstellungen aus?
Die Bachelorarbeit untersucht den präventiven Einfluss von Bildung und geht der Frage nach, inwiefern ein höheres Bildungsniveau die Ausbildung fremdenfeindlicher Ressentiments verhindert.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung herangezogen?
Es werden der deprivationstheoretische (relative Deprivation), modernisierungstheoretische (Anomia), sozialisationstheoretische (Autoritarismus) und bedrohungstheoretische Ansatz analysiert.
Was ist der Unterschied zwischen realistischer und symbolischer Bedrohung?
Realistische Bedrohung bezieht sich auf den Wettbewerb um Ressourcen (Jobs, Wohnraum), während symbolische Bedrohung die Gefährdung eigener kultureller Werte und Normen meint.
Welche Rolle spielen Anomia und Desintegration?
Diese Konzepte beschreiben einen Zustand der Orientierungslosigkeit und mangelnden gesellschaftlichen Einbindung, der als Nährboden für Fremdenfeindlichkeit dienen kann.
Welche Datenbasis nutzt die empirische Analyse?
Die Untersuchung basiert auf den Daten des ALLBUS 2016 (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften).
- Citation du texte
- Neema Li (Auteur), 2019, Der Einfluss von Bildung auf Fremdenfeindlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/466520