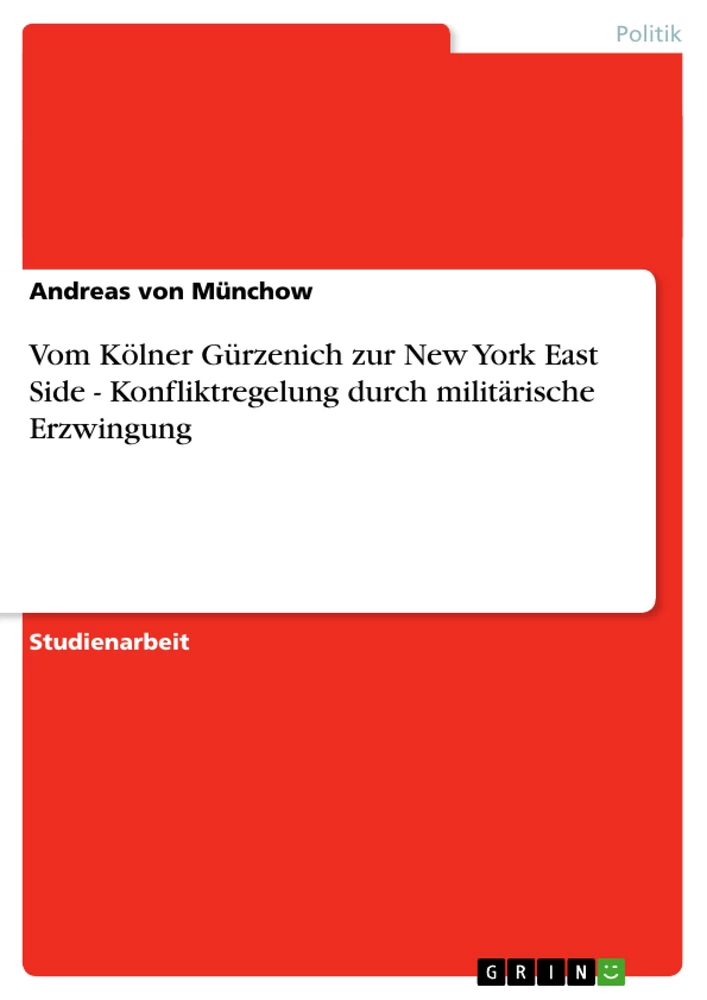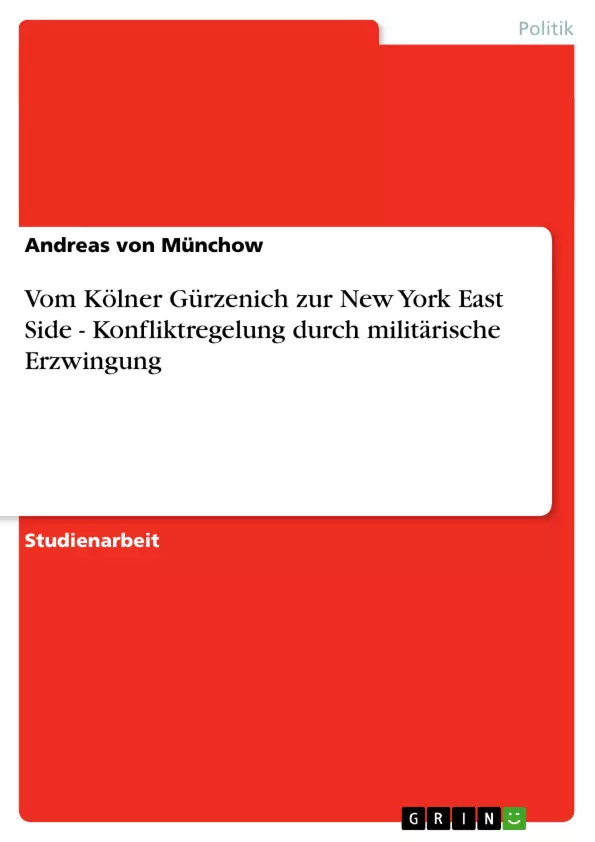So titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Ausgabe vom 14. März diesen Jahres. Die Präsidenten Montenegros und Serbiens, Djukanovic und Kostunica sowie der Hohe Beauftragte der EU für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Javier Solana, unterzeichneten am 13. März in Belgrad ein Abkommen, das die Grundzüge eines zukünftigen Staates mit dem Namen „Serbien und Montenegro“ festlegt. Ein neuer Staat ist freilich aus der ehemaligen Serbischen Republik Jugoslawien noch nicht entstanden, endgültige Stabilität in der Region noch in weiter Ferne.
Die Vorgeschichte zu diesem Ereignis ist lang: Am 24. März des Jahres 1999 gingen die ersten Bomben und Cruise Missiles auf Jugoslawien nieder. Die Operation „Allied Force“ hatte begonnen, die NATO griff nach gescheiterten und langwierigen diplomatischen Versuchen, Milosevic zu einem Ende der ethnischen Säuberungen des albanischen Teils der Bevölkerung in der jugoslawischen Provinz Kosova zu bewegen, zu den Waffen. Mit den Worten des Militärphilosophen Carl von Clausewitz: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“.
Nach elf Wochen war der Luftkrieg der NATO beendet. Sollte es der letzte Krieg in Europa gewesen sein?
Diese Arbeit soll sich mit der Operation „Allied Force“, den alliierten Luftschlägen auf Jugoslawien beschäftigen. Dabei sollen vor allem Antworten auf die Fragen gefunden werden, wie der militärisch-operative Ablauf der Operation aussah, welche Interessen und Ziele die einzelnen Akteure zu jener Zeit verfolgten, welche diplomatischen Vermittlungsversuche erfolgten und welche Kritikpunkte am Engagement der NATO geäußert werden können.
Um die Problematik der Situation im Kosovo besser verstehen zu können, die letztendlich zum militärischen Eingreifen der NATO geführt hat, sollen eingangs - ohne zu sehr in die Geschichte des Balkans, respektive der Bundesrepublik Jugoslawien, hinabtauchen zu wollen - besonders die Ereignisse der Phase der militärischen Eskalation des Kosovo-Konfliktes aufgezeigt werden. Diese Phase läßt sich etwa Anfang Februar/Anfang März 1998 mit den ersten Offensiven serbischer Sicherheitskräfte gegen die „Befreiungsarmee des Kosovo“, die UCK, datieren. Ihren Höhepunkt fand diese Phase dann am 24. März 1999 mit dem Beginn der Operation „Allied Force“.
Inhaltsverzeichnis
- „Das Ende der Bundesrepublik Jugoslawien“
- Der Weg in den Krieg
- Titos Tod und der „großserbische“ Gedanke
- Militärische Eskalation: Der beginnende Freiheitskampf der UCK
- Von Racak nach Rambouillet
- Konfliktregelung durch militärische Erzwingung: Die Operation „Allied Force“
- Der 23. März 1999: Der Beginn von „Allied Force“
- Die militärstrategische und operative Entwicklung
- Die einzelnen Phasen der Operation
- Das militärische Potential
- Probleme bei der Durchführung von „Allied Force“
- Militärisches Konfliktbild
- Bilanz der Operation „Allied Force“
- Operation „Allied Harbour“
- Die Akteure
- Die NATO
- Rußlands Rolle im Kosovo Krieg
- Die Bundesrepublik Jugoslawien
- Die UCK
- Mazedonien und Albanien
- Wie soll der Krieg beendet werden? Diplomatische Bemühungen und Schlußverhandlungen
- Lehren aus dem Kosovo-Krieg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Operation „Allied Force“, die NATO-Luftschläge auf Jugoslawien, und beleuchtet insbesondere den militärisch-operativen Ablauf der Operation. Sie untersucht die Interessen und Ziele der beteiligten Akteure, die diplomatischen Vermittlungsversuche und die Kritikpunkte am NATO-Engagement. Um die Problematik des Kosovo-Konfliktes besser zu verstehen, werden auch die Ereignisse der Phase der militärischen Eskalation aufgezeigt.
- Der militärische Ablauf der Operation „Allied Force“
- Die Interessen und Ziele der beteiligten Akteure
- Diplomatische Vermittlungsversuche
- Kritikpunkte am NATO-Engagement
- Die Phase der militärischen Eskalation des Kosovo-Konfliktes
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet den Hintergrund der Operation „Allied Force“ und erläutert die politische Situation im ehemaligen Jugoslawien, die zur Intervention der NATO führte.
- Kapitel 2 beschreibt die Eskalation des Kosovo-Konfliktes, beginnend mit dem Tod Titos und dem Aufstieg des „großserbischen Gedankens“. Es werden die militärischen Eskalationen und die Rolle der UCK beleuchtet.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Operation „Allied Force“ selbst, beschreibt den Beginn der Luftangriffe, die einzelnen Phasen der Operation und die militärischen Potentiale sowie Probleme der Operation. Es werden außerdem die militärische Konfliktlage und die Bilanz der Operation analysiert.
- Kapitel 4 stellt die wichtigsten Akteure des Kosovo-Krieges vor, darunter die NATO, Russland, die Bundesrepublik Jugoslawien, die UCK sowie Mazedonien und Albanien.
- Kapitel 5 befasst sich mit den diplomatischen Bemühungen und Schlußverhandlungen, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollten.
- Kapitel 6 befasst sich mit den Lehren aus dem Kosovo-Krieg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Kosovo-Krieges, darunter die Operation „Allied Force“, die militärische Intervention der NATO, die politische Situation im ehemaligen Jugoslawien, die Rolle des „großserbischen Gedankens“, die ethnischen Säuberungen im Kosovo, die UCK und die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts. Die Analyse beleuchtet auch die verschiedenen Akteure, die an dem Konflikt beteiligt waren, und die kritischen Aspekte des NATO-Engagements.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Operation „Allied Force“?
Es handelt sich um die NATO-Luftangriffe auf die Bundesrepublik Jugoslawien im Jahr 1999 zur Beendigung des Kosovo-Konflikts.
Warum griff die NATO militärisch ein?
Ziel war es, die ethnischen Säuberungen an der albanischen Bevölkerung im Kosovo durch das Milosevic-Regime zu stoppen.
Welche Rolle spielte die UCK?
Die Befreiungsarmee des Kosovo (UCK) führte einen bewaffneten Freiheitskampf gegen serbische Sicherheitskräfte, was zur Eskalation beitrug.
Welche Kritikpunkte gab es am NATO-Einsatz?
Die Arbeit untersucht Probleme bei der Durchführung, die völkerrechtliche Legitimität und die Auswirkungen der Luftschläge.
Wie wurde der Krieg diplomatisch beendet?
Nach elf Wochen Luftkrieg führten diplomatische Vermittlungen, unter anderem durch Russland, zu Schlussverhandlungen und dem Abzug serbischer Truppen.
- Quote paper
- Andreas von Münchow (Author), 2002, Vom Kölner Gürzenich zur New York East Side - Konfliktregelung durch militärische Erzwingung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46735