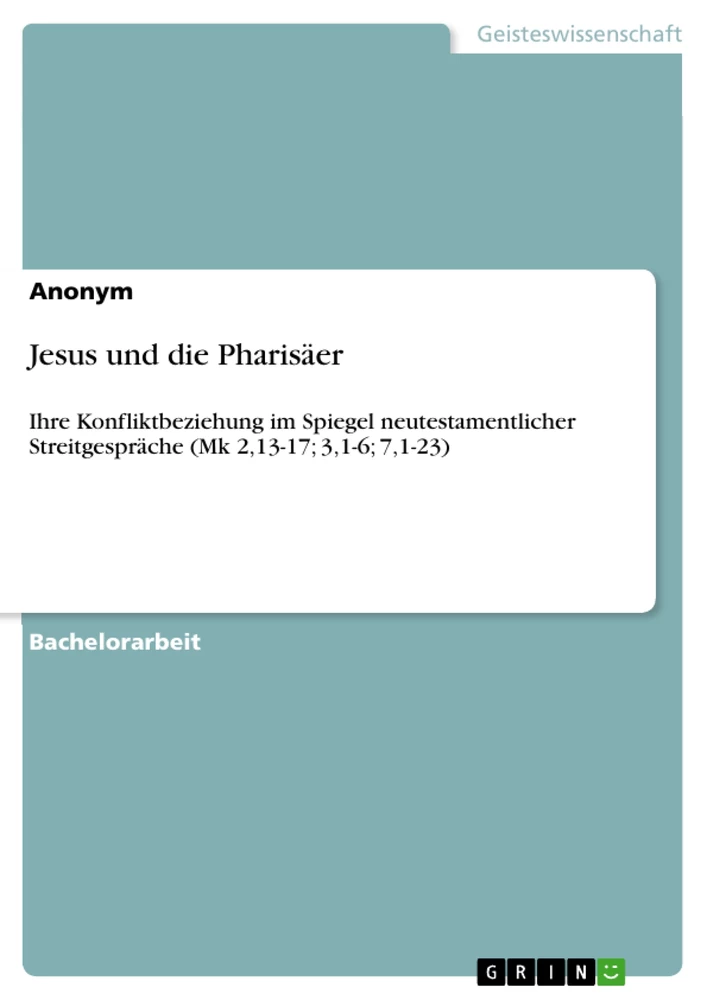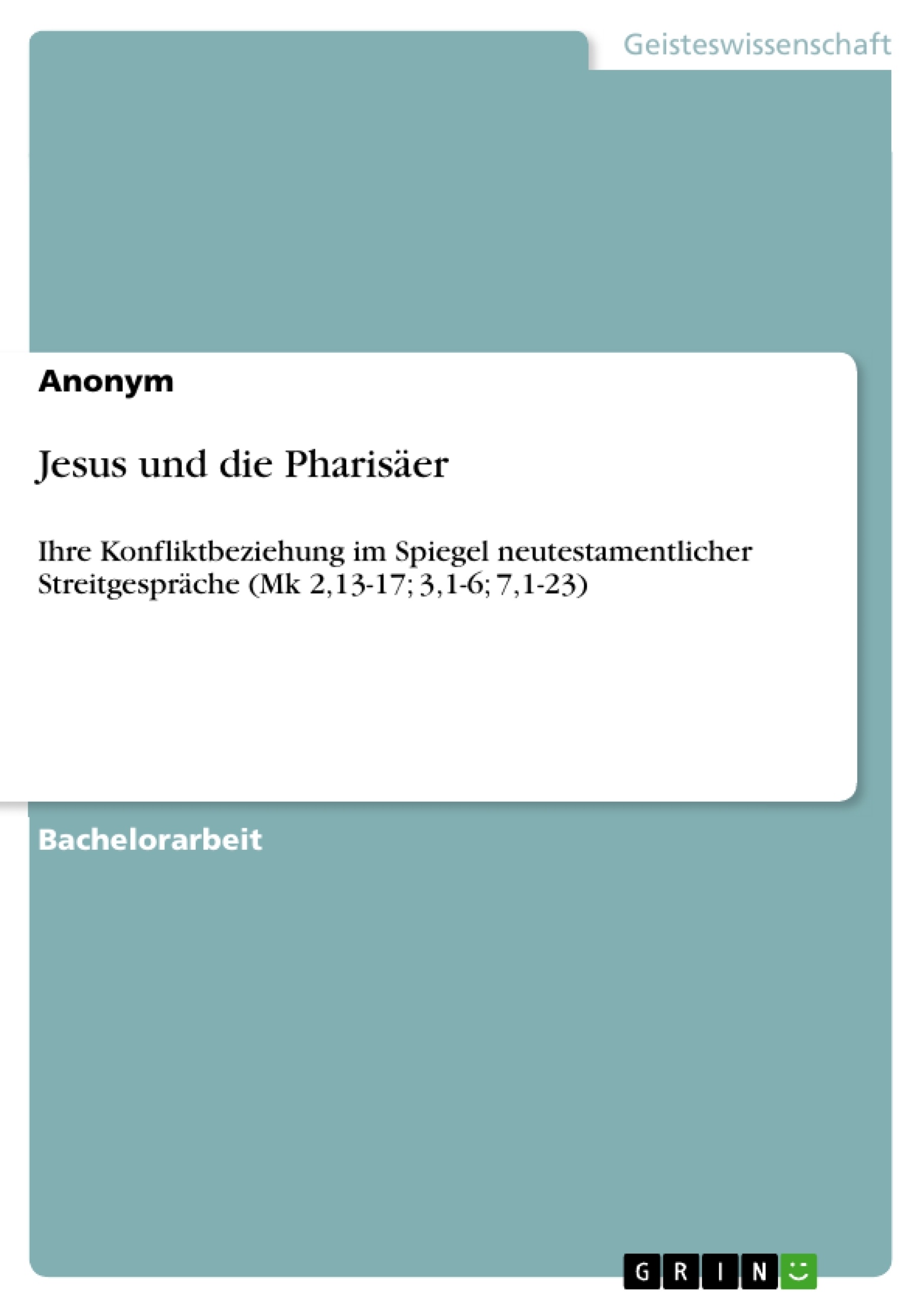Denkt man an Auseinandersetzungen im Neuen Testament, ist keine jüdische Religionspartei so präsent wie die Pharisäer, was sie gleichzeitig zu einer der wichtigsten Gruppierungen zur Zeit Jesu macht. Laut Deines sind die Pharisäer „die grundlegende und prägende religiöse Strömung innerhalb des palästinischen Judentums zwischen 150 v. Chr. und 70 n. Chr.“. Es finden sich im Neuen Testament zahlreiche Konfliktsituationen zwischen Jesus und den Pharisäern, denen hauptsächlich verschiedene Meinungen über das jüdische Gesetz, wie Reinheitsvorschriften und –gesetze, zugrunde liegen. Doch sie waren sich keinesfalls so unähnlich wie man bei der Anzahl ihrer Auseinandersetzungen denken müsste.
Jesus kannte die jüdischen Schriften ebenso gut wie die Pharisäer selbst und verfolgte ähnliche Ziele. Auch hatten sie die Sammlung einer Schüler- bzw. Jüngergemeinschaft sowie eine Laienbewegungen gemeinsam, die die Grenzen von Tempel und
Tempelkult überschreiten. Doch wie kam es dazu, dass Jesus und die Pharisäer trotz der Gemeinsamkeiten ständig in Konflikt standen? Dieser Frage soll diese Arbeit auf den Grund gehen.
Zu Beginn werde ich mich mit der Quellengrundlange beschäftigen. Anschließend werde ich die Pharisäer vorstellen und näher auf die Geschichte, ihre Glaubensvorstellungen, Gesetze und Schriftauslegung eingehen. Darauffolgend werde ich die drei zentralen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern, die im Markusevangelium wiedergegeben werden, analysieren, um Gründe und Motive herausarbeiten zu können. Als Grundlage dient in dieser Arbeit die Zürcher Bibel. Des
Weiteren nutze ich die beiden Werke „Jüdische Altertümer“ und „Der jüdische Krieg“ des Jospehus Flavius, übersetzt von Dr. Heinrich Clementz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Quellengrundlage
- 3. Die Pharisäer
- 3.1. Geschichte des Pharisäismus
- 3.2. Glaubensvorstellung
- 3.3. Gesetze
- 3.4. Schriftauslegung
- 4. Auseinandersetzungen mit Jesus
- 4.1. Jesus hält Mahl mit Zöllnern und Sündern (Mk 2,13-17)
- 4.2. Die Heilung eines behinderten Mannes am Sabbat (Mk 3,1-6)
- 4.3. Zur Frage nach der Reinheit (Mk 7,1-23)
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konfliktbeziehung zwischen Jesus und den Pharisäern im Neuen Testament, insbesondere anhand der im Markusevangelium beschriebenen Streitgespräche. Ziel ist es, die Gründe und Motive dieser Konflikte zu ergründen, trotz bestehender Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und den Pharisäern.
- Die historische und religiöse Einordnung der Pharisäer
- Die Glaubensvorstellungen, Gesetze und Schriftauslegung der Pharisäer
- Analyse der zentralen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern im Markusevangelium
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Jesus und den Pharisäern
- Erklärung der Ursachen der Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Pharisäer im Neuen Testament heraus und hebt die zahlreichen Konfliktsituationen zwischen Jesus und den Pharisäern hervor, die vor allem auf unterschiedliche Auffassungen des jüdischen Gesetzes beruhen. Trotz dieser Konflikte weist die Einleitung auf Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und den Pharisäern hin, wie z.B. die ähnliche Zielsetzung und die Bildung von Jüngergemeinschaften. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt werden.
2. Quellengrundlage: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Quellenforschung zum Thema Pharisäismus. Es identifiziert Josephus Flavius' Werke und das Neue Testament als wichtigste Quellen, wobei die jeweiligen Limitationen und Perspektiven betont werden. Die Objektivität beider Quellen wird hinterfragt, da Josephus möglicherweise selbst Pharisäer war und das Neue Testament die Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern fokussiert. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Quellen.
3. Die Pharisäer: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Geschichte, Glaubensvorstellungen, Gesetze und Schriftauslegung der Pharisäer. Es beleuchtet ihren Ursprung und ihre Entwicklung als bedeutende jüdische Gruppierung im Kontext anderer Gruppen wie der Sadduzäer und Essener. Die Bedeutung der "Absonderung" als zentraler Aspekt der pharisäischen Identität wird diskutiert. Es wird ausserdem auf die soziale Zusammensetzung der Gruppe eingegangen und die Bedeutung ihrer breiten Verankerung im Volk hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Pharisäer, Jesus, Judentum, Neues Testament, Markusevangelium, jüdisches Gesetz, Streitgespräche, Quellengrundlage, Glaubensvorstellungen, Schriftauslegung, Konflikt, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Jesus und die Pharisäer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konfliktbeziehung zwischen Jesus und den Pharisäern im Neuen Testament, insbesondere anhand der im Markusevangelium beschriebenen Streitgespräche. Ziel ist es, die Gründe und Motive dieser Konflikte zu ergründen, trotz bestehender Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und den Pharisäern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische und religiöse Einordnung der Pharisäer, deren Glaubensvorstellungen, Gesetze und Schriftauslegung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der zentralen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern im Markusevangelium, einschließlich einer Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Gruppen und einer Erklärung der Ursachen der Konflikte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die wichtigsten Quellen sind die Werke von Josephus Flavius und das Neue Testament. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen bei der Quellenforschung und betont die jeweiligen Limitationen und Perspektiven beider Quellen, einschließlich der Frage nach deren Objektivität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Quellengrundlage, Die Pharisäer, Auseinandersetzungen mit Jesus und Zusammenfassung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Kapitel 2 diskutiert die Quellen. Kapitel 3 bietet eine umfassende Einführung in den Pharisäismus. Kapitel 4 analysiert ausgewählte Konfliktpunkte im Markusevangelium. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche konkreten Beispiele für Auseinandersetzungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die folgenden Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern im Markusevangelium: Jesus hält Mahl mit Zöllnern und Sündern (Mk 2,13-17), die Heilung eines behinderten Mannes am Sabbat (Mk 3,1-6) und die Frage nach der Reinheit (Mk 7,1-23).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pharisäer, Jesus, Judentum, Neues Testament, Markusevangelium, jüdisches Gesetz, Streitgespräche, Quellengrundlage, Glaubensvorstellungen, Schriftauslegung, Konflikt, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit (ohne detaillierte Inhaltsangabe)?
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Jesus und den Pharisäern, untersucht die Hintergründe ihrer Konflikte und zeigt gleichzeitig Gemeinsamkeiten auf. Sie betont die Bedeutung einer kritischen Quellenanalyse und bietet ein umfassendes Verständnis des Pharisäismus im Kontext des Neuen Testaments.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Jesus und die Pharisäer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/467900