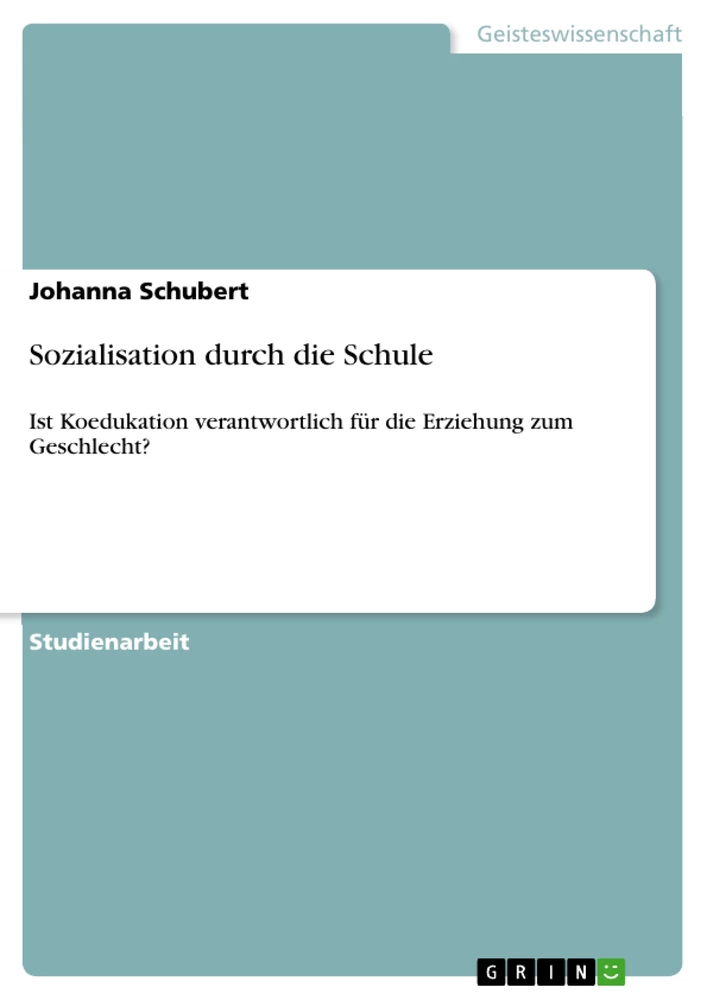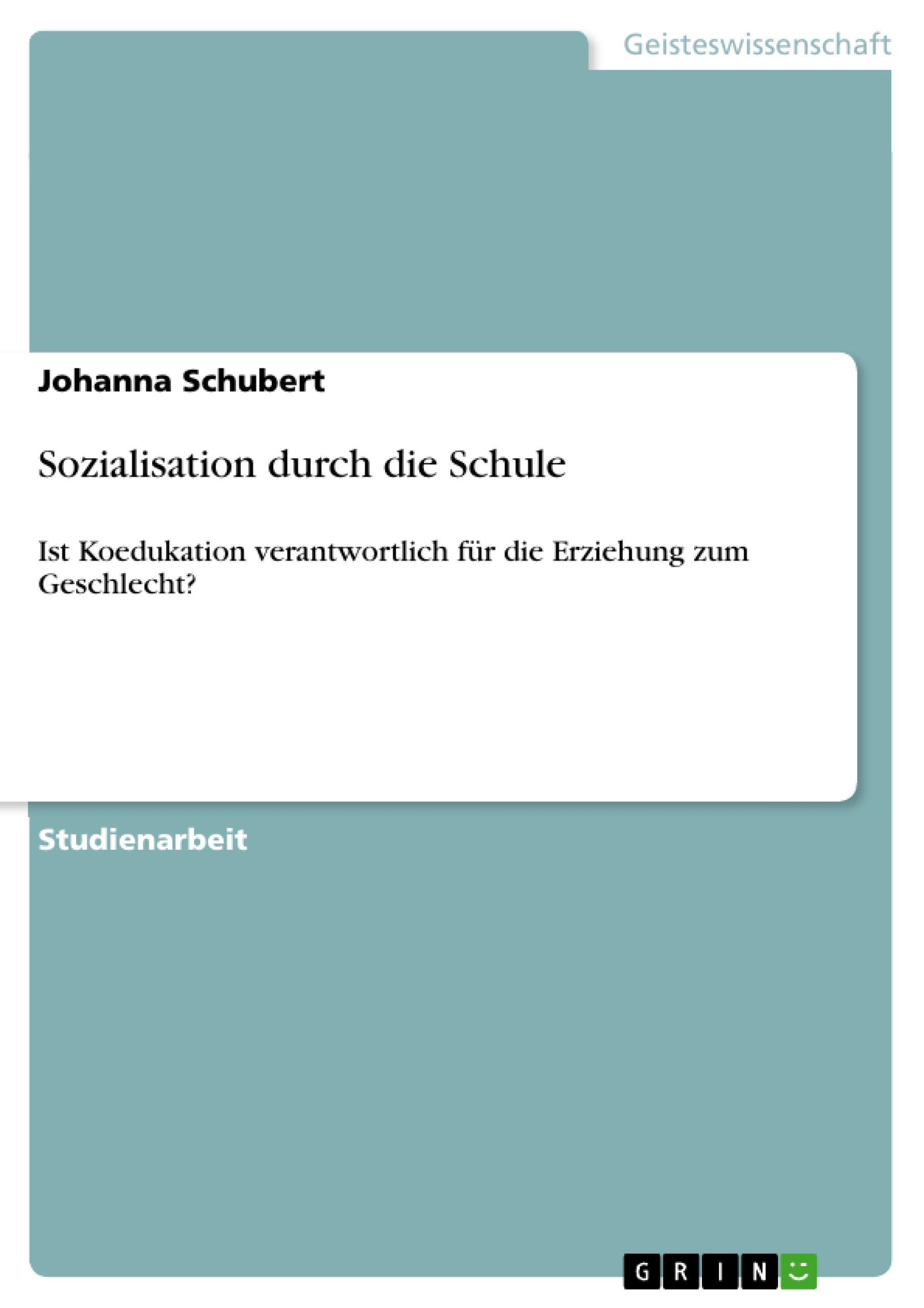Welche Strukturen der Schule führen zu dieser Vermittlung und Verfestigung von geschlechtsspezifischen Rollen und wie kann man ihnen entgegenwirken? Dies sind die Leitfragen, welche in der folgenden Arbeit thematisiert werden.
Sozialisation ist ein zentrales Thema, in dem man sich mit den Lebenswelten und der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen befasst. In der Sozialen Arbeit ist dieses Thema von hoher Bedeutung, da der Sozialarbeiter mithilfe von Sozialisationstheorien gewisse Hintergründe von sozialem Handeln verstehen und nachvollziehen kann. Um sich genauer mit Sozialisation auseinanderzusetzen muss man diese zunächst definieren und theoretisch einordnen, da mittlerweile vielfältige Definitionen und Theorien zu diesem Thema vorhanden sind.
Die theoretische Basis dieser Arbeit bildet die Sozialisationstheorie von Ulrich Beck, der die Individualisierung durch den gesellschaftlichen Wandel kritisch betrachtet. Um das Thema Sozialisation einzugrenzen, befasst sich die folgende Arbeit ausschließlich mit der Sozialisation durch die Schule, da sie eine zentrale Sozialisationsinstanz darstellt. Mit dieser Funktion wird die Schule vor verschiedene Aufgaben gestellt, deren Bearbeitung wichtige pädagogische Fähigkeiten fordert.
Eine Aufgabe besteht darin, Werte, Normen und Rollen zu vermitteln. Hierbei besteht die Gefahr, dass in der Schule stereotype Geschlechterrollen vermittelt und verfestigt werden. Diese prägen die Entwicklung der Jugendlichen und grenzen sie ein.
Inhaltsverzeichnis
- Sozialisation durch die Schule und ihre Vermittlung von Geschlechterrollen
- Definition von Sozialisation und ihre theoretische Einordnung nach Ulrich Beck.
- Schule als Sozialisationsinstanz
- Aufgaben und Funktionen der Schule
- Koedukation - Verfestigung der Geschlechterrollen?
- Reflexive Koedukation
- Aufgaben und Handlungsperspektiven für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter.
- Individuelle Gestaltung der Sozialisation durch reflexive Koedukation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sozialisation durch die Schule und ihren Einfluss auf die Vermittlung von Geschlechterrollen. Sie analysiert, wie schulische Strukturen traditionelle Geschlechterrollen reproduzieren können und welche Möglichkeiten es gibt, reflexive Koedukation zu fördern, um diese Tendenzen zu überwinden.
- Definition und Einordnung der Sozialisationstheorie von Ulrich Beck im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Schule als zentrale Sozialisationsinstanz und ihre Aufgaben
- Die Rolle der Koedukation bei der Verfestigung von Geschlechterrollen
- Reflexive Koedukation als Ansatz zur individuellen Gestaltung der Sozialisation
- Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der Sozialisation und seiner Einordnung in die theoretische Diskussion. Es stellt die Individualisierungstheorie von Ulrich Beck vor und analysiert, wie sich gesellschaftliche Veränderungen auf die Sozialisationsprozesse auswirken.
- Das zweite Kapitel betrachtet die Schule als zentrale Sozialisationsinstanz. Es beleuchtet die verschiedenen Aufgaben und Funktionen der Schule, die Bedeutung der Koedukation und die Gefahr der Verfestigung von Geschlechterrollen.
- Das dritte Kapitel analysiert die Möglichkeit der reflexiven Koedukation als Ansatz zur individuellen Gestaltung der Sozialisation. Es diskutiert, wie Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter einen Beitrag zur Förderung der Selbstfindung und eigenständigen Persönlichkeitsentwicklung von Schülern leisten können.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Schule, Geschlechterrollen, Koedukation, reflexive Koedukation, Individualisierung, Ulrich Beck, Bildungsinstitution, Sozialisationsinstanz, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Pädagogik, Gesellschaft, Kultur, Werte, Normen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt die Schule als Sozialisationsinstanz?
Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch gesellschaftliche Werte, Normen und Verhaltensweisen, die die Persönlichkeitsentwicklung prägen.
Was ist "reflexive Koedukation"?
Ein pädagogischer Ansatz, der Geschlechterrollen im Unterricht kritisch hinterfragt, um stereotype Zuweisungen zu vermeiden und individuelle Entfaltung zu fördern.
Welche Theorie vertritt Ulrich Beck zur Sozialisation?
Beck betont die Individualisierung durch gesellschaftlichen Wandel, wobei Menschen zunehmend gezwungen sind, ihre eigene Biografie selbst zu gestalten.
Verfestigt Koedukation Geschlechterrollen?
Die Arbeit analysiert die Gefahr, dass gemeinsamer Unterricht ohne Reflexion unbewusst traditionelle Rollenbilder reproduzieren kann.
Welche Aufgaben haben Schulsozialarbeiter hierbei?
Sie unterstützen Schüler bei der Identitätsfindung und helfen Lehrkräften, pädagogische Strategien gegen Rollenklischees zu entwickeln.
- Quote paper
- Johanna Schubert (Author), 2016, Sozialisation durch die Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468172