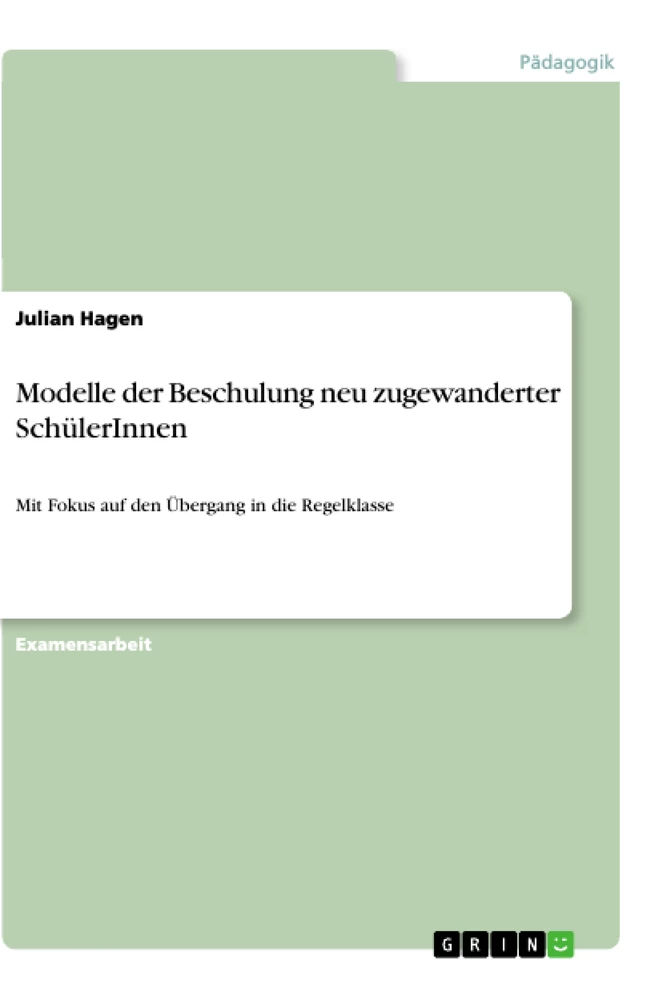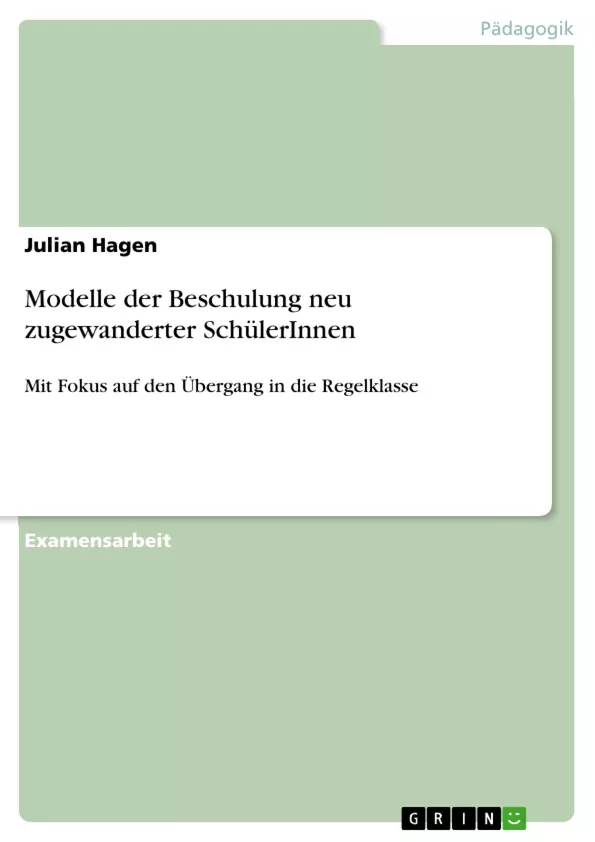Diese Examensarbeit expliziert in erster Linie die differenten Modelle der Beschulung für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche und erörtert anhand zahlreicher Studien Vor- und Nachteile dieser Beschulungskonzepte. Vorab wird ein kurzer historischer Überblick zu den Beschulungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sowie eine Übersicht zu rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben. Des Weiteren werden die vielfältigen Unterschiede im Unterrichten von sogenannten autochthonen SuS und neu immigrierten SuS dargelegt.
Die Kardinalfrage lautet: Wie können neu zugewanderte Menschen, von denen viele im schulpflichtigen Alter sind und mit sehr heterogenen Eigenschaften sowie Lebens- und Bildungsbiografien daherkommen, in das hiesige Bildungssystem integriert werden? Wie ist es der Bildungsanstalt Schule möglich, Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen zu einem Abschluss zu führen, um diesen somit einen Einstieg sowohl in die soziale Gesellschaft als auch später und damit einhergehend in das Berufsleben zu offerieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historie der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler
- Rahmenbedingungen: Rechtliches, Organisatorisches und Administratives zur Beschulung neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher
- ZDF - Zahlen, Daten und Fakten zu schulpflichtigen Flüchtlingen in Deutschland
- Rechtliche Richtlinien
- UN-Konventionen und Genfer Konvention (GFK)
- Bildung ist Ländersache
- Organisatorische und administrative Rahmenbedingungen
- Verordnungen zur Beschulung von neu immigrierten SuS
- Zuweisung und Aufnahme einer Schule
- Zuweisung einer Alters- und Klassenstufe
- Besonderheiten und Spannungsfelder im Unterricht mit neu immigrierten SuS
- Methodisch-didaktische Ebene: Binnendifferenzierung und sprachliche Kompetenzen
- Organisatorische Ebene: Fluktuation, Leistungsbeurteilung und Übergangsgestaltung
- Psychologische Ebene: Sozialisierung und Traumata
- Modelle der Beschulung mit Fokus auf dem Übergang in die Regelklasse
- Unterscheidung der Termini Förderklasse, Förderkurs, Förderunterricht
- Einführung der Modelle
- Modell 1: Temporär separate Beschulung in ausschließlich eigener Klasse mit anschließendem Übergang in die Regelklasse
- Die Termini Auffangklasse und Vorbereitungsklasse
- Modell 1.1: Mit reiner Sprachförderung
- Modell 1.2: Mit integriertem Fachunterricht
- Modell 2: Teil-Integration: Konglomerat aus temporär separater Beschulung in Deutsch-Förderklasse und partiellem Fachunterricht in Regelklasse mit anschließendem vollständigen Übergang in Regelklasse
- Modell 2.1: Mit sukzessiver Teilintegration in Regelklasse
- Modell 2.2: Mit unmittelbarer, kumulativer Teilintegration in Regelklasse
- Modell 2.3: Mit konstanter Stundenzahl in Regelklasse und festgelegtem Übergangszeitpunkt
- Modell 3: Voll-Integration: Unmittelbarer Fachunterricht in Regelklasse mit spezifischer Deutschförderung
- Modell 3.1: Mit additiver Deutschförderung
- Modell 3.2: Mit integrierter Deutschförderung
- Modell 3.3: Kombinierte Variante: Additive und integrierte Deutschförderung
- Modell 4: Der submersive Ansatz: Unmittelbarer Regelunterricht ohne spezifische Deutschförderung
- Die Übergangsprozedur als Schlüsselfaktor
- Gelingensbedingungen für den Übergang
- Instrument der Überprüfung: Komplexität und Problematik von adäquaten Sprachstandserhebungen für neu zugewanderte SuS
- Modell 1: Temporär separate Beschulung in ausschließlich eigener Klasse mit anschließendem Übergang in die Regelklasse
- Transfer der Modelle auf die Schulstufen
- Modelle der Beschulung für die Primarstufe
- Modelle der Beschulung für die Sekundarstufe I
- Modelle der Beschulung für die Sekundarstufe II
- Besonderheit: Modell der Beschulung für berufsbildende Schulen: Das Parallelmodell mit Schulabschluss
- „Potenzial-Vergleich“ der Modelle: Stärken, Schwächen und Gelingenskriterien
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den aktuellen Modellen der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf dem Übergang der Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Modelle, untersucht die Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang und beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die sich aus der Heterogenität der Schülerschaft ergeben.
- Rechtliche Rahmenbedingungen und organisatorische Strukturen der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler
- Modelle der Beschulung mit Fokus auf dem Übergang in die Regelklasse
- Gelingensbedingungen und Herausforderungen des Übergangs in die Regelklasse
- Methodisch-didaktische Besonderheiten im Unterricht mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern
- Sprachliche Herausforderungen und Fördermöglichkeiten für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Kapitel 3 widmet sich den rechtlichen, organisatorischen und administrativen Rahmenbedingungen, die für die Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler gelten. Dabei werden die wichtigsten Verordnungen, Richtlinien und Strukturen beleuchtet. Kapitel 4 untersucht die besonderen Herausforderungen, die sich im Unterricht mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern ergeben. Es werden die methodisch-didaktischen, organisatorischen und psychologischen Aspekte beleuchtet.
Kapitel 5 stellt die verschiedenen Modelle der Beschulung mit Fokus auf dem Übergang in die Regelklasse vor. Dabei werden die verschiedenen Ansätze und Modelle, die in Deutschland angewandt werden, detailliert beschrieben und analysiert. Kapitel 6 transferiert die Modelle der Beschulung auf die verschiedenen Schulstufen. Es werden die Besonderheiten der Beschulung für die Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II sowie für berufsbildende Schulen beleuchtet. Kapitel 7 führt einen Vergleich der verschiedenen Modelle durch. Es werden die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle sowie die relevanten Gelingenskriterien beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Beschulung, Integration, Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung, Inklusion, Heterogenität, Übergang in die Regelklasse, Modelle der Beschulung, Gelingensbedingungen, Sprachstandserhebung, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.
- Arbeit zitieren
- Julian Hagen (Autor:in), 2019, Modelle der Beschulung neu zugewanderter SchülerInnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468182