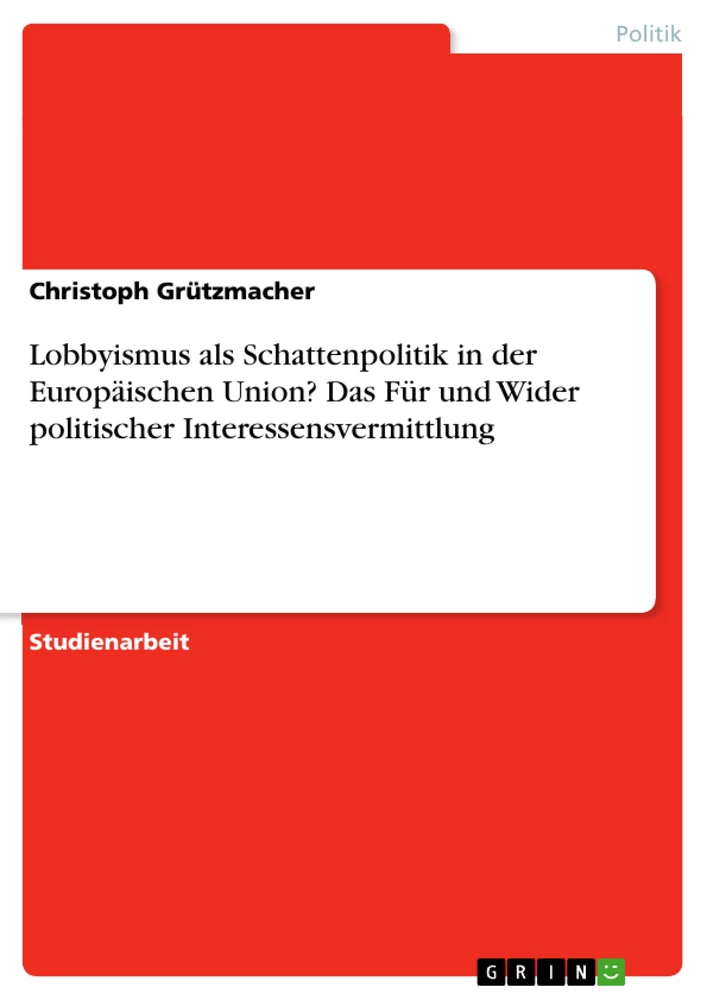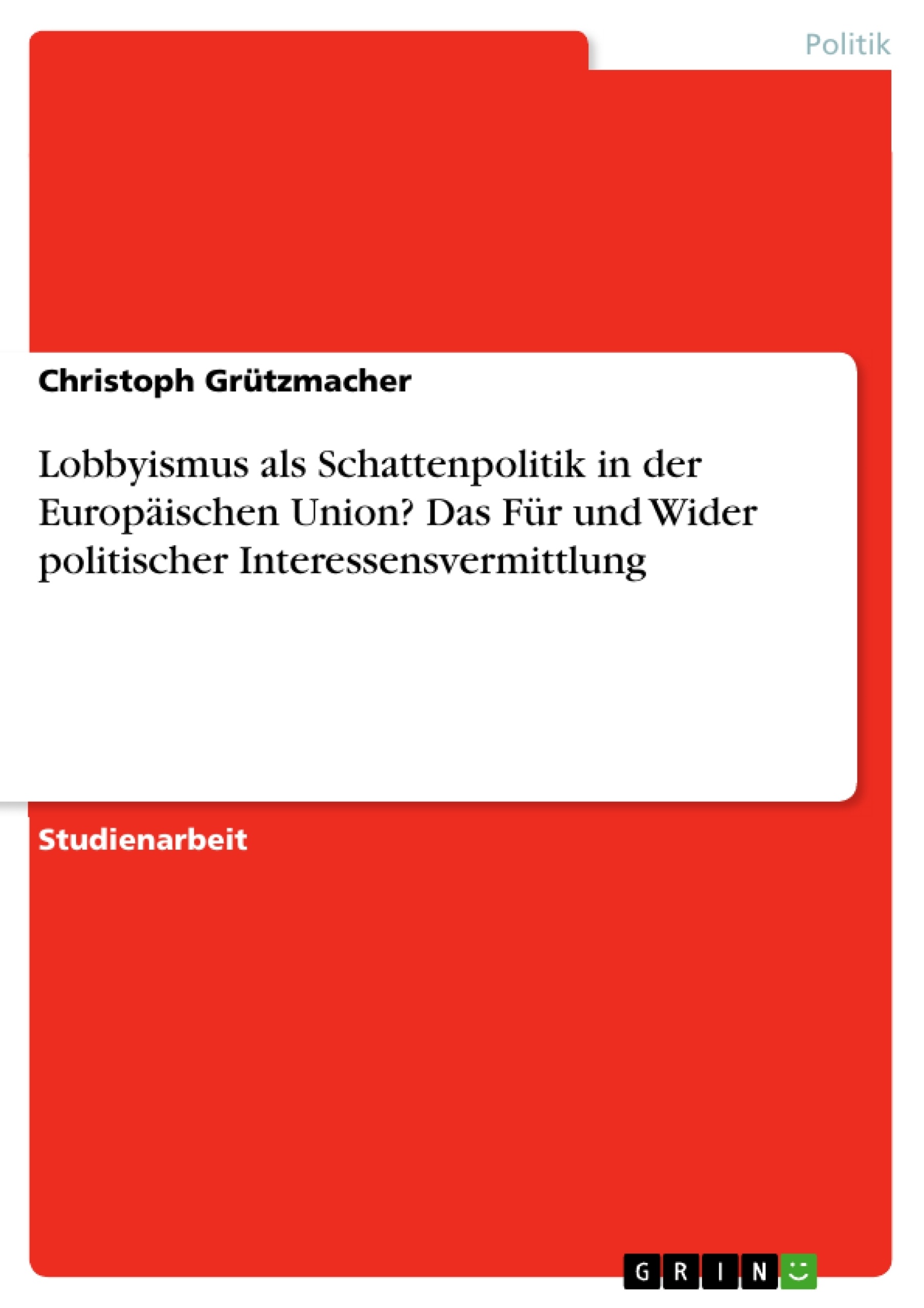Lässt sich Lobbyismus als neutrale und wertfreie Erscheinung darstellen, oder ist dieser per se als unrechtmäßige Beeinflussung der Politik zu verstehen, die nicht mit den Grundsätzen der Mandatsträger in Einklang zu bringen ist? Wie sind die einzelnen Theorien, Sichtweisen und Argumentationen zu gewichten? Wo sind eventuelle Schwachstellen vorhanden, wo Kontradiktionen mit der Realität identifizierbar? Dies sind die wesentlichen Fragen, die dieser Arbeit zugrunde liegen und beispielhaft anhand des Lobbyismus auf EU-Ebene behandelt werden sollen.
In regelmäßigen Abständen berichten Medien über "Spendenskandale", in die Spitzenpolitiker angeblich verwickelt sind. So musste sich beispielsweise die FDP Anfang des Jahres 2010 für eine Parteispende in Millionenhöhe rechtfertigen, die ein Hotelleriemagnat auf ein Parteikonto überwiesen hatte. Ein Zusammenhang zwischen der Spende und der kurz zuvor eingeführten Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen wurde zwar von beiden Seiten vehement bestritten, dennoch bemühten vor allem Oppositionspolitiker geradezu reflexartig Redewendungen wie "Käuflichkeit von Politik", "Lobbyismusfalle" oder "Schattenpolitik".
Lobbyismus polarisiert. Was für den einen als essentieller Bestandteil einer funktionierenden Demokratie gilt, wird von anderen als Einfallstor für Vetternwirtschaft und illegitime Überartikulation von Partikularinteressen angeprangert. Von jeglicher Wertung losgelöst, sind Lobbyisten zuvorderst Netzwerker, die auf Basis eines pluralistischen Grundverständnisses ein Geflecht sozialer, wirtschaftlicher und politischer Beziehungen zu anderen Personen oder Organisationen anstreben, um auf dem Weg der Kooperation, der Unterstützung und des Austausches die eigenen Interessen und Ziele erreichen zu können. Ob dieser Berufsstand den oben angeführten Vorurteilen gerecht wird soll in der vorliegenden Arbeit exemplarisch am Beispiel des Lobbyismus in der Europäischen Union untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Demokratietheoretischer Diskurs
- 2.1 Pluralismus und Neopluralismus
- 2.2 Korporatismus und Neokorporatismus
- 2.3 Kritik
- 2.4 Antikritik
- III. Spezifika von Lobbyismus in der Europäischen Union
- 3.1 Historische Entwicklung
- 3.2 Organisation und Aufgabenfelder
- 3.3 Lobbyismus als Faktor im politischen Entscheidungsprozess
- IV. Argumentation für und gegen Lobbyismus
- 4.1 Argumente für Lobbyismus
- 4.1.1 Politikberatung
- 4.1.2 Politische Partizipation
- 4.1.3 Entlastung des Staates
- 4.2 Argumente gegen Lobbyismus
- 4.2.1 Aushöhlung des Demokratieprinzips
- 4.2.2 Korruptionsanfälligkeit
- 4.2.3 Intransparenz
- 4.1 Argumente für Lobbyismus
- V. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Lobbyismus in der Europäischen Union und analysiert seine Rolle im politischen Entscheidungsprozess. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven auf Lobbyismus im Rahmen des demokratietheoretischen Diskurses beleuchtet, insbesondere der Pluralismus, der Neopluralismus, der Korporatismus und der Neokorporatismus. Darüber hinaus werden die spezifischen Merkmale des Lobbyismus in der Europäischen Union im Hinblick auf seine historische Entwicklung, Organisation und Aufgabenfelder sowie seine Auswirkungen auf den politischen Entscheidungsprozess untersucht.
- Demokratietheoretischer Diskurs im Kontext des Lobbyismus
- Spezifika des Lobbyismus in der Europäischen Union
- Argumente für und gegen Lobbyismus
- Lobbyismus als Einflussfaktor im politischen Entscheidungsprozess
- Bewertung der Rolle des Lobbyismus in einer demokratischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Lobbyismus dar und führt in die Thematik ein. Das zweite Kapitel analysiert den demokratietheoretischen Diskurs im Kontext des Lobbyismus, wobei die verschiedenen Konzepte des Pluralismus, des Neopluralismus, des Korporatismus und des Neokorporatismus beleuchtet werden. Im dritten Kapitel werden die Spezifika des Lobbyismus in der Europäischen Union betrachtet, einschließlich seiner historischen Entwicklung, Organisation und Aufgabenfelder sowie seiner Auswirkungen auf den politischen Entscheidungsprozess. Das vierte Kapitel beleuchtet die Argumente für und gegen Lobbyismus, wobei sowohl die positiven Aspekte, wie beispielsweise die Politikberatung, die politische Partizipation und die Entlastung des Staates, als auch die negativen Aspekte, wie die Aushöhlung des Demokratieprinzips, die Korruptionsanfälligkeit und die Intransparenz, berücksichtigt werden. Abschließend erfolgt in einem Resümee eine persönliche Bewertung der Ergebnisse und eine Diskussion der Bedeutung des Lobbyismus in einer demokratischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Lobbyismus, Europäische Union, Demokratie, Pluralismus, Neopluralismus, Korporatismus, Neokorporatismus, Politikberatung, Politische Partizipation, Korruption, Intransparenz, Entscheidungsprozess, Interessenvermittlung, Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Untersuchung zum Lobbyismus?
Die Arbeit analysiert, ob Lobbyismus eine legitime politische Interessenvermittlung darstellt oder als illegitime "Schattenpolitik" in der EU zu werten ist.
Welche Demokratietheorien werden im Kontext von Lobbyismus behandelt?
Es werden Konzepte des Pluralismus, Neopluralismus, Korporatismus und Neokorporatismus diskutiert.
Was sind die Hauptargumente für Lobbyismus?
Befürworter nennen die Politikberatung durch Experten, die Förderung politischer Partizipation und die Entlastung staatlicher Institutionen.
Welche Kritikpunkte gibt es am Lobbyismus in der EU?
Kritiker bemängeln die Aushöhlung des Demokratieprinzips, die Korruptionsanfälligkeit und die mangelnde Transparenz der Einflussnahme.
Wie wird Lobbyismus in der Arbeit definiert?
Lobbyisten werden als Netzwerker verstanden, die auf Basis pluralistischer Beziehungen versuchen, eigene Ziele durch Kooperation und Austausch zu erreichen.
- Quote paper
- Christoph Grützmacher (Author), 2011, Lobbyismus als Schattenpolitik in der Europäischen Union? Das Für und Wider politischer Interessensvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468196