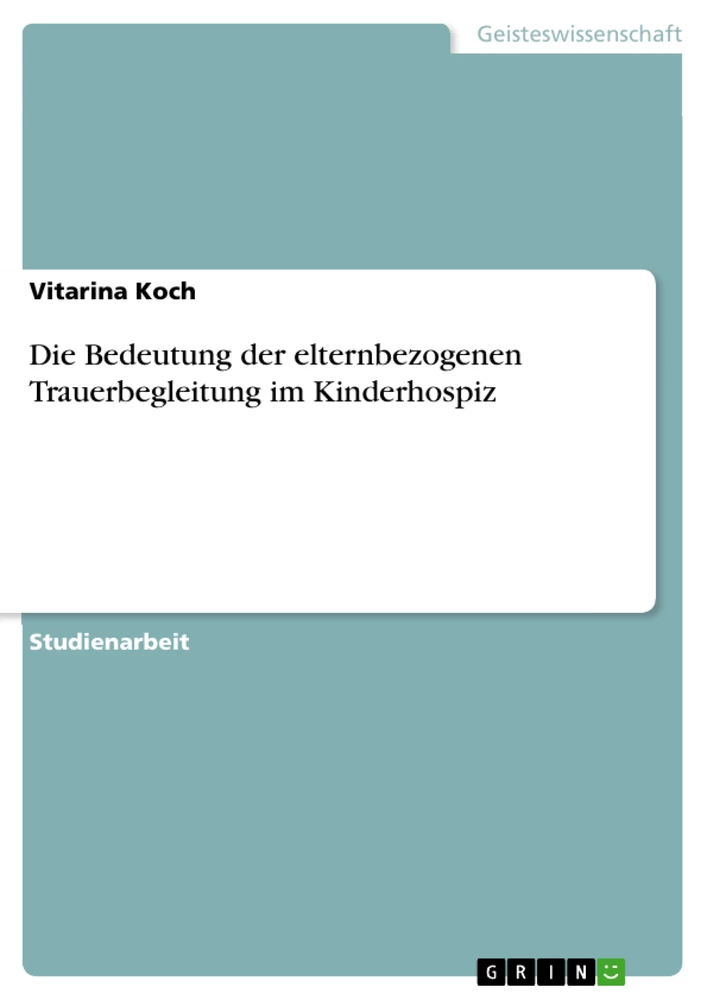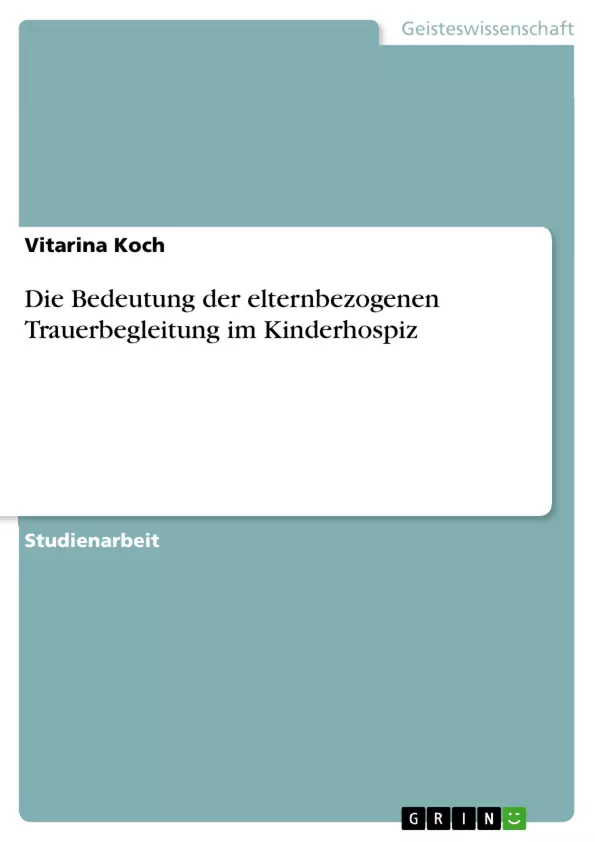Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der elternbezogenen Trauerbegleitung in einem Kinderhospiz. Die Hausarbeit ist so aufgebaut, dass erst die Begrifflichkeiten Tod, Kinderhospiz und Trauerbegleitung / Trauerarbeit definiert werden. Im darauf folgenden Kapitel wird das Kinderhospiz mit den Zielen und Aufgaben, Leitlinien und den stationären und ambulanten Kinderhospizen beschrieben. Im vierten Kapitel wird die Trauerbegleitung näher beschrieben mit den Unterpunkten die Trauerarbeit vor und nach dem Tod und der Beerdigung. Daraufhin folgt ein Kapitel über die Soziale Arbeit im Kinderhospiz, die Aufgaben von Sozialarbeiter*innen, das Konzept Empowerment im Kinderhospiz und die Adressaten der Sozialen Arbeit im Kinderhospiz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Tod......
- 2.2 Kinderhospiz.
- 2.3 Trauerbegleitung / Trauerarbeit.
- 3. Kinderhospizarbeit..
- 3.1 Ziele und Aufg..
- 3.2 Leitli
- 3.3 Ambulante und Stationäre Kinderhos.
- 4. Trauerarbeit mit den Eltern..
- 4.1 Trauerarbeit vor und nach dem Tod
- 4.2 Die Rolle der Beerdigung......
- 5. Soziale Arbeit im Hospiz...
- 5.1 Soziale Arbeit im Kinderhospiz.
- 5.2 Empowerment im Kinderhospiz ....
- 5.3 Sozialarbeiter*in in einem Kinderhospiz
- 5.4 Adressaten......
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung der elternbezogenen Trauerbegleitung im Kinderhospiz. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Aspekte der Trauerarbeit mit den Eltern im Kontext der unheilbaren Krankheit ihres Kindes.
- Die verschiedenen Facetten der Trauerarbeit im Kontext der elternbezogenen Trauerbegleitung
- Die Rolle des Kinderhospizes in der Unterstützung von Familien mit schwer kranken Kindern
- Die Bedeutung des Empowerments von Familien im Kinderhospiz
- Die Aufgaben von Sozialarbeiter*innen im Kinderhospiz
- Die Herausforderungen und Chancen der Trauerarbeit mit den Eltern im Kinderhospiz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der elternbezogenen Trauerbegleitung im Kinderhospiz einführt und die Relevanz des Themas hervorhebt. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe wie Tod, Kinderhospiz und Trauerbegleitung definiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kinderhospizarbeit. Es werden die Ziele, Aufgaben und Leitlinien der Kinderhospizarbeit erläutert, sowie die Unterschiede zwischen ambulanter und stationärer Betreuung. Im vierten Kapitel steht die Trauerarbeit mit den Eltern im Fokus. Hier werden die spezifischen Herausforderungen der Trauerarbeit vor und nach dem Tod des Kindes, sowie die Rolle der Beerdigung beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Sozialen Arbeit im Kinderhospiz. Die Aufgaben von Sozialarbeiter*innen, das Empowerment-Konzept und die Adressaten der Sozialen Arbeit im Kinderhospiz werden genauer betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: Kinderhospiz, Trauerbegleitung, Elternbezogene Trauerarbeit, Empowerment, Soziale Arbeit, Palliative Care, Schwerstkranke Kinder, Tod, Sterbebegleitung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der elternbezogenen Trauerbegleitung?
Ziel ist es, Eltern schwerstkranker Kinder sowohl vor als auch nach dem Tod ihres Kindes emotional zu unterstützen und sie in ihrem Trauerprozess zu begleiten.
Wie unterscheiden sich ambulante und stationäre Kinderhospize?
Stationäre Hospize bieten eine zeitweise Aufnahme des Kindes und der Familie, während ambulante Dienste die Familien zu Hause im Alltag unterstützen und entlasten.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Kinderhospiz?
Sozialarbeiter unterstützen Familien bei rechtlichen und finanziellen Fragen, bieten psychosoziale Beratung an und setzen Konzepte wie Empowerment zur Stärkung der Selbsthilfe um.
Wann beginnt die Trauerarbeit im Kinderhospiz?
Trauerarbeit beginnt oft schon weit vor dem eigentlichen Tod des Kindes (antizipatorische Trauer) und setzt sich über die Beerdigung hinaus fort.
Was bedeutet Empowerment im Kontext der Hospizarbeit?
Empowerment zielt darauf ab, die Ressourcen der betroffenen Eltern und Geschwister zu aktivieren, damit sie trotz der belastenden Situation handlungsfähig bleiben.
- Quote paper
- Vitarina Koch (Author), 2017, Die Bedeutung der elternbezogenen Trauerbegleitung im Kinderhospiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468240