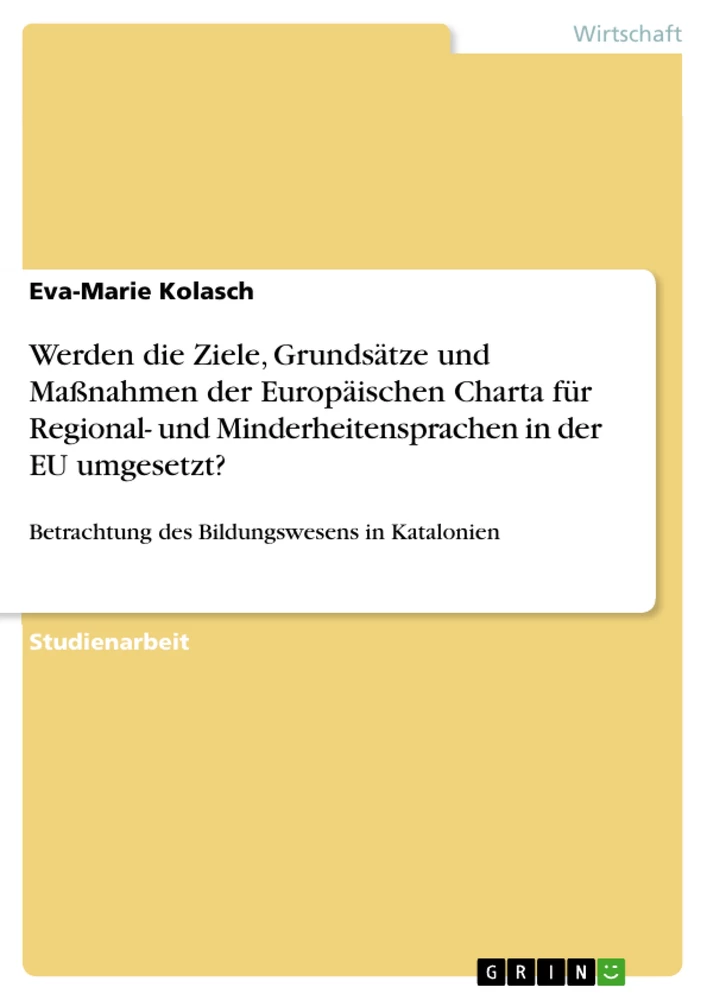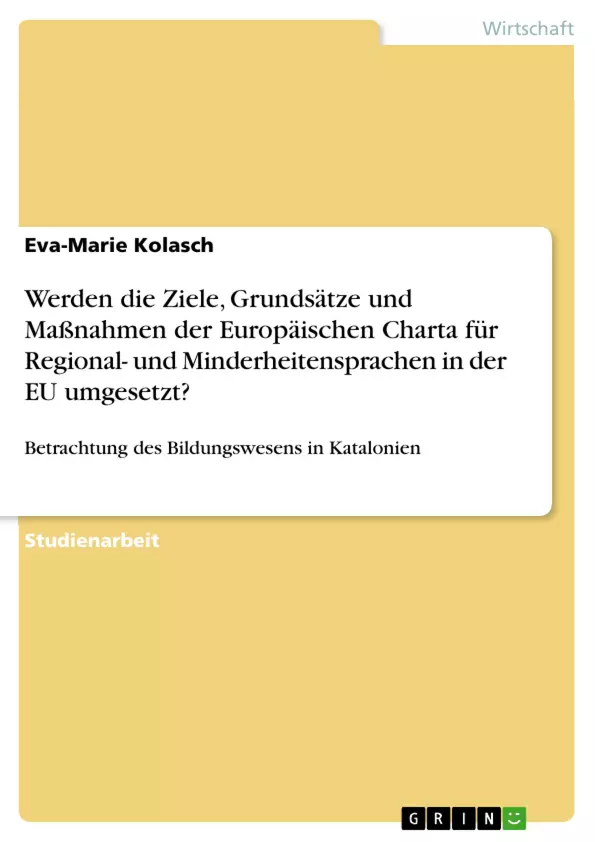Ziel dieser Seminararbeit ist es, herauszufinden, ob die Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen es tatsächlich schafft, die Stellung der Regional- und Minderheitensprachen in Europa zu verbessern und die Sprachen zu schützen. Um dies zu erarbeiten, soll die Bedeutung der katalanischen Sprache im Bildungswesen Kataloniens als Beispiel in der Betrachtung herangezogen werden.
Im Hauptteil wird zunächst die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen näher vorgestellt werden. Zudem werden die Ziele und Grundsätze der Charta erläutert werden. Darauffolgend werden die Maßnahmen aufgezeigt werden, die die Charta im Bereich der Bildung in den Vertragsstaaten vorsieht, um die Regional- und Minderheitensprachen zu schützen. Daraufhin wird die Umsetzung der Maßnahmen im Bildungswesen, die in der Charta vorgeschrieben sind, am Beispiel der katalanischen Sprache beschrieben werden. In diese Betrachtung wird auch die Umsetzung der Ziele und Grundsätze der Charta einfließen. Zuletzt wird dargestellt werden, inwiefern die ECRM und die Umsetzung der in ihr enthaltenen Ziele, Grundsätze und Maßnahmen kritisiert werden und welche Verbesserungsvorschläge gegeben werden.
Dass in dieser Arbeit ausschließlich der Bildungsbereich beleuchtet wird, kann leicht erklärt werden: Er wurde gewählt, da die „Bildung eine[] der grundlegenden zu schützenden Bereiche ist“, wie Lebsanft und Wingender (2012: 3) beschreiben. Zudem werden auch in der Charta selbst die Bildung und das Erlernen von Sprachen besonders hervorgehoben. Katalanisch wird laut Berkenbusch (2000: 269) nicht nur in der autonomen Region Katalonien, sondern auch in der französischen Region Roussillon, in Andorra, in Aragonien, auf den Balearen sowie in Valencia und auf Sardinien gesprochen. Dennoch wird in dieser Seminararbeit nur die Umsetzung der Charta in Katalonien aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
- Ziele und Grundsätze
- Maßnahmen zur Förderung von Regional- oder Minderheitensprachen im Bildungswesen
- Umsetzung der Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen im Bildungswesen Kataloniens
- Kritik und Verbesserungsvorschläge zur Umsetzung der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen im Bildungswesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob die Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen dazu beiträgt, die Stellung von Regional- und Minderheitensprachen in Europa zu verbessern und zu schützen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Umsetzung der Charta im Bildungswesen, wobei die katalanische Sprache in Katalonien als Beispiel dient.
- Analyse der Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen
- Bewertung der Umsetzung dieser Maßnahmen im Bildungswesen Kataloniens anhand der katalanischen Sprache
- Identifizierung von Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen zur Umsetzung der Charta im Bildungsbereich
- Bedeutung der katalanischen Sprache als Beispiel für die Situation von Regional- und Minderheitensprachen in Europa
- Hervorhebung der Rolle des Bildungswesens als Schlüsselbereich für den Schutz und die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Regional- und Minderheitensprachen in der Europäischen Union dar und führt in die Thematik der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen (ECRM) ein. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus Sprachkonflikten zwischen Mehrheits- und Minderheitensprachen ergeben und verdeutlicht die Rolle der ECRM bei der Bewältigung dieser Konflikte.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich zunächst einer detaillierten Analyse der ECRM. Die Ziele und Grundsätze der Charta werden erläutert, sowie die spezifischen Maßnahmen zur Förderung von Regional- und Minderheitensprachen im Bildungsbereich. Anschließend wird die Umsetzung der ECRM im Bildungswesen Kataloniens anhand der katalanischen Sprache untersucht, wobei die Umsetzung der Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der Charta in den Blick genommen wird.
Das Kapitel "Kritik und Verbesserungsvorschläge" beleuchtet kritische Aspekte der Umsetzung der ECRM und zeigt auf, welche Verbesserungsvorschläge zur Stärkung des Schutzes und der Förderung von Regional- und Minderheitensprachen im Bildungswesen gemacht werden können.
Schlüsselwörter
Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen, Regionalsprachen, Minderheitensprachen, Sprachkonflikte, Bildungswesen, Katalanisch, Katalonien, Sprachenpolitik, Mehrsprachigkeit, Schutz und Förderung von Sprachen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen?
Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz und zur Förderung von Sprachen, die traditionell von Minderheiten in Europa gesprochen werden.
Wie wird die Charta im Bildungswesen Kataloniens umgesetzt?
In Katalonien dient Katalanisch als Hauptunterrichtssprache, was den Zielen der Charta zur Förderung der Minderheitensprache entspricht.
Warum ist Bildung für den Sprachenschutz so wichtig?
Bildung ist der Schlüsselbereich, um Sprachen an nächste Generationen weiterzugeben und ihre Verwendung im öffentlichen Raum zu sichern.
Welche Kritik gibt es an der Umsetzung der Charta?
Kritisiert wird oft eine mangelnde Kontrolle der Vertragsstaaten sowie die Tatsache, dass wirtschaftliche Interessen oft über den Sprachenschutz gestellt werden.
Wo wird Katalanisch überall gesprochen?
Neben Katalonien wird es in der Region Roussillon (Frankreich), Andorra, auf den Balearen, in Valencia, Aragonien und auf Sardinien gesprochen.
- Arbeit zitieren
- Eva-Marie Kolasch (Autor:in), 2015, Werden die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen in der EU umgesetzt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468254