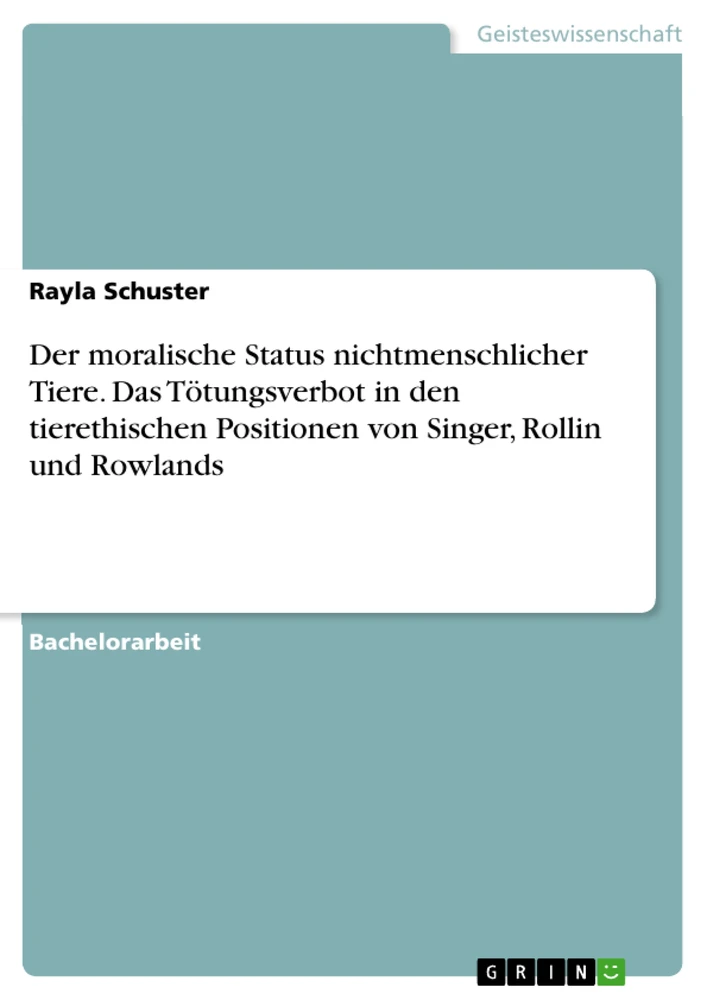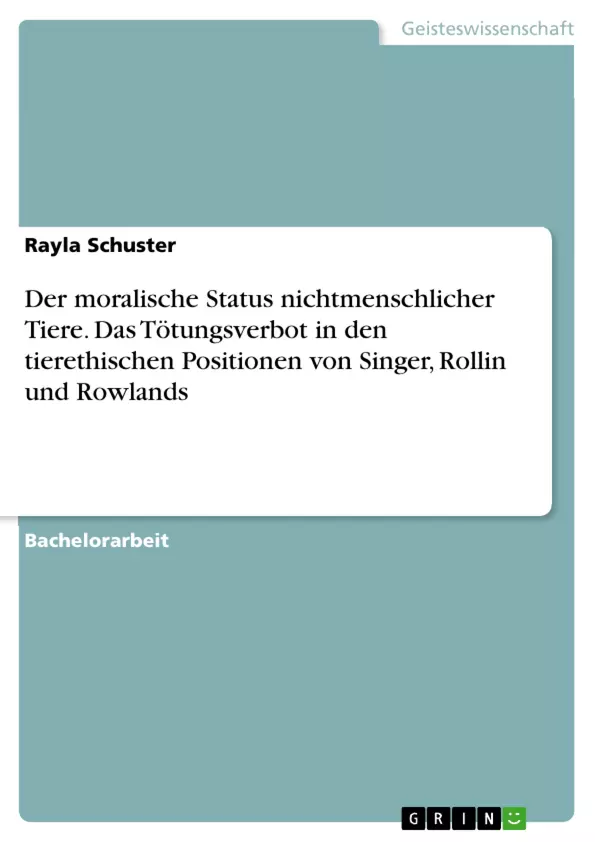Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem moralischen Status nichtmenschlicher Tiere in pathozentrischen Ansätzen der Tierethik, wobei sie nur die Subkategorie egalitaristischer Ansätze betrachtet. Während hierarchische Ansätze behaupten, es gebe zwischen den Mitgliedern der moralischen Gemeinschaft Statusunterschiede, lehnen egalitaristische Ansätze diese Abstufungen ab. Untersucht werden drei Ansätze, die auf unterschiedlichen Moraltheorien basieren, um zu prüfen, inwiefern sie dennoch zu vergleichbaren Schlüssen im Hinblick auf die Behandlung nichtmenschlicher Tiere führen.
Als Vertreter des Präferenzutilitarismus wird Peter Singer präsentiert, der mit seinem 1975 erschienenen Werk "Animal Liberation" die moderne Tierethik begründete. Als Vertreter des Rechte-Ansatzes wurde Bernard Rollin ausgewählt. Als Vertreter des Kontraktualismus wird Mark Rowlands, dessen Theorie Tierrechte und Kontraktualismus erstmals versöhnt, vorgestellt. Diese Arbeit wirft dabei zwei Fragen auf: "Welche moralphilosophischen Argumente sprechen nichtmenschlichen Tieren moralischen Status, das heißt Zugehörigkeit zur moralischen Gemeinschaft, zu?" Und: "Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Zugehörigkeit im Hinblick auf die Tötung nichtmenschlicher Tiere?" Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Konsequenzen sich für die industrielle Tierhaltung und für Tierversuche ergeben.
Antworten auf diese Fragen zu finden ist von erheblicher Bedeutung, da die Verpflichtung, Tiere moralisch zu berücksichtigen, Interessenkonflikte zwischen ihnen und Menschen offenbart. Diese zu lösen erfordert herauszufinden, ob und unter welchen Bedingungen Tiere für menschliche Zwecke genutzt werden dürfen. Die Auswirkungen der industriellen Tierhaltung erfordern zudem, diese nicht nur im Hinblick auf die moralisch legitime Behandlung der Tiere, sondern auch die der Menschen, in Frage zu stellen.
In drei Kapiteln widmet sich die Arbeit den Ansätzen Singers, Rollins und Rowlands. Anhand der Hauptwerke des Vertreters werden zunächst die theoretischen Grundlagen dargestellt und auf nichtmenschliche Tiere angewendet. Anschließend folgt die Darlegung der Konsequenzen für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere und die wichtigsten Kritikpunkte werden umrissen. Vor der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse im Fazit erfolgt im fünften Kapitel ein Vergleich der drei Ansätze.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Singers präferenzutilitaristischer Ansatz
- Theoretische Grundlagen des Ansatzes
- Die Tötung menschlicher und nichtmenschlicher Tiere
- Konsequenzen für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere
- Kritik
- Zusammenfassung
- Rollins rechte-theoretischer Ansatz
- Theoretische Grundlagen des Ansatzes
- Moralische und gesetzliche Rechte nichtmenschlicher Tiere
- Konsequenzen für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere
- Kritik
- Zusammenfassung
- Rowlands' kontraktualistischer Ansatz
- Theoretische Grundlagen des Ansatzes
- Rowlands' Interpretation des Rawlsschen Kontraktualismus
- Konsequenzen für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere
- Kritik
- Zusammenfassung
- Vergleich der Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem moralischen Status nichtmenschlicher Tiere in pathozentrischen Ansätzen der Tierethik, wobei sie nur die Subkategorie egalitaristischer Ansätze betrachtet. Sie untersucht drei Ansätze, die auf unterschiedlichen Moraltheorien basieren, um zu prüfen, inwiefern sie dennoch zu vergleichbaren Schlüssen im Hinblick auf die Behandlung nichtmenschlicher Tiere führen. Die Arbeit wirft dabei zwei Fragen auf: Welche moralphilosophischen Argumente sprechen nichtmenschlichen Tieren moralischen Status, das heißt Zugehörigkeit zur moralischen Gemeinschaft, zu? Und: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Zugehörigkeit im Hinblick auf die Tötung nichtmenschlicher Tiere? Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Konsequenzen sich für die industrielle Tierhaltung und für Tierversuche ergeben.
- Der moralische Status nichtmenschlicher Tiere in egalitaristischen Ansätzen der Tierethik
- Die Relevanz des Gleichheitsprinzips für die moralische Berücksichtigung von Tieren
- Die Tötung nichtmenschlicher Tiere in den verschiedenen Ansätzen
- Konsequenzen für die industrielle Tierhaltung
- Konsequenzen für Tierversuche
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel dieser Arbeit widmet sich Singers präferenzutilitaristischem Ansatz, das darauf folgende Kapitel Rollins rechte-theoretischem Ansatz und das vierte Kapitel Rowlands' kontraktualistischem Ansatz. Dabei verfolgt jedes Kapitel den gleichen Aufbau. Anhand der Hauptwerke des Vertreters werden zunächst die theoretischen Grundlagen, welche die Antwort auf die erste Frage dieser Arbeit liefern, dargestellt. Daraufhin wird durch die Anwendung dieser Grundlagen auf nichtmenschliche Tiere die Antwort auf die zweite Frage erarbeitet. Durch die anschließende Darlegung der Konsequenzen für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere wird das Ziel der Arbeit erfüllt. Danach werden anhand der Sekundärliteratur die wichtigsten Kritikpunkte umrissen. Die Diskussion dieser kann die vorliegende Arbeit in Anbetracht ihres Umfangs und ihrer Zielsetzung jedoch nicht leisten. Jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung des präsentierten Ansatzes.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem moralischen Status nichtmenschlicher Tiere, insbesondere mit den ethischen Argumenten, die ihnen moralischen Status, das heißt Zugehörigkeit zur moralischen Gemeinschaft, zusprechen. Die Arbeit untersucht, welche Konsequenzen sich aus dieser Zugehörigkeit im Hinblick auf die Tötung nichtmenschlicher Tiere, insbesondere für die industrielle Tierhaltung und für Tierversuche ergeben. Zentral sind die Konzepte des Speziesismus, des Gleichheitsprinzips, der Empfindungsfähigkeit, des telos, des Kontraktualismus und des Prinzips der Risikoübertragbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Peter Singers Präferenzutilitarismus zur Tierethik?
Singer argumentiert, dass das Interesse an der Vermeidung von Schmerz bei allen leidensfähigen Wesen gleich gewichtet werden muss. Er lehnt Speziesismus (Diskriminierung aufgrund der Spezies) strikt ab.
Welche moralischen Rechte spricht Bernard Rollin Tieren zu?
Rollin betont das „telos“ (das arteigene Wesen) eines Tieres. Er fordert, dass Tiere moralische und gesetzliche Rechte erhalten sollten, die es ihnen ermöglichen, ihr natürliches Leben entsprechend ihrem telos zu führen.
Wie begründet Mark Rowlands Tierrechte im Kontraktualismus?
Rowlands nutzt das Konzept des „Urstands“ von John Rawls. Er argumentiert, dass man hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ (ohne zu wissen, ob man als Mensch oder Tier geboren wird) Regeln wählen würde, die auch Tiere schützen.
Was ist der Unterschied zwischen hierarchischen und egalitaristischen Ansätzen?
Hierarchische Ansätze sehen Statusunterschiede zwischen Mensch und Tier. Egalitaristische Ansätze lehnen diese Abstufungen ab und fordern eine gleiche moralische Berücksichtigung ähnlicher Interessen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die industrielle Tierhaltung?
Alle drei untersuchten Ansätze kommen zu dem Schluss, dass die heutige industrielle Tierhaltung ethisch nicht vertretbar ist, da sie grundlegende Interessen oder Rechte der Tiere massiv verletzt.
- Arbeit zitieren
- Rayla Schuster (Autor:in), 2018, Der moralische Status nichtmenschlicher Tiere. Das Tötungsverbot in den tierethischen Positionen von Singer, Rollin und Rowlands, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468545