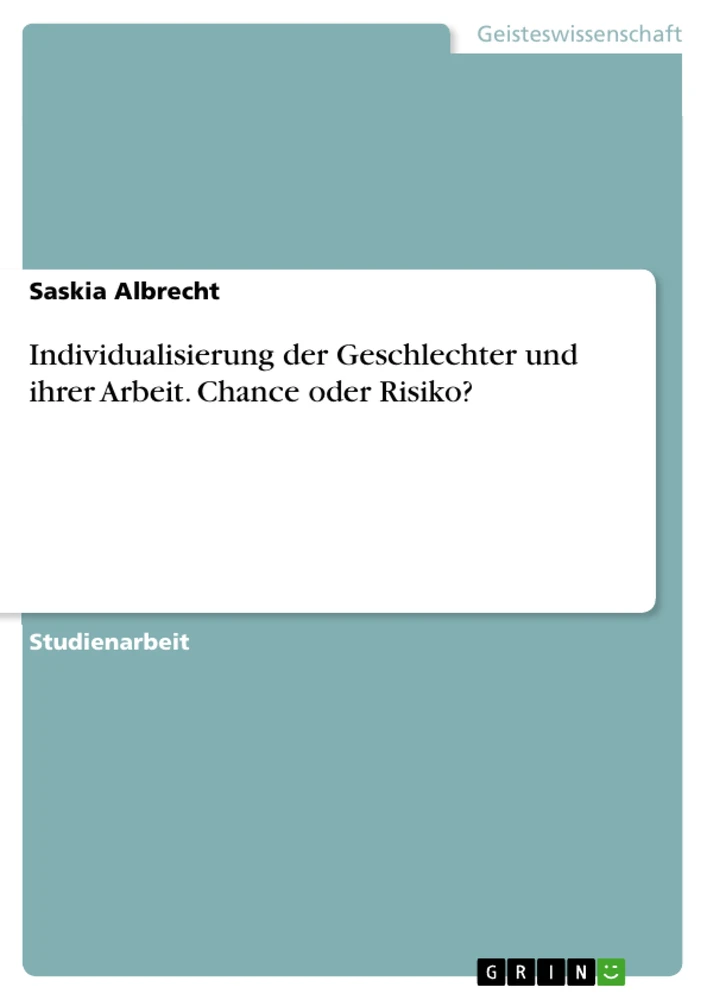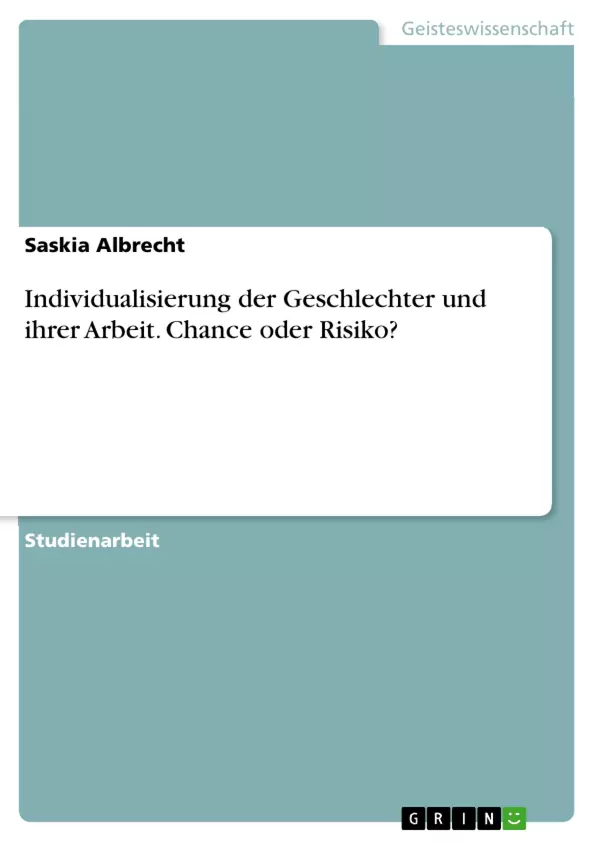In dieser Arbeit soll ein genauerer Blick auf diese These geworfen und geprüft werden, inwiefern sie zutrifft und welche Chancen und Risiken sich tatsächlich aus der Individualisierung ergeben. Dazu soll zunächst ein Überblick über Ulrich Becks Gesellschaftsanalyse zur Risikogesellschaft und sein Verständnis von Risiko gegeben werden, um daraufhin sein Verständnis von Individualisierung einzuordnen und zu erläutern.
Anschließend soll in einer Zusammenfassung der historischen Entwicklung des Feminismus aufgezeigt werden, wie sich die Ungleichheit der Geschlechter seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. Auf das Beispiel von Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird dabei gesondert eingegangen, da nach einer Auswertung der generellen Chancen und Risiken, die sich aus der Individualisierung ergeben, eine Analyse der Auswirkungen von Individualisierung auf die Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt anschließen wird. Ein Blick wird außerdem auf das aktuelle Verhältnis zwischen Männern und Frauen geworfen. Abschließend werden die Ergebnisse in einem Kapitel noch einmal zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ulrich Becks „Risikogesellschaft“
- Der Risikobegriff nach Ulrich Beck
- Becks Individualisierungsthese
- Soziale Ungleichheit der Geschlechter
- Geschichte (sozialer) Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
- Arbeit und Geschlecht
- Individualisierung: Chance oder Risiko für die Geschlechter
- Gleichstellung durch Individualisierung?
- Chancengleichheit der Geschlechter? Das Beispiel Frauen und Arbeit
- Ungleichheit der Geschlechter heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Individualisierungsthese von Ulrich Beck und untersucht, inwiefern diese auf die Geschlechterverhältnisse zutrifft und welche Chancen und Risiken sich aus der Individualisierung für Frauen* ergeben. Dazu wird zunächst Becks Analyse der Risikogesellschaft und sein Verständnis von Risiko erläutert. Anschließend wird ein Überblick über die historische Entwicklung der Ungleichheit der Geschlechter seit dem 19. Jahrhundert gegeben, wobei insbesondere auf die Situation von Frauen* auf dem Arbeitsmarkt eingegangen wird. Die Auswirkungen der Individualisierung auf die Gleichstellung von Frauen* auf dem Arbeitsmarkt werden analysiert, bevor die aktuellen Verhältnisse zwischen Männern* und Frauen* betrachtet werden.
- Ulrich Becks „Risikogesellschaft“ und Individualisierungsthese
- Historische Entwicklung der Ungleichheit der Geschlechter
- Auswirkungen der Individualisierung auf die Gleichstellung von Frauen* auf dem Arbeitsmarkt
- Aktuelle Verhältnisse zwischen Männern* und Frauen*
- Chancen und Risiken der Individualisierung für die Geschlechter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beleuchtet die Individualisierungsthese von Ulrich Beck vor dem Hintergrund des Gender Pay Gaps und der anhaltenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Er stellt die These auf, dass die Individualisierung für Frauen* sowohl Chancen als auch Risiken birgt.
Ulrich Becks „Risikogesellschaft“
In diesem Kapitel wird Becks Analyse der Risikogesellschaft vorgestellt und sein Verständnis von Risiko erläutert. Die Risikogesellschaft zeichnet sich durch neue, durch die Modernisierung selbst verursachte Risiken aus, die nicht mehr schichtabhängig, sondern gesamtgesellschaftlich wirken. Die Individualisierungsthese besagt, dass die Menschen durch die Auflösung traditioneller Sozialformen wie Klasse und Geschlechterrollen zunehmend selbstverantwortlich ihre Biographien gestalten müssen.
Soziale Ungleichheit der Geschlechter
Die historische Entwicklung der Ungleichheit der Geschlechter wird beleuchtet, wobei insbesondere die Benachteiligung von Frauen* in Bildung, Erwerbsarbeit und politischer Teilhabe im Fokus steht. Es wird deutlich, dass die traditionellen Rollenzuschreibungen an Frauen* und Männer* bis heute nachwirken.
Individualisierung: Chance oder Risiko für die Geschlechter
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Individualisierung auf die Geschlechterverhältnisse. Es wird argumentiert, dass Frauen* zwar von der Auflösung traditioneller Rollen und der Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten profitieren, aber auch neuen Risiken ausgesetzt sind, wie z.B. finanzieller Abhängigkeit und der Doppelbelastung durch Beruf und Familie.
Frauen und Arbeit
Das Beispiel Frauen* und Arbeit verdeutlicht die paradoxen Auswirkungen der Individualisierung. Zwar haben Frauen* im Zuge der Bildungsexpansion und der veränderten Rechtslage mehr Zugang zum Arbeitsmarkt erlangt, gleichzeitig sind sie häufig in unsicheren und schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen gefangen. Dies liegt zum Teil an den bestehenden Geschlechterrollen und den anhaltenden Erwartungen, die Frauen* die Verantwortung für Reproduktionsarbeit übertragen.
Schlüsselwörter
Individualisierung, Risikogesellschaft, Geschlechterungleichheit, Frauen*, Arbeit, Reproduktionsarbeit, Gleichstellung, Chancengleichheit, Prekarisierung, Zweite Moderne, Bildung, Wohlfahrtsstaat.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Ulrich Becks Individualisierungsthese?
Die These besagt, dass traditionelle Sozialformen wie Klasse oder feste Geschlechterrollen an Bedeutung verlieren und Menschen zunehmend gezwungen sind, ihre Biographien selbstverantwortlich zu gestalten.
Welche Chancen bietet die Individualisierung für Frauen?
Frauen profitieren von der Auflösung traditioneller Rollenbilder, einer besseren Bildungsexpansion und erweiterten Handlungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.
Welche Risiken entstehen durch die Individualisierung der Geschlechter?
Zu den Risiken zählen finanzielle Abhängigkeit, Prekarisierung der Arbeit und die Doppelbelastung durch Beruf und die weiterhin oft bei Frauen liegende Reproduktionsarbeit.
Wie beeinflusst die „Risikogesellschaft“ das Leben heute?
In der Risikogesellschaft wirken Gefahren (wie Umweltkrisen oder wirtschaftliche Instabilität) global und schichtübergreifend, was den Einzelnen vor neue Herausforderungen stellt.
Besteht heute noch eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern?
Ja, trotz formaler Gleichstellung zeigen Phänomene wie der Gender Pay Gap und die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, dass traditionelle Strukturen weiterhin nachwirken.
- Quote paper
- Saskia Albrecht (Author), 2019, Individualisierung der Geschlechter und ihrer Arbeit. Chance oder Risiko?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468589