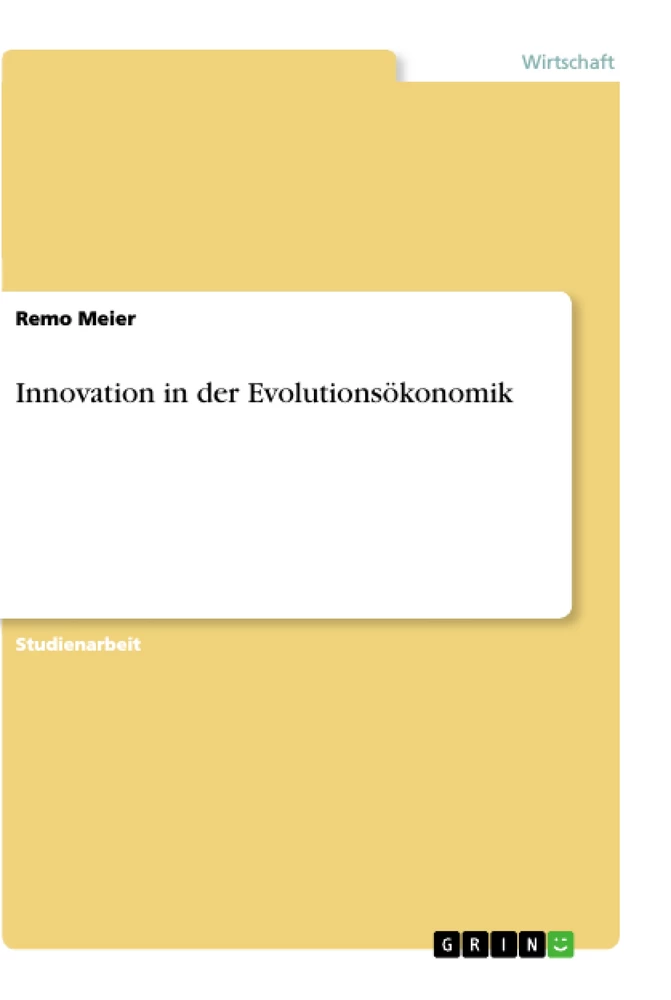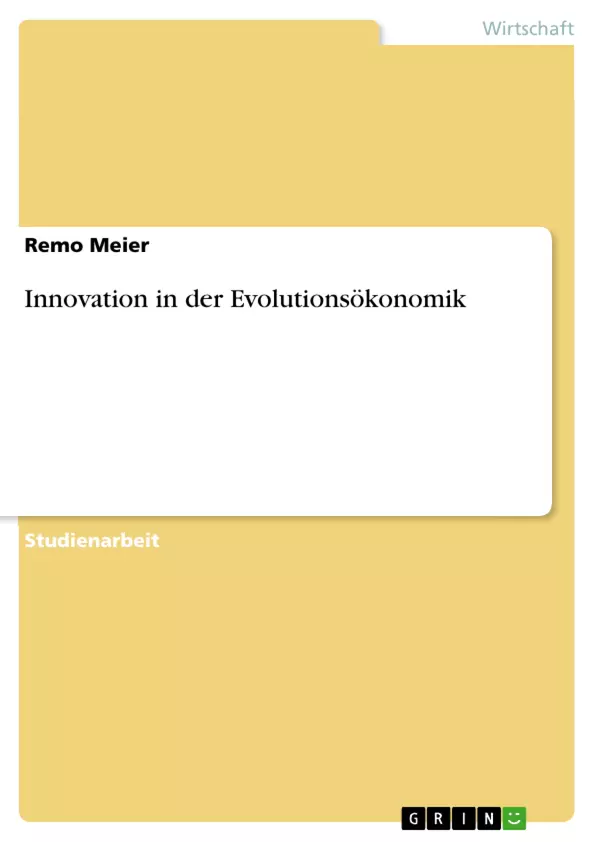Die Neoklassik und andere orthodoxe Schulen haben die wirtschaftliche Bedeutung von technologischem Fortschritt erkannt. Der Nobelpreisträgers Robert M. Solow lieferte hierzu eines der bekanntesten Modelle. Er fand heraus, dass die Zunahme des Produktivitätswachstums in den USA zwischen 1909-1949 nur zu 12,5 % auf der Zunahme der Kapitalproduktivität beruht, aber zu 87,5 % auf technischem Fortschritt und bessere Ausbildung der Arbeitskräfte. Das Problem der Neoklassik und anderen stationären Wirtschaftstheorien ist allerdings, dass sie den technischen Fortschritt nicht erklären können, denn die Annahmen von vollkommener Markttransparenz in der alle Akteure zu jedem Zeitpunkt denselben Informationsstand besitzen und die Annahme der Existenz von ausschließlich homogenen Gütern, führt dazu, dass die Akteure keine Möglichkeit besitzen Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Hierdurch können durch Innovationen verursachte Gleichgewichtsänderungen, nicht erklärt werden. Trotz ihrer wirtschaftlichen Relevanz werden Innovationen in stationären Modellen als exogene Größen angenommen. Aufgrund dessen, versuchte die österreichische Schule, welche maßgeblich durch Joseph A. Schumpeter geprägt wurde, einen evolutorischen Ansatz zur Erklärung von technologischen Fortschritten zu finden. Die Grundannahmen dieser Innovationstheorien unterscheiden sich von klassischen Modellen in ihren Annahmen des exogenen Wandels, der sich entwickelnden Prozesse, der heterogenen Akteure und deren beschränkte Rationalität. Die Neoklassik beschreibt den Gleichgewichtszustand genau, aber weniger wie es zu diesem kommt. Umgekehrt beschreiben die evolutorischen Ansätze wie diese Zustände entstehen und weniger wodurch sich diese auszeichnen. Hierdurch entsteht ein dynamischer Ansatz welcher durch das Adjektiv “evolutorisch” betont wird und die Abgrenzung zu rein statischen Gleichgewichtsmodellen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schumpeter und seine Theorien im Kontext auf die Innovation der Evolutionsökonomik
- 3. Bedeutende Innovationskonzepte des Neo-Schumpeterianismus
- 3.1 Die institutionenökonomische Innovationstheorie
- 3.2 Die evolutorische Innovationstheorie
- 3.3. Wettbewerbstheorie nach Hayek und Kantzenbach:
- 3.4 Das normative Prinzip des Neo-Schumpeterianismus
- 4. Innovatiosdynamische Ansätze in einer Volkswirtschaft: Das Drei-Säulen Modell der neo-schumpeterianischen Innovationstheorie
- 5. Die Entstehung von Neuerungen in Bezug auf naturalistische Ansätze
- 6. Naturalistische Ansätze in der evolutorischen Innovationstheorie von Nelson und Winter
- 7. Kritik an dem Modell von Nelson und Winter:
- 8. Open-Innovation-Konzept. Öffnung des Innovationsprozesses.
- 9. Management von Innovationsprozessen im 21. Jahrhundert…….....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar "Wissenschaftliches Arbeiten" befasst sich mit dem Thema "Innovationen in der Evolutionsökonomik" und analysiert, wie technologischer Fortschritt in der Wirtschaft durch einen evolutorischen Ansatz erklärt werden kann.
- Die Bedeutung der Innovationstheorie von Schumpeter und ihre Weiterentwicklung im Neo-Schumpeterianismus
- Die Rolle von Institutionen und Verhalten in der Innovationstheorie
- Naturalistische Ansätze in der Evolutionsökonomik und das Modell von Nelson und Winter
- Das Open-Innovation-Konzept und seine Relevanz im digitalen Zeitalter
- Das Management von Innovationsprozessen im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problematik der neoklassischen und stationären Wirtschaftstheorien in Bezug auf den technischen Fortschritt dar. Sie führt den Leser in die evolutorischen Ansätze ein, die sich von diesen Modellen durch ihre dynamische Betrachtungsweise abheben.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit Schumpeters Innovationstheorie und deren Einfluss auf die ökonomische Lehrmeinung. Es beleuchtet die Kernpunkte seiner Theorie und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Neo-Schumpeterianismus.
- Kapitel 3: Hier werden die beiden Schulen des Neo-Schumpeterianismus, die institutionell-historische und die verhaltensorientierte Schule, vorgestellt und anhand repräsentativer Modelle näher erläutert.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel behandelt naturalistische Ansätze der Evolutionstheorie und stellt das Modell von Nelson und Winter vor.
- Kapitel 5: Das Open-Innovation-Konzept wird im fünften Kapitel behandelt, wobei der Fokus auf dessen wachsende Bedeutung im digitalen Zeitalter liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen und Konzepte der Evolutionsökonomik, insbesondere auf Innovationen und deren Entstehung. Schlüsselbegriffe sind Schumpeter, Neo-Schumpeterianismus, Institutionen, Verhalten, natürliche Selektion, Open Innovation, Management von Innovationsprozessen, und technologischer Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die Evolutionsökonomik von der Neoklassik?
Während die Neoklassik von statischen Gleichgewichten ausgeht, betrachtet die Evolutionsökonomik Wirtschaft als dynamischen Prozess mit heterogenen Akteuren und endogenem technologischem Fortschritt.
Welche Rolle spielt Joseph A. Schumpeter in der Innovationstheorie?
Schumpeter gilt als Wegbereiter; er definierte Innovation als "schöpferische Zerstörung" und betonte die Rolle des Unternehmers bei der Durchsetzung neuer Kombinationen.
Was ist das "Open-Innovation-Konzept"?
Open Innovation beschreibt die Öffnung des Innovationsprozesses von Unternehmen nach außen, um externes Wissen zu integrieren und interne Innovationen breiter zu vermarkten.
Was besagt das Modell von Nelson und Winter?
Es ist ein naturalistischer Ansatz, der die Entwicklung von Unternehmen durch Routinen, Selektion und Variation analog zur biologischen Evolution erklärt.
Warum können stationäre Modelle technischen Fortschritt oft nicht erklären?
Da sie oft von vollkommener Markttransparenz und homogenen Gütern ausgehen, bieten sie keinen Raum für Wettbewerbsvorteile durch Neuerungen, weshalb technischer Fortschritt dort meist als exogene Größe behandelt wird.
- Arbeit zitieren
- Remo Meier (Autor:in), 2017, Innovation in der Evolutionsökonomik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468704