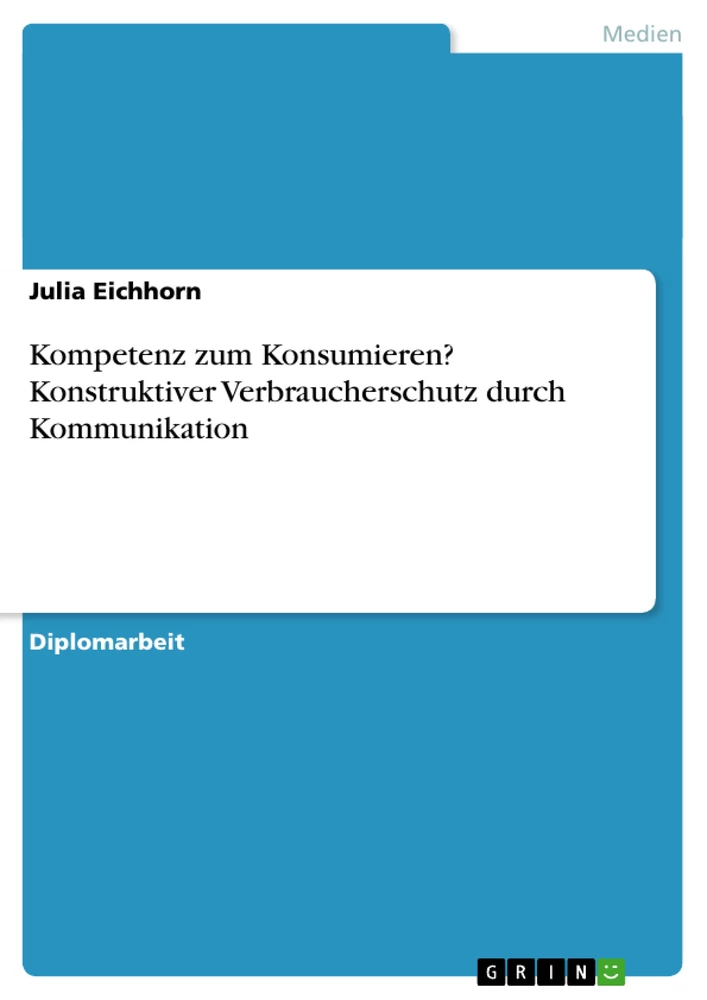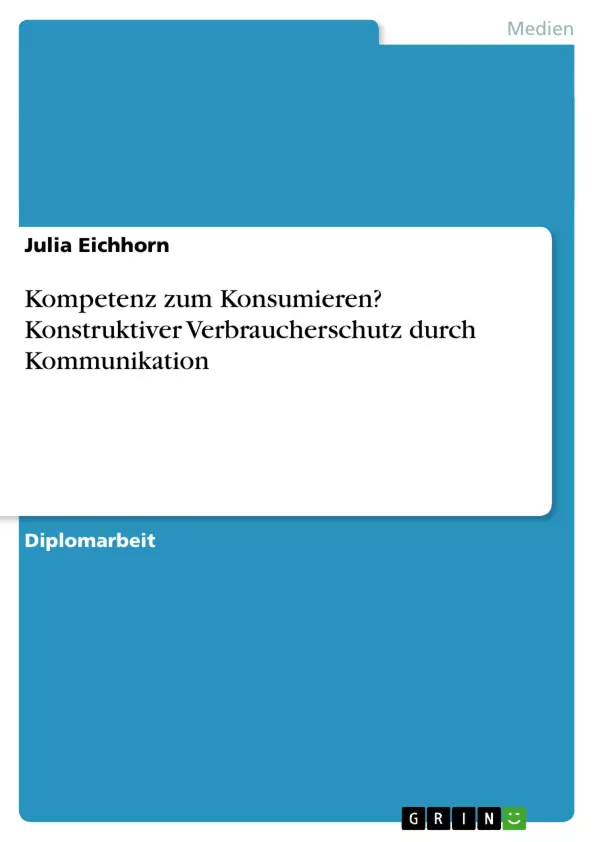Auch wenn mit der Umstrukturierung der deutschen Verbraucherpolitik anlässlich der BSE-Krise, die zum Jahreswechsel 2000/ 2001 zur Neugründung des Ministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) führte, große
Versprechungen hinsichtlich einer kompletten Neu-Orientierung des deutschen Verbraucherschutzes gemacht wurden, hat sich auf diesem Gebiet bislang wenig bewegt. Bei der Umsetzung der „neuen Verbraucherpolitik“ orientiert man sich vor allem an zwei grundlegenden Verbraucherrechten [vgl. Reisch 2003, 11]:
-Recht auf Sicherheit von Leben und Gesundheit und
-Recht auf Information.
Die moderne Verbraucherpolitik basiert damit auf den Prinzipien „Vorsorge“ und „Chancen- und Waffengleichheit“ [vgl. Müller 2001, 11]. Unter dem Leitbild des „Nachhaltigen Konsums“, das auch in die Verbraucherpolitik Eingang gefunden hat, stehen diesen Rechten aber auch Pflichten der Konsumenten gegenüber, da vor allem sie durch ihr Verhalten für die Umsetzung dieses Konzeptes in der Verantwortung stehen. Man macht sich das Prinzip der „Mitweltverantwortung durch erfahrenen Schutz“ zu Eigen, bei dem die Gewährleistung von Schutz als Grunderfahrung angesehen wird, aus der heraus Verantwortung übernommen werden kann [vgl. BMVEL 2003, 24]. Indem der Konsument also vor Sicherheits- und Gesundheitsrisiken staatlich geschützt wird, kann er in anderen Bereichen verantwortlich und eigenständig handeln. Das neue Leitbild zeichnet Verbraucher, die als aktive Partner im Marktgeschehen sowohl ein Recht auf Schutz haben und die Möglichkeit zur Gegenwehr brauchen, sich aber zugleich den Auswirkungen ihrer Konsumhandlungen bewusst sind und Mitverantwortung für künftige ökologische und soziale Entwicklungen übernehmen [vgl. Müller 2001, 11]. Obwohl der „Aktionsplan Verbraucherschutz“ des BMVEL ankündigt, sich zur Realisation dieses Leitbildes neben gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen um die Stärkung der Position des Einzelnen zu bemühen [vgl. BMVEL 2003, 4] und auch die Selbstdarstellung im Internet die „Förderung der Selbstbestimmung der Verbraucher“ als Grundsatz propagiert [vgl. BMVEL], ist von diesem Vorsatz bisher wenig zu merken. Vorherrschend kommen restriktive „Behütungsmaßnahmen“ zum Einsatz, die Schäden von den Konsumenten abhalten wollen, anstatt sie zu eigenverantwortlich handelnden Verbrauchern auszubilden.
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- 1.1 Aktuelle Situation im deutschen Verbraucherschutz.
- 1.2 Begriffsbestimmung/ Abgrenzung des Forschungsraumes..
- DETERMINANTEN DES KONSUMVERHALTENS.
- 2.1 Forschungsgegenstand der Konsumentenforschung.
- 2.2 Psychische intrapersonale Faktoren.
- 2.2.1 aktivierende Prozesse..
- 2.2.2 kognitive Prozesse
- 2.2.3 individuelle Determinanten
- 2.3 Umweltfaktoren
- 2.3.1 soziale Umwelt
- 2.3.2 Medienumwelt.
- 2.4 Fazit: Abschied vom „,homo oeconomicus”
- KONSUMRISIKEN..
- 3.1 Konsumschäden für den Konsumenten.
- 3.2 Konsumschäden für Umwelt und Geselllschaft
- 3.3 Der ausgelieferte Verbraucher: Manipulation des Konsumentenverhaltens durch die Anbieter?.
- 3.4 Fazit: Konsumkompetenz als konstruktiver Ausweg.
- DEFINITION VON KONSUMKOMPETENZ..
- 4.1 Kompetentes Informationsverhalten
- 4.2 Fähigkeit zur kritischen Bedarfsreflexion.
- 4.3 Einstellungen in Verhalten umsetzen.
- 4.4 Mitgestaltung der sozialen Umwelt durch Partizipation…........
- 4.5 Fazit: Konsumkompetenz kann kommunikativ gefördert werden - nur wie?
- HERAUSFORDERUNG EINER GEMEINSCHAFTSAUFGABE: DIE
VERMITTLUNG VON KONSUMKOMPETENZ.
- 5.1 Klassische Maßnahmen des institutionellen Verbraucherschutzes
- 5.2 Aktiver Verbraucherschutz durch innovative Kommunikationsmaßnahmen
- 5.2.1 Sensibilisierung und Schaffung von Problembewusstsein.
- 5.2.2 Wissensvermittlung durch Risikokommunikation.......
- 5.2.3 Einstellungsbildung
- 5.2.4 Mobilisierung zum Verhalten.....
- 5.2.4.1 Empowerment - Stärkung des Machtgefühls der Verbraucher.
- 5.2.4.2 Mobilisierung mittels der Massenmedien..........\n
- 5.2.4.3 Motivation durch Rahmenbedingungen
- 5.3 Konsumkompetenz als Unternehmensziel
- 5.4 Anforderungen an Kommunikation im Verbraucherschutz.
- 5.4.1 realistisches Verbraucherleitbild.
- 5.4.2 zielgruppenspezifische Ansprache .....
- 5.4.3 Orientierung an sozialtechnischen Regeln............
- 5.4.4 mediengerechte Informationsvermittlung.
- 5.4.5 Internetkommunikation.
- FAZIT.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern selbstverantwortliches Verbraucherverhalten im Kontext des realen Konsumverhaltens möglich ist und wie umwelt- und selbstverträgliches Verhalten durch Kommunikation gefördert werden kann, ohne auf restriktive Maßnahmen zurückzugreifen. Die Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten der Verbraucherpolitik, die Potentiale von nicht-institutionellen Verbraucherschutzbewegungen und die Rolle von Unternehmen in diesem Zusammenhang.
- Determinanten des Konsumverhaltens
- Konsumrisiken und ihre Auswirkungen auf den Konsumenten, die Umwelt und die Gesellschaft
- Definition und Förderung von Konsumkompetenz
- Kommunikationsstrategien im Verbraucherschutz
- Die Rolle von Unternehmen bei der Förderung von Konsumkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel skizziert die aktuelle Situation im deutschen Verbraucherschutz und definiert den Forschungsraum der Arbeit. Es erklärt, warum die Frage nach der Möglichkeit eines selbstverantwortlichen Konsumverhaltens in der heutigen Zeit so relevant ist.
- Determinanten des Konsumverhaltens: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Einflussfaktoren auf das Konsumverhalten, sowohl aus psychologischer Sicht (z.B. aktivierende und kognitive Prozesse) als auch aus der Perspektive der Umweltfaktoren (z.B. soziale und mediale Einflüsse). Es wird deutlich, dass das Konsumverhalten von einer Vielzahl von komplexen Faktoren beeinflusst wird, die über die reinen ökonomischen Annahmen hinausgehen.
- Konsumrisiken: Dieses Kapitel befasst sich mit den negativen Auswirkungen des Konsums auf den Konsumenten, die Umwelt und die Gesellschaft. Es werden verschiedene Formen von Konsumschäden und deren Ursachen beleuchtet. Dabei wird auch die Frage gestellt, inwiefern Konsumenten durch Unternehmen manipuliert werden.
- Definition von Konsumkompetenz: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Definition von Konsumkompetenz als ein wichtiges Werkzeug zur Bewältigung von Konsumrisiken. Es werden verschiedene Facetten von Konsumkompetenz, wie beispielsweise die Fähigkeit zur kritischen Bedarfsreflexion und das Umsetzen von Einstellungen in Verhalten, erläutert.
- Herausforderung einer Gemeinschaftsaufgabe: Die Vermittlung von Konsumkompetenz: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze und Strategien zur Förderung von Konsumkompetenz. Es werden sowohl klassische Maßnahmen des institutionellen Verbraucherschutzes als auch innovative Kommunikationsmaßnahmen vorgestellt, die auf Sensibilisierung, Wissensvermittlung und Mobilisierung abzielen. Darüber hinaus werden die Rolle von Unternehmen in diesem Zusammenhang und die spezifischen Anforderungen an Kommunikation im Verbraucherschutz diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Verbraucherschutz, Konsumentenverhalten, Konsumkompetenz, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Marketing, Verbraucherpolitik, Umwelt, Gesellschaft, Risikokommunikation, Medien, Empowerment und Partizipation. Im Zentrum steht die Frage, wie durch kommunikative Maßnahmen ein verantwortungsbewusster Konsum gefördert werden kann.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konsumkompetenz?
Konsumkompetenz umfasst die Fähigkeit zur kritischen Bedarfsreflexion, kompetentes Informationsverhalten und die Umsetzung von nachhaltigen Einstellungen in tatsächliches Handeln.
Was sind die zentralen Verbraucherrechte?
Dazu gehören vor allem das Recht auf Sicherheit von Leben und Gesundheit sowie das Recht auf umfassende Information.
Was ist der Unterschied zwischen Behütung und Empowerment?
Behütung setzt auf restriktive Schutzmaßnahmen des Staates, während Empowerment darauf abzielt, das Machtgefühl und die Eigenverantwortung der Verbraucher zu stärken.
Welche Rolle spielen Unternehmen bei der Konsumkompetenz?
Unternehmen können Konsumkompetenz als Ziel fördern, indem sie transparent kommunizieren und nachhaltiges Verhalten durch ihre Rahmenbedingungen erleichtern.
Wie beeinflussen Medien das Konsumverhalten?
Medien wirken als Umweltfaktoren, die durch Werbung und Informationsvermittlung psychische Prozesse aktivieren und kognitive Entscheidungen der Konsumenten prägen.
- Quote paper
- Julia Eichhorn (Author), 2005, Kompetenz zum Konsumieren? Konstruktiver Verbraucherschutz durch Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46876