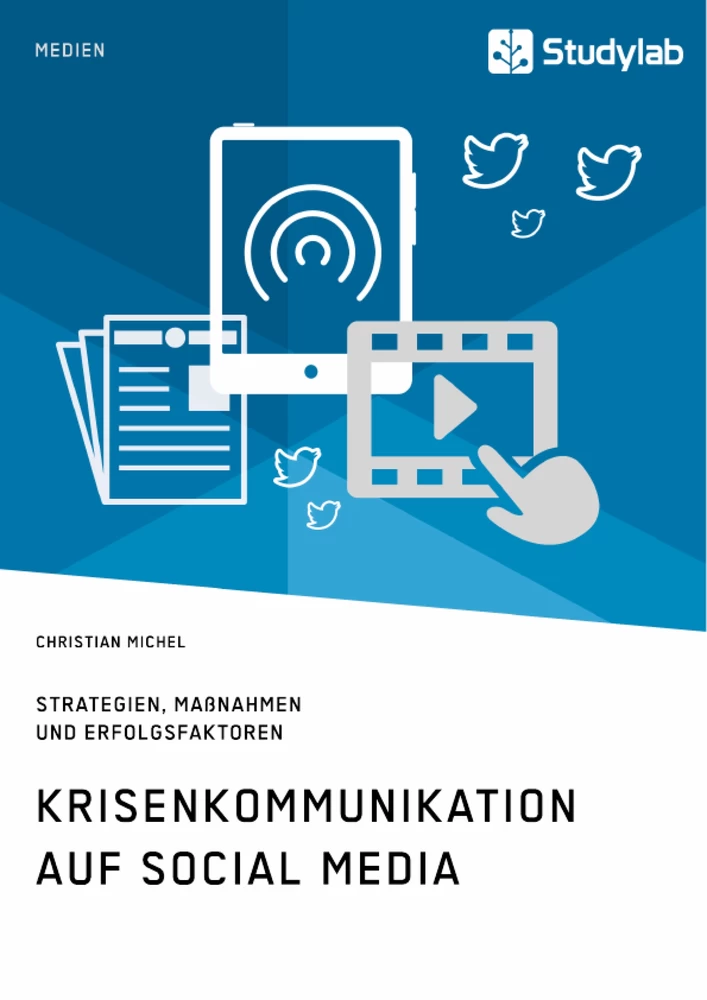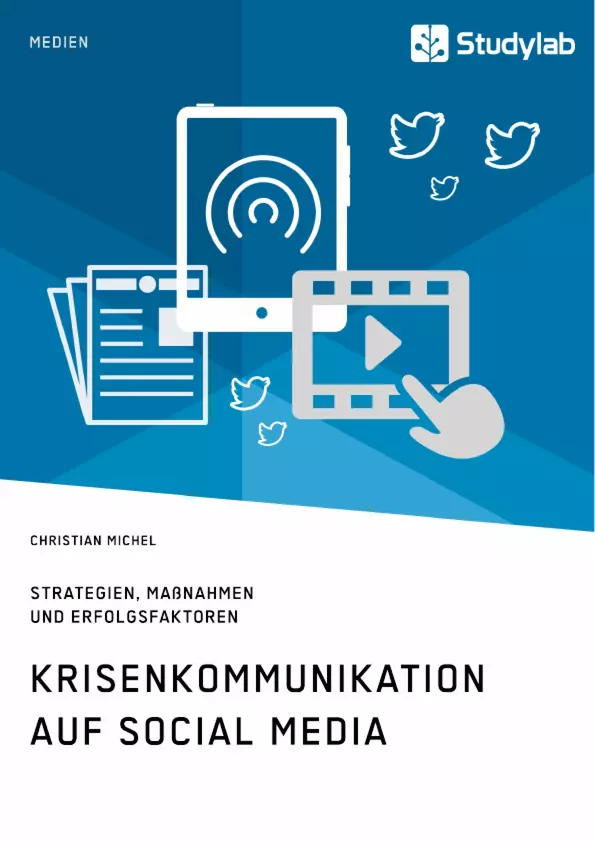Kunden treten heutzutage verstärkt in den Dialog mit Unternehmen. Das liegt vor allem daran, dass das Internet und die sozialen Medien neue Möglichkeiten des Austauschs bieten. Informationen sind außerdem immer und überall verfügbar. Die Aktivitäten von Unternehmen sind so transparenter geworden.
Wie Christian Michel in seiner Publikation zeigt, hat das erhebliche Auswirkungen auf die externe Unternehmenskommunikation. Gerade im Falle einer Krisen müssen Unternehmen schnell und richtig kommunizieren. Soziale Medien verschärfen die Situation sonst oft. Doch wie sieht eine erfolgreiche Krisenkommunikation auf Social Media konkret aus?
Michel stellt geeignete Strategien und Maßnahmen vor. Anschließend betrachtet er Fallbeispiele zum Diesel-Skandal sowie zur Abgasaffäre. Beide Fälle waren für die Unternehmen mit immensen Kosten verbunden. Wie sind sie bei der Krisenkommunikation vorgegangen? Christian Michel leitet aus den Beispielen Handlungsempfehlungen ab.
Aus dem Inhalt:
- Krisenmanagement;
- Public Relations;
- PR;
- Facebook;
- Community
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Rahmen
- 2.1 Social Media
- 2.2 Unternehmenskrise
- 2.3 Krisenkommunikation
- 3 Strategien der Krisenkommunikation
- 3.1 „Mea Culpa\"? Die Schuld eingestehen, von sich weisen oder sich gar nicht äußern?
- 3.2 Die Spielregeln von Facebook, Twitter und Co.
- 4 Fallbeispiele
- 4.1 Fallbeispiel: Der Abgasskandal
- 4.2 Fallbeispiel: Defekte Airbags bei BMW
- 5 Synthese: Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen Theorie und Praxis und ihre Implikationen
- 6 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Erfolgsfaktoren der Krisenkommunikation in sozialen Medien. Sie gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil definiert die Begriffe Social Media, Krise und Krisenkommunikation. Der zweite Teil bietet eine gründliche Untersuchung der wissenschaftlichen Literatur zu Strategien der Krisenkommunikation. Der letzte Teil analysiert zwei Fallbeispiele aus der Automobilindustrie, um die Strategien der Literatur mit den Strategien realer Unternehmen zu vergleichen. Eine Schlussfolgerung bietet einen Überblick über die Ergebnisse der Studie.
- Definition von Social Media, Krise und Krisenkommunikation
- Analyse wissenschaftlicher Literatur zu Strategien der Krisenkommunikation
- Fallbeispiele aus der Automobilindustrie
- Vergleich von Theorie und Praxis in der Krisenkommunikation
- Bewertung der Erfolgsfaktoren von Krisenkommunikation in sozialen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieser Abschnitt führt in das Thema Krisenkommunikation in sozialen Medien ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der digitalen Kommunikation.
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Definition von zentralen Begriffen wie Social Media, Unternehmenskrise und Krisenkommunikation. Es stellt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung von Krisenkommunikationsstrategien in sozialen Medien dar.
- Kapitel 3: Strategien der Krisenkommunikation: In diesem Kapitel werden verschiedene Strategien der Krisenkommunikation in sozialen Medien analysiert, einschließlich der Frage, wie Unternehmen mit Schuldzuweisungen umgehen und wie die spezifischen Spielregeln der sozialen Medienplattformen beachtet werden sollten.
- Kapitel 4: Fallbeispiele: Zwei Fallbeispiele aus der Automobilindustrie werden vorgestellt und analysiert, um die in Kapitel 3 dargestellten Theorien in der Praxis zu veranschaulichen. Die Fallbeispiele demonstrieren, wie Unternehmen in realen Krisensituationen mit Social Media umgehen.
- Kapitel 5: Synthese: Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen Theorie und Praxis und ihre Implikationen: Dieses Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Fallbeispielen und setzt sie in Bezug zur theoretischen Grundlage des Kapitels 3. Es analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Theorie und Praxis der Krisenkommunikation in sozialen Medien.
Schlüsselwörter
Krisenkommunikation, Social Media, Unternehmenskrise, Fallbeispiele, Automobilindustrie, Erfolgsfaktoren, Strategien, wissenschaftliche Literatur, digitale Kommunikation, Theorie und Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändern soziale Medien die Krisenkommunikation?
Informationen verbreiten sich in Echtzeit. Unternehmen stehen unter erhöhtem Druck, schnell, transparent und interaktiv zu reagieren, da Krisen durch Social Media oft verschärft werden.
Sollte ein Unternehmen in einer Krise die Schuld eingestehen?
Die Strategie „Mea Culpa“ kann Vertrauen zurückgewinnen, birgt aber rechtliche Risiken. Die Arbeit analysiert, wann ein Schuldeingeständnis sinnvoll ist und wann andere Taktiken greifen.
Was war die Besonderheit beim Abgasskandal in der Krisenkommunikation?
Der Fall zeigt, wie immense Kosten und Reputationsverluste entstehen, wenn die Kommunikation nicht den Erwartungen der Öffentlichkeit und der Community entspricht.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren auf Facebook und Co.?
Schnelligkeit, Authentizität, Dialogbereitschaft und das Einhalten der plattformspezifischen „Spielregeln“ sind entscheidend für eine erfolgreiche Krisenbewältigung.
Wie unterscheiden sich Theorie und Praxis der Krisenkommunikation?
Während die Theorie oft klare Strategien vorgibt, müssen Unternehmen in der Praxis unter Zeitdruck und emotionalem Stress handeln, was oft zu Abweichungen von idealen Modellen führt.
- Quote paper
- Christian Michel (Author), 2019, Krisenkommunikation auf Social Media. Strategien, Maßnahmen und Erfolgsfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468840