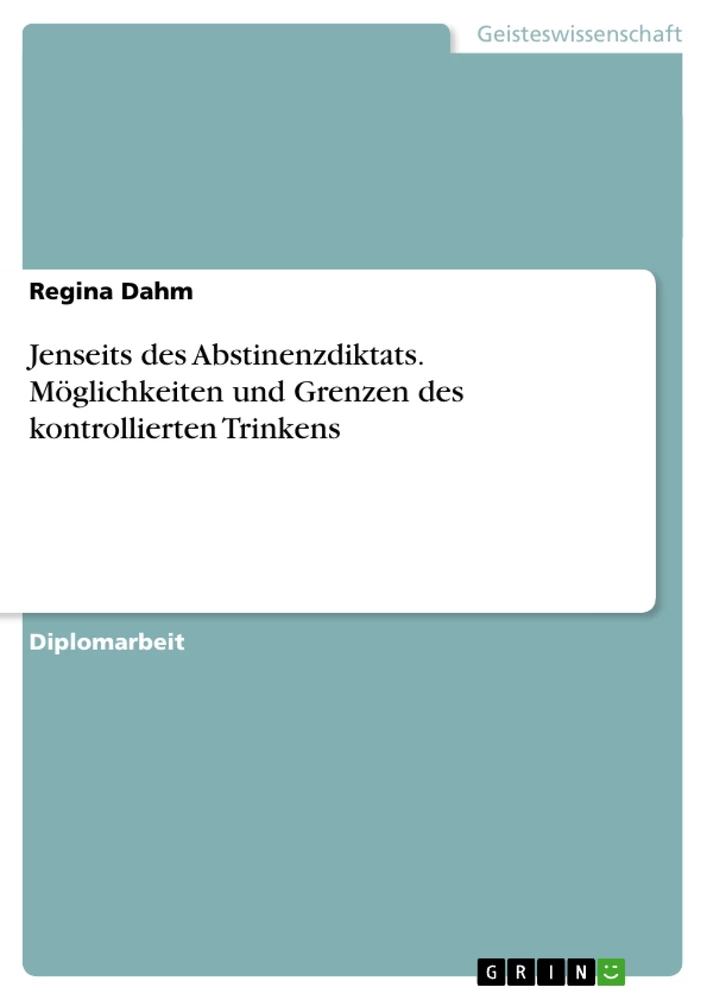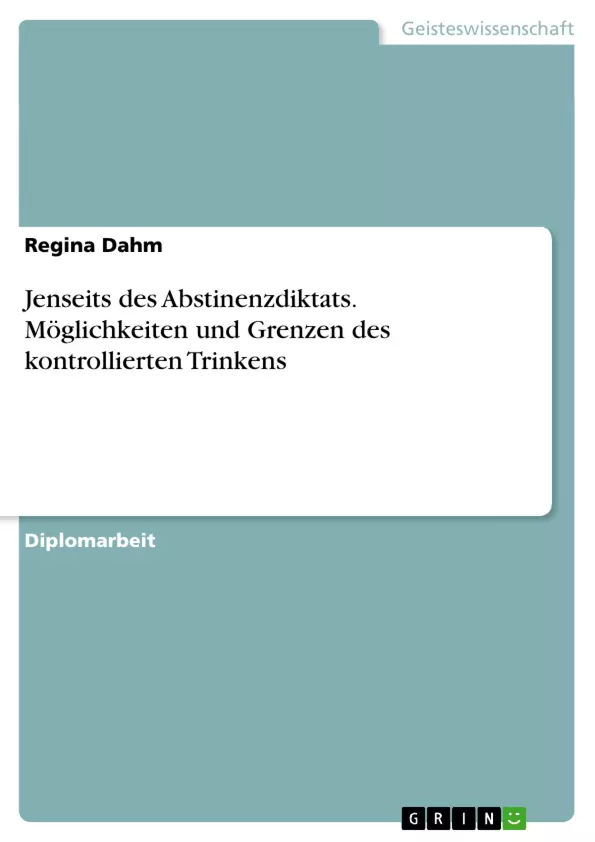Suchterkrankungen gehören zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Neben den individuellen und familiären Folgen führen Suchterkrankungen durch langfristige Arbeits-unfähigkeit, frühzeitige Berentung und sucht-bedingte Begleiterkrankungen zu erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten . Rein fiskalisch betrachtet sind die finanziellen Verluste, die der Gesellschaft durch Alkoholmissbrauch entstehen, mindestens dreimal so hoch wie die durch Steuern und Alkoholproduktion erzielten Gewinne. Besonders in Deutschland, wo die Trinkkultur geprägt ist von einer permissiven Einstellung und einer sozialen Akzeptanz, ist das Risiko, einen problematischen Alkoholkonsum zu entwickeln, tendenziell hoch. Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich werden soll, wird ein Teil von Menschen mit Alkoholproblemen von unserem traditionellen, abstinenzorientierten Suchthilfesystem nicht erreicht. In einschlägiger Literatur wird auch von der „vergessenen Mehrheit“ gesprochen. So stellt sich also die Frage nach geeigneten Konzepten, welche möglichst viele Menschen mit Alkoholproblemen möglichst frühzeitig erreichen und ihnen akzeptable, bedarfsgerechte und effiziente Hilfsangebote bieten können. Das kontrollierte Trinken, dass in der traditionellen Suchthilfe seit Anfang der Diskussion als kaum realisierbar galt, soll in dieser Arbeit als mögliche Alternative in der Behandlung von Menschen mit Alkoholproblemen dargestellt und hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Grenzen geprüft werden. Es soll zudem der Versuch gemacht werden, die Bedeutung des „Abstinenzparadigmas“ in der traditionellen Suchthilfe hinsichtlich seiner Wirksamkeit zwar zu würdigen, aber auch seine Grenzen aufzuzeigen. Gerade die Selbsthilfe und die Abstinenzverbände stehen dem kontrollierten Trinken sehr kritisch und teils ablehnend gegenüber, was sich in deren Veröffentlichungen widerspiegelt und der objektiven Betrachtungsweise des Themas nicht unbedingt zuträglich ist. Aber auch die Befürworter neuer Erkenntnisse auf diesem Gebiet lassen sich nicht selten von unsachgemäßen Argumenten leiten und stellen das „Althergebrachte“ in unreflektierter Art und Weise in Frage. Diese Arbeit hat das Ziel, einen Überblick über die neue Diskussion zu schaffen um aus der Vielzahl der zu diesem Thema veröffentlichten Meinungen, Betrachtungsweisen und Forschungsergebnissen Konsequenzen für die Praxis ableiten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen der Arbeit
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.1.1 Sucht
- 2.1.2 Missbrauch
- 2.1.3 Abhängigkeit
- 2.2 Diagnostische Kriterien des Alkoholismus nach ICD-10
- 2.3 Diagnostische Kriterien des Alkoholismus nach DSM-IV
- 2.4 Phasen des Alkoholismus nach Jellinek
- 2.5 Typologien des Alkoholismus
- 2.5.1 Unauffällige Trinkformen
- 2.5.1.1 Normales Trinken
- 2.5.1.2 Soziales Trinken
- 2.5.1.3 Moderates/mäßiges Trinken
- 2.5.1.4 Kontrolliertes Trinken
- 2.5.2 Auffällige/behandlungsbedürftige Trinkformen
- 2.5.2.1 Problemtrinker
- 2.5.2.2 Schwer Alkoholabhängige Trinker
- 2.5.2.3 Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke
- 2.5.3 Typologien nach Jellinek
- 2.5.3.1 Alpha-Typ
- 2.5.3.2 Beta-Typ
- 2.5.3.3 Gamma-Typ
- 2.5.3.4 Delta-Typ
- 2.5.3.5 Epsilon-Typ
- 2.5.4 Typologien nach Cloninger
- 2.5.4.1 Typ A
- 2.5.4.2 Typ B
- 2.5.1 Unauffällige Trinkformen
- 2.6 Epidemiologie
- 2.6.1 Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol
- 2.6.1.1 In Deutschland
- 2.6.1.2 International
- 2.6.2 Konsumverteilung in der Bevölkerung
- 2.6.3 Mortalität
- 2.6.1 Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol
- 2.7 Entstehungstheorien
- 2.7.1 Suchtdreieck
- 2.7.2 Soziokulturelle Faktoren
- 2.7.2.1 Abstinenzkulturen
- 2.7.2.2 Trinkkulturen
- 2.7.2.3 Gestörte Trinkkulturen
- 2.7.3 Analytisch-tiefenpsychologische Erklärungsansätze
- 2.7.4 Verhaltenstherapeutisch orientierte Ansätze
- 2.7.5 Neurobiologische Erklärungsansätze
- 2.7.6 Spirituelle Faktoren
- 2.7.7 Fazit
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 3. Behandlung der Alkoholsuchterkrankung
- 3.1 Allgemeine Ziele und Prinzipien der Behandlung
- 3.2 Frühinterventionen
- 3.3 Behandlung in fachlichen Einrichtungen
- 3.4 Wirksamkeit ambulanter und stationärer Entwöhnungsbehandlungen
- 3.4.1 Ambulante Entwöhnungsbehandlungen
- 3.4.2 Stationäre Entwöhnungsbehandlungen
- 3.5 Strukturmodell für die Versorgung von Menschen mit Alkoholproblemen
- 3.6 Zugänge zum Hilfesystem
- 4. Das Konzept des kontrollierten Trinkens
- 4.1 Die Geschichte des kontrollierten Trinkens
- 4.2 Angebote des kontrollierten Trinkens
- 4.2.1 Schriftliche Selbstkontrollanleitungen
- 4.2.2 Angeleitete Einzel-/Gruppenprogramme
- 4.2.2.1 Das ambulante Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken (AKT)
- 4.2.2.2. Das ambulante Einzelprogramm zum kontrollierten Trinken (EKT)
- 4.2.3 Selbsthilfegruppen zum kontrollierten Trinken
- 4.3 Evaluation der Angebote des kontrollierten Trinkens
- 4.3.1 Ziele des kontrollierten Trinkens
- 4.3.2 Wirksamkeit des ambulanten Gruppenprogramms zum kontrollierten Trinken (AKT)
- 4.3.3 Wirksamkeit des 10-Schritte-Programms zum kontrollierten Trinken
- 5. Möglichkeiten und Grenzen des kontrollierten Trinkens
- 5.1 Möglichkeiten des kontrollierten Trinkens
- 5.1.1 Zieloffenheit
- 5.1.2 Argumente für das kontrollierte Trinken unter Einbezug von Meinungen aus der Praxis
- 5.1.2.1 Meinungen aus der Praxis zum kontrollierten Trinken (Frage 2)
- 5.1.2.2 Meinungen aus der Praxis zum kontrollierten Trinken (Frage 3)
- 5.2 Grenzen des kontrollierten Trinkens
- 5.2.1 Argumente gegen das kontrollierte Trinken unter Einbezug von Meinungen aus der Praxis
- 5.2.1.1 Meinungen aus der Praxis zum kontrollierten Trinken (Frage 2)
- 5.2.1.2 Meinungen aus der Praxis zum kontrollierten Trinken (Frage 3)
- 5.2.2 Fehlen von Langzeitstudien
- 5.2.3 Mängel in der Erreichbarkeit
- 5.2.1 Argumente gegen das kontrollierte Trinken unter Einbezug von Meinungen aus der Praxis
- 5.1 Möglichkeiten des kontrollierten Trinkens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept des kontrollierten Trinkens im Kontext der Alkoholsuchterkrankung. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes zu beleuchten und seine Wirksamkeit in der Praxis zu bewerten.
- Definition und Abgrenzung des kontrollierten Trinkens
- Theoretische Grundlagen der Alkoholsucht und ihrer Behandlung
- Evaluation verschiedener Angebote des kontrollierten Trinkens
- Analyse der Argumente für und gegen das kontrollierte Trinken
- Bewertung der Rolle des kontrollierten Trinkens in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und den Aufbau der Arbeit skizziert. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Dazu gehören die Definitionen von Sucht, Missbrauch und Abhängigkeit, die Diagnostik des Alkoholismus nach ICD-10 und DSM-IV sowie verschiedene Typologien des Alkoholismus. Des Weiteren werden epidemiologische Daten zum Alkoholkonsum und zur Mortalität im Zusammenhang mit Alkohol präsentiert. Kapitel 2 schließt mit einer Diskussion verschiedener Entstehungstheorien der Alkoholsucht.
Kapitel 3 befasst sich mit der Behandlung der Alkoholsuchterkrankung. Es werden allgemeine Ziele und Prinzipien der Behandlung sowie verschiedene Interventionen, wie Frühinterventionen und Behandlungen in fachlichen Einrichtungen, vorgestellt. Die Wirksamkeit ambulanter und stationärer Entwöhnungsbehandlungen wird ebenfalls betrachtet. Kapitel 3 schließt mit einer Darstellung des Strukturmodells für die Versorgung von Menschen mit Alkoholproblemen und den Zugängen zum Hilfesystem.
Kapitel 4 widmet sich dem Konzept des kontrollierten Trinkens. Es werden die Geschichte dieses Ansatzes, verschiedene Angebote des kontrollierten Trinkens und deren Evaluation diskutiert. Kapitel 5 beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen des kontrollierten Trinkens.
Schlüsselwörter
Kontrolliertes Trinken, Alkoholsucht, Alkoholismus, Abhängigkeit, Behandlung, Frühinterventionen, Entwöhnungsbehandlungen, Epidemiologie, Entstehungstheorien, Typologien, Diagnostik, Wirksamkeit, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Abstinenz und kontrolliertem Trinken?
Abstinenz fordert den völligen Verzicht auf Alkohol, während kontrolliertes Trinken das Ziel verfolgt, den Konsum auf ein risikoarmes Maß zu reduzieren.
Für wen ist kontrolliertes Trinken geeignet?
Es richtet sich vor allem an Problemtrinker oder Menschen mit schädlichem Gebrauch, für die eine lebenslange Abstinenz (noch) keine akzeptable Option darstellt.
Was sind die Grenzen des kontrollierten Trinkens?
Bei schwerer körperlicher Abhängigkeit oder fortgeschrittenen Organschäden gilt die Abstinenz weiterhin als das medizinisch notwendige Ziel.
Welche Programme zum kontrollierten Trinken gibt es?
Bekannte Ansätze sind das Ambulante Gruppenprogramm (AKT) oder das Einzelprogramm (EKT), die mit Trinktagebüchern und festen Regeln arbeiten.
Wie wird die Wirksamkeit dieser Programme bewertet?
Studien zeigen, dass Programme zum kontrollierten Trinken oft Menschen erreichen, die das traditionelle Suchthilfesystem bisher gemieden haben.
- Arbeit zitieren
- Regina Dahm (Autor:in), 2005, Jenseits des Abstinenzdiktats. Möglichkeiten und Grenzen des kontrollierten Trinkens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46916