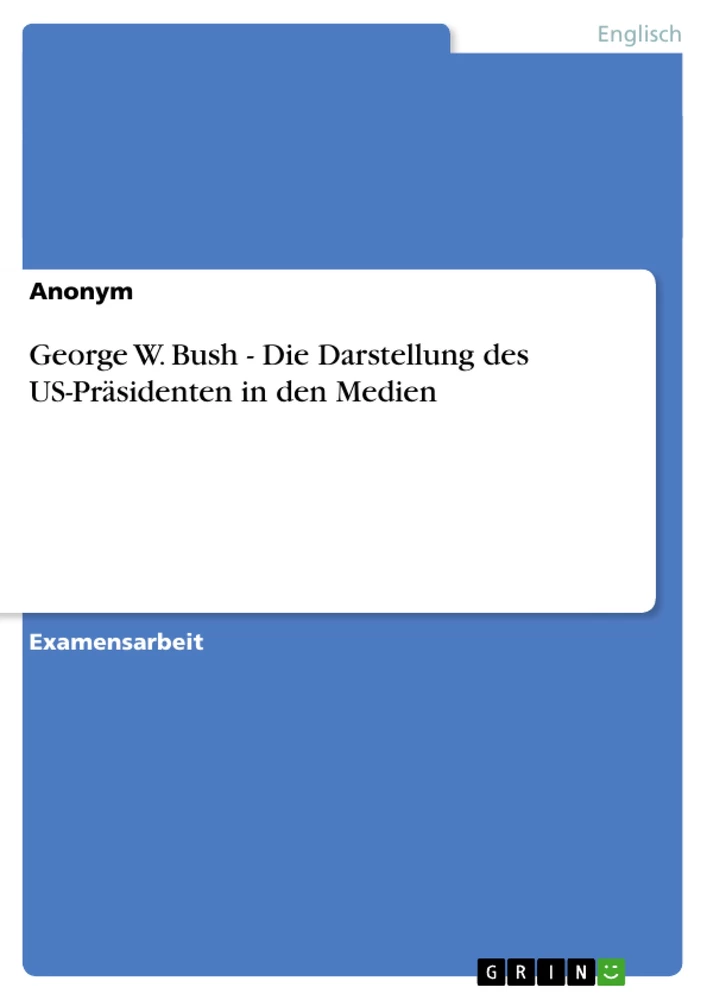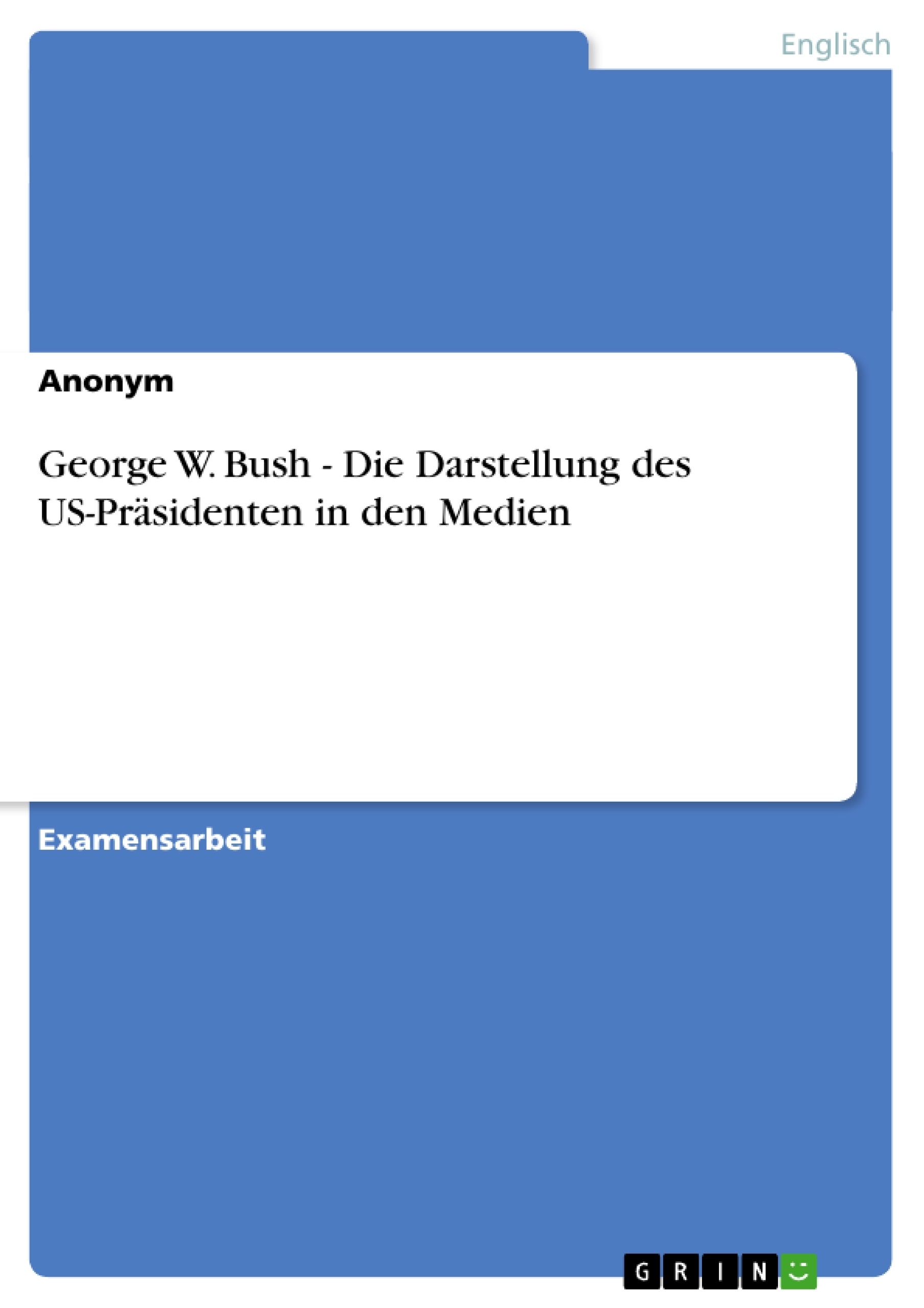George W. Bush ist seit seiner ersten Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Der umstrittene Ausgang der Stimmenauszählung scheint wie ein Startschuss medialer Auseinandersetzung mit seiner Person gewesen zu sein. Seine Aussagen, seine Stilblüten, seine Offenheit und nicht zuletzt auch seine Religiosität haben ihn auf unterschiedliche Weise in den Medien erscheinen lassen. Der Bush-Interessierte wird von relevantem Bildmaterial aus Zeitschriften, Zeitungen und dem Internet geradezu überschüttet. Gerade Letzteres bietet eine unüberschaubare Menge an Bildgut. Was liegt also näher als George W. Bushs Person vor seinem visuellen Hintergrund zu untersuchen. Gegenstand dieser Arbeit ist es, Aufnahmen von George W. Bush näher zu betrachten und ihn als mediale Figur vor dem Hintergrund seiner politischen Führung zu analysieren. Wie wird der Präsident in den Medien präsentiert? Weisen diese Bilder Merkmale seiner Politik auf? Sagen sie dem Betrachter etwas über seine Person? Um Antworten auf diese Fragen zu finden wurden zwei Arten von Bildmaterial untersucht. Nach einer kurzen Einführung über psychische Prozesse beim Bildverstehen wird das Bildmaterial in journalistische Aufnahmen und satirisches Bildgut aufgeteilt. Während journalistische Aufnahmen gewissen Normen unterliegen, lassen sich für satirisches Bildmaterial so gut wie keine Regeln aufstellen, da sie alle Medien einbeziehen dürfen. So werden ein parodiertes Filmplakat, Comic-Strips und auch eine digital veränderte Aufnahme als satirische Beiträge untersucht. Auch dem Faktor Politik wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, denn politische Bilder entfernen sich immer weiter davon, eine zufällige Momentaufnahme zu sein, sondern werden zunehmend von einer speziellen Berufsgruppe inszeniert. Am Ende stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln die jeweiligen Bilder ihr Ziel erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- ABSTRACT.
- EINLEITUNG.
- VORWORT
- PROZESS DES BILDVERSTEHENS
- Mentale Modelle.
- Nicht-kognitive Prozesse
- Der ikonische Code
- Bild und Bildproduzent........
- JOURNALISTISCHE BILDER
- EINFÜHRUNG.
- GEORGE W. BUSH UND JOHN KERRY.
- ,,Die Freiheit führt das Volk“ an von Eugène Delacroix.
- ,,American Gothic\" von Grant Wood..
- BUSH UND DIE RELIGION.
- Im Vergleich: Treffen im Oval Office.
- Bush und der Papst..
- Spin Doctors.
- SATIRISCHE BILDER.
- EINFÜHRUNG..
- BUSH UND DAS INTERNET
- BUSH ALS FILMHELD.
- BUSH IM COMIC
- Exkurs: Physiognomik.
- BUSH ALS SUPERHELD
- Osama bin Laden..
- Uncle Sam...
- BUSH UND DIE BILDUNG
- ,,America - A patriotic primer\".
- Die Freiheitsstatue
- Bildung
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- JOURNALISTISCHE BILDER
- SATIRISCHE BILDER
- BILDER UND POLITIK
- BILDNACHWEISE
- BIBLIOGRAPHIE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung von George W. Bush in den Medien. Sie analysiert journalistische und satirische Bilder, um zu verstehen, wie der US-Präsident in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dabei werden sowohl die ikonographischen Elemente der Bilder als auch die psychologischen Prozesse des Bildverstehens betrachtet.
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von politischen Identitäten
- Die Darstellung von George W. Bush in journalistischen und satirischen Bildern
- Die Verwendung von Symbolen und Stereotypen in der Bildsprache
- Die Rezeption von Bildern durch den Betrachter
- Der Einfluss von politischem Kontext auf die Interpretation von Bildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Prozess des Bildverstehens und erläutert die Bedeutung mentaler Modelle und ikonischer Codes. Anschließend werden journalistische Bilder von George W. Bush analysiert, wobei der Fokus auf der Darstellung des Präsidenten als Person und als Symbol liegt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden satirische Bilder von Bush betrachtet, die kritische Perspektiven auf seine Person und Politik aufzeigen. Dabei werden die Methoden der Satire und die Bedeutung des Humors als Mittel der Kritik untersucht.
Schlüsselwörter
George W. Bush, Medien, Bilder, Journalismus, Satire, Politik, Symbol, Stereotyp, Ikonografie, Bildrezeption, Mentalmodell, Spin Doctor
Häufig gestellte Fragen
Wie wird George W. Bush in den Medien dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Präsentation in journalistischen Aufnahmen (Normen unterliegend) und satirischem Bildgut (parodierte Plakate, Comics).
Welche Rolle spielen „Spin Doctors“ bei politischen Bildern?
Politische Bilder sind oft keine Zufallsprodukte, sondern werden von Spezialisten inszeniert, um bestimmte Merkmale der Führung und Politik zu transportieren.
Was untersucht die Arbeit im Bereich der Satire?
Untersucht werden unter anderem George W. Bush als Filmheld, Superheld oder in Comic-Strips, wobei auch Aspekte der Physiognomik eine Rolle spielen.
Wie funktioniert der Prozess des Bildverstehens?
Das Verständnis basiert auf mentalen Modellen, dem ikonischen Code und nicht-kognitiven Prozessen beim Betrachter.
Welche Symbole werden in der Bildsprache über Bush genutzt?
Häufige Bezüge finden sich zur Religion (Treffen mit dem Papst), zum Patriotismus (Uncle Sam) oder zu kunsthistorischen Vorbildern wie Delacroix.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, George W. Bush - Die Darstellung des US-Präsidenten in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46947